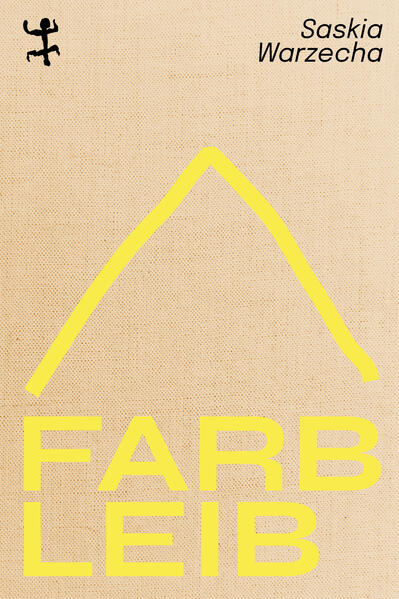
Zustellung: Di, 22.07. - Do, 24.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Die Erdkugel schleicht um die Sonne / der Farbleib wartet im Haus. « So beginnt Saskia Warzechas zweiter Lyrikband Farbleib und setzt damit bereits die Eckpunkte, von denen aus sich ein Langgedicht in sechzig Augenblicken entspinnt, das an festgefahrenen Einstellungen rüttelt. Geschult am New Materialism, versteht dieses Schreiben Materie nicht als lediglich dem Menschen Zuhandenes, als einheitliche, träge Substanz oder als sozial konstruiertes Faktum, sondern als aktive Kraft, die genauso sehr durch menschliches Wirken und Erfahren geformt wird, wie sie diese formt. Warzecha spürt Harmonie auf, wo zuvor Ordnung regierte, fächert die Dimensionen aus, dehnt und verschleift sie, bis einem schwindlig wird. Die Frage, wo oben ist, wo unten, wann jetzt ist und wann dann, weicht hier einer Poetik der Öffnung, die berührt, ohne besitzen zu wollen, die sich nähert, ohne Land zu nehmen. Diese Welt, die so entsteht, mit dem rätselhaften Farbleib, dem Zögling, dem Haus, ist es, in der man gerne leben möchte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. August 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
68
Autor/Autorin
Saskia Warzecha
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
165 g
Größe (L/B/H)
205/123/12 mm
ISBN
9783751809931
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 30.10.2024
Besprechung vom 30.10.2024
Die Drehtür dreht, und damit verändert sich der Blick
Von der Fülle her denken: Saskia Warzechas zweiter Gedichtband "Farbleib"
Die Gedichte von Saskia Warzecha gleichen kleinen Versuchslaboren. Schon in ihrem ersten Band, "Approximanten", 2020 mitten im ersten Corona-Lockdown erschienen, hat sie alles auf die Probe gestellt: die Arten, wie man die Welt wahrnimmt, die Möglichkeiten poetischer Rede - und erst recht die Sprache selbst. Das kann sich dann so anhören: "faustregel, nahezu flucht: du bist nicht hier, um hauptsäch- / lich heiler zu werden. und mein grüßen schlägt fehl." Oder so: "das haus hellblau, sodass an / sonnentagen, beim leichten lider senken, die fenster / schweben, weil die wände verschwinden."
Auch in ihrem neuen Band begibt sich Warzecha, geboren 1987 in Peine, ins Labor. Nur ist es diesmal kein wissenschaftlich ausgefeiltes Speziallabor, in dem sogar die Fachsprachen einer genauen Analyse unterzogen werden, sondern ein Raum, der sehr viel elementarer wirkt. Wobei "Raum" zu wenig ist, denn im Bildfeld des Bandes geht es um ein Haus. Nicht um ein hellblaues, aber die Wände verschwinden auch hier, und womöglich können die Fenster schweben.
Gleich im ersten Gedicht taucht das geheimnisvolle Wort "Farbleib" auf, dem das Buch seinen Titel verdankt: "und Gelenk / wie betrachtet man Bögen? // die Erdkugel schleicht um die Sonne / der Farbleib wartet im Haus." Es ist ein geschickter Zug, den vertrauten Wortteil "Farb-" mit einem Nomen wie "Leib" zu verbinden, das nicht mehr selbstverständlich benutzt wird. So entsteht ein Verfremdungseffekt, eine leichte Verschiebung, die schon einen Wink darauf gibt, was Saskia Warzecha in diesem Band interessiert: Beweglichkeit und Verwandlung. Das lässt auch der ganze Begriff "Farbleib" spürbar werden: nicht von den Umrissen, Begrenzungen her zu denken, sondern von der Fülle her, von den Möglichkeiten und Übergängen.
Doch diese Fluidität ist nur das eine Moment. In den meisten Gedichten kann man eine Doppelstrategie ausmachen: etwas zu setzen (ein Wort, eine bildliche Formation) und es zugleich beweglich zu halten, jeder Erstarrung entgegenzuarbeiten. So kommen immer wieder Gelenke und Scharniere vor, Elemente, die Verbindungen herstellen und drehbar sind und die so beide Momente verkörpern, Setzung und Beweglichkeit. Dazu passend finden sich "Kippschalter" und "Wippbilder", "Hebelfiguren" und "Stolperkunststücke". Aber auch Paradoxien wie "ein fortwährend auf den Boden fallender Stein".
Das Haus wird mal in seinen rudimentären Bestandteilen skizziert, mit Balken, Fenstern, Türen. Mal baut es sich vor den Augen förmlich auf: "Zwischengeschosse entstehen", und der Garten wächst. Dann wieder hat man einen veritablen "Fischpalast" vor sich, in dem es ums Gleiten und Schlingern geht. Hier kann ein Fisch sich in einen Vogel verwandeln, aber auch "ein Fisch sich in einen Fisch".
Ebenso raffiniert offen ist die Sprechposition gehalten. Weder ein "Ich" noch ein "Wir" tauchen auf, am ehesten ist es ein Spiel mit einer lockeren Form von Beschreibung. Aber es gibt eine Figur, die in vielen Gedichten erscheint: den "Zögling". Der Zögling ist einer, der etwas lernen möchte und dem man etwas zeigen will. Dieser Zögling "übt" immer wieder, Techniken des Laufens und Zusammenbauens genauso wie Verhaltensweisen. Er streift durch den Garten, schaut durch Fenster und stellt Fragen. Das alles geschieht in einer Atmosphäre der Gegenwärtigkeit, die durch ein fortwährendes Präsens und Wortfindungen wie "Jetzthaus" oder "Hierscharnier" markiert wird. Bis sich auf der Achse des Bandes etwas ändert. Vergangenheitsformen schießen ein, und die Idee von Zeitlichkeit gewinnt an Bedeutung. Nicht von ungefähr liegen "Farbleib" und "Verbleib" lautlich nah beieinander.
"Ein Langgedicht in sechzig Augenblicken", so wird die Form des Bandes im Klappentext beschrieben. Das erinnert ein wenig an Walter Höllerers berühmte "Thesen zum Langen Gedicht", in denen der große Dichter und Veranstaltungserfinder seine Vorstellung, ein Gedicht lebe von einer momenthaft aufblitzenden Energie, von "Augenblickselementen", mit der Idee eines längeren poetischen Atems verband. Nach Höllerer geht es im Langgedicht nicht nur um eine erhöhte Anzahl an Zeilen, sondern um eine andere Gestalt und Rhythmik des Verses. Auch hier ist "Beweglichkeit" das Stichwort. Im Langgedicht lässt sich für ihn eine umfassendere Art des Sehens und Denkens entwickeln. Eine Form der Offenheit und Freiheit, als Gegenbewegung zu aller Einengung in "Kästchen und Gebiete".
Höllerers Thesen sind 1965 erschienen, zur Zeit der Studentenproteste, doch sie haben bis heute nichts an Lebendigkeit verloren. Und sie gehen einem beim Lesen dieses Bandes ebenso durch den Kopf wie die Gedichte von Elke Erb, auf die sich Saskia Warzecha eigens bezieht. Erbs Idee eines Schreibens als Prozess oder einer dauernden Arbeit an der Sprache ist auf wundersame Art und Weise gegenwärtig. Mit Vorliebe verschiebt Warzecha die Laute, sodass aus dem "Zögling" das "Zeuglein" wird, der "Leib" sich in "Leid" verwandeln kann oder das "Dachgeschoss" in ein "Da-Geschoss". Dazu kommen Wortschöpfungen, von der "Spukrast" zur "Tagtrage" über das "Streblicht" bis zu "Augenschauschau". Oder sie lässt sich wie Elke Erb von der "Lautleite" anregen und erfindet klangstarke Verse: "Vasen die sanftglasig Aas in sich tragen".
Und spätestens als es in einem Gedicht heißt "das Früher-Haus geht (. . .) / statt / dies Haus ist gegangen", wird einem klar: Saskia Warzecha versucht tatsächlich etwas Neues, indem sie das Verstreichen von Zeit nicht wie üblich an Verben, sondern an Substantiven festmacht. Trotz aller Wortschöpfungen bleiben ihre Sprache und ihr Rhythmus dabei ebenso klar und elementar wie die Übungssituationen, die sie entwirft. Nur an einigen wenigen Stellen sind die Gegenübersetzungen etwas schematisch geraten und wirken ein bisschen lehrhaft.
Umso faszinierender ist, was Saskia Warzecha im Ganzen gelingt. Spracharbeit ist hier kein hübsches Beiwerk oder Spielerei, sondern Forschungsarbeit. Es sind Untersuchungen darüber, wie sich Wahrnehmen und Denken in Sprache übersetzen - und welche Möglichkeitsräume sich noch entdecken lassen. "Die Drehtür dreht", heißt es einmal. Und man lässt sich sehr gerne mitdrehen und staunt, wie sich Blick und Sprache ändern. NICO BLEUTGE
Saskia Warzecha: "Farbleib". Gedichte.
Matthes & Seitz, Berlin 2024. 70 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Farbleib" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









