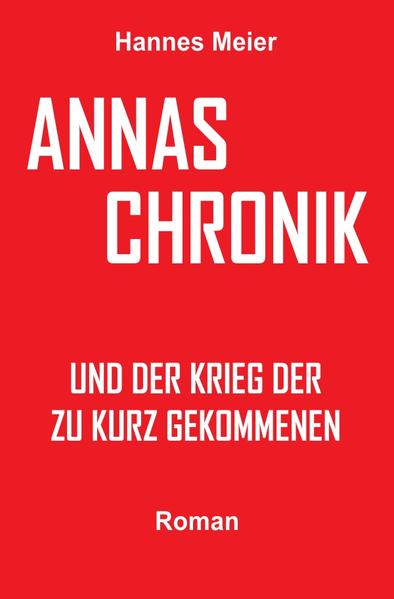
Zustellung: Mi, 21.05. - Fr, 23.05.
Versand in 4 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Eine Geschichte, die in einer katholischen Kleinstadt in der Schweiz spielt. Ein tragisch-komisches Familienepos, bei dem auch mal das Lachen im Halse stecken bleibt
Tot liegt Anna im Sterbezimmer des Pflegeheims. Ihre fünf erwachsenen Kinder und ein Schwiegersohn halten Totenwache am Bett der Mutter. Danach kommt es in der Cafeteria zur Abrechnung. Neid, Missgunst, aber auch zutiefst verletzte Gefühle eskalieren zum Geschwisterkrieg, der immer groteskere Formen annimmt.
Bernhard, der Älteste, findet im Nachlass der Mutter Briefe und eine Chronik, in der Anna ihr Leben von den Kriegs- und Nachkriegsjahren bis zur Jahrtausendwende schildert: Die Enge ihrer schweizerischen Kleinstadt, die Macht der katholischen Kirche, ihre Angst vor Sünde und ewiger Verdammnis, die sie von einer Schwangerschaft in die nächste treibt, ihre Ehe mit Johnny, der bis zum Ende ihre große Liebe bleibt, auch wenn er sich dem Kindergeschrei mit Überstunden und Schützenfesten entzieht. Immer mehr schlägt Annas Verzweiflung in Wut um auf jene, die sie für die Ursache ihres Unglücks hält: Die Kinder. . .
Bernhard, der Älteste, findet im Nachlass der Mutter Briefe und eine Chronik, in der Anna ihr Leben von den Kriegs- und Nachkriegsjahren bis zur Jahrtausendwende schildert: Die Enge ihrer schweizerischen Kleinstadt, die Macht der katholischen Kirche, ihre Angst vor Sünde und ewiger Verdammnis, die sie von einer Schwangerschaft in die nächste treibt, ihre Ehe mit Johnny, der bis zum Ende ihre große Liebe bleibt, auch wenn er sich dem Kindergeschrei mit Überstunden und Schützenfesten entzieht. Immer mehr schlägt Annas Verzweiflung in Wut um auf jene, die sie für die Ursache ihres Unglücks hält: Die Kinder. . .
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. Oktober 2016
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
300
Altersempfehlung
von 18 bis 99 Jahren
Autor/Autorin
Hannes Meier
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
299 g
Größe (L/B/H)
190/125/17 mm
ISBN
9783741857461
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
am 12.07.2017
Hannes Meier: Annas Chronik und der Krieg der zu kurz Gekommenen
So gehört sich das für einen guten Roman: Eine Szene, die den Leser in medias res führt. Alle Fäden der vorangegangenen und folgenden Handlung führen auf sie hin oder gehen von ihr aus. Sterbezimmer, immer eine beklemmende Situation. Hier wird sie gleich zur Groteske: Unterm Kreuz das "ausgemergelte" Gesicht der toten Mutter ist rosa, rot und violett geschminkt. Was wird aus der guten alten Mutter nach ihrem Tod gemacht? In welchem Licht oder in welcher Farbe soll sie sich für die fünf Kinder jeweils zeigen? Sie, die durch den Tod Annas aus ihrem jeweiligen Alltag gerissen, nun im Sterbezimmer zusammenkommen, um im Abschied in ihren Erinnerungen ihr Verhältnis zur Mutter zu rekapitulieren. Für alle spiegelt sich ihre eigene Entwicklung wider: Was sollte aus mir werden, was wollte ich aus mir machen? Was ist aus mir geworden? Wie hat mich die Mutter behandelt? Was hat sie verhindert? Wie hat sie mich gefördert? Hat sie die anderen mehr geliebt als mich? Jeder schlägt eine andere Seite des Buches "Anna" auf, nämlich die, auf der über ihn etwas von Anna steht. Kein Wunder, dass Annas Gesicht so viele Farben hat.
Am Erbe soll sich zeigen, wie groß die Liebe der Mutter war. Diese Verquickung von Trauer um eine geliebte Mutter mit der Bemessung der Erbanteile lässt jeden Erbfall zum Horror werden. In den moralischen Vorwürfen der erwachsenen Geschwister wiederholt sich ihr Verhältnis in der Kindheit: Das Buhlen um die Liebe der Mutter von damals wird jetzt der Anspruch auf moralische Vergeltung in Form von - Geld.
Jeder, der so eine Erbgeschichte selbst erlebt oder von anderen gehört hat, erkennt das Prinzip im "Krieg der zu kurz Gekommenen" sofort wieder. Den "Franz" gibt es im Streit ums Erbe immer. Jede Gemeinheit aus der Kindheit kommt auf den Tisch, jede Bevorzugung eines anderen Geschwisters wird noch einmal erlebt und als Nachteil in der eigenen Entwicklung verrechnet. Dem Autor gelingt es, in den oft abstrusen, zugleich schlüssigen Charakteren die typischen Parteiungen eines solchen Krieges glaubwürdig darzustellen.
Wie Oskar Maria Graf in seinem Buch "Das Leben meiner Mutter" ein Stück bayerische Zeitgeschichte anhand eines Einzelschicksals dargestellt hat, so versetzt der Autor den Leser in die Schweiz der ersten Hälfte und mit dem zweiten Handlungsstrang in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der alle Gefühle erdrückende Katholizismus bildet den engen Rahmen einer lebenslustigen, aber gottesfürchtigen Frau. Vitalität ist für sie Kinderkriegen, Erziehung ist für sie Züchtigen. Wunderbar authentisch wirken da Annas Überlegungen in Form von Auszügen aus ihrem Briefverkehr und Tagebuch. Herrlich der Brief ihres Mannes, des Buchhalters Johnny, der die Details seiner Velotour über die Alpen auf einem Durchschlagpapier akribisch auflistet. All die originalen Ausdrücke wie "Klösterli" oder "Negerli" lassen die Schweizer Familiengeschichte auch sprachlich genießen.
am 07.02.2017
Wie im Titel schon angedeutet, geht es hier um zwei Erzählstränge, die aber, anders als zum Beispiel bei den Doppelromanen Kater Murr von E. T. A. Hoffmann oder Arno Schmidts KAFF auch Mare Crisium , zwar auch kontrastieren, aber inhaltlich direkter miteinander verbunden sind. Chronologisch aufeinander folgende Inhalte werden hier ineinander verzahnt. Scharnierfunktion hat der Anfang, wo fünf Geschwister (und ein Schwager) am Totenbett ihrer Mutter versammelt sind. Die Handlung verzweigt sich dann in einen mehr dokumentarischen Strang über den Lebenslauf der Verstorbenen mit Auszügen aus ihrem Briefverkehr und ihrem Tagebuch und dem eher grellen Strang über die darauf folgenden Erbstreitigkeiten der sehr unterschiedlichen Charaktere der Nachkommen.
Dass Hannes Meier in der Schweiz aufgewachsen ist und, wie in der Kurzvita zu lesen ist, als Regisseur und Drehbuchautor gearbeitet hat, spiegelt sich auch in diesem Roman wider. Das Schweizer Lokalkolorit ist unverkennbar, teilweise ein wenig dick aufgetragen. Die Gestaltung des Werks mit oft kurzen wechselnden Sequenzen - und häufigen phantasievollen Gags beim Streit der Geschwister - lässt an die Dramaturgie bei Spielfilmen denken. Dagegen steht die eher an Dokumentarfilme erinnernde Chronologie des Lebens der Mutter, die beklemmende und anrührende Zeichnung eines Lebens, befangen in den Zwängen einer bigotten katholischen Erziehung, was vor allem in den Tagebuchauszügen zum Ausdruck kommt.
Es ist ein kurzweilig zu lesender, flüssig und witzig geschriebener Roman, dessen Reiz auch darin besteht, dass er sich kaum in ein
Klischee einordnen lässt.









