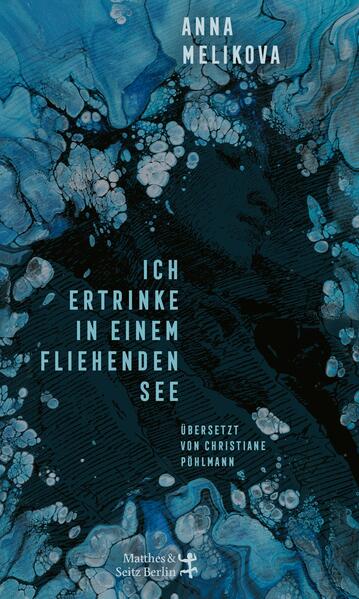Besprechung vom 13.03.2025
Besprechung vom 13.03.2025
Zwischen den Fronten auf der Suche nach Heimat
Poetisch politisch: Anna Melikova schildert den russisch-ukrainischen Konflikt als Kampf um die eigene Sprache.
"Wann weiß man, dass ein Krieg angefangen hat?", fragt sich die Protagonistin in Anna Melikovas Debütroman "Ich ertrinke in einem fliehenden See". Es ist 2014, die Ich-Erzählerin besucht ihre Familie auf der Krim. Nach einem Streit mit ihrem Vater über die russische Annexion geht sie an den Strand und schaut auf die Wellen: Das Meer widerspricht klaren Zuordnungen, es gehört niemandem. Doch der Wunsch nach Freiheit von nationalen Grenzen erweist sich im Krieg als unmöglich und wächst in der Protagonistin zum inneren Konflikt heran.
In ihrem autofiktionalen Roman erzählt Anna Melikova die Geschichte jener jungen Frau, die sich während des Studiums in Kiew in ihre Dozentin verliebt. Während sie über Jahre versucht, sich von der ungesunden Beziehung zu befreien, spitzt sich der russisch-ukrainische Konflikt zu: Die Handlung setzt im Jahr 2005 ein, kurz nach der Orangenen Revolution, und endet 2023. Was als Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einer Reflexion über Heimat und Identität.
Auf der Krim geboren, arbeitet die Ich-Erzählerin nach dem Studium in Moskau. So gelingt es, unterschiedliche Blickwinkel auf den Konflikt vorzustellen. Ihr prorussischer Vater beschimpft die protestierenden Ukrainer als "Chochly" (Kosakenlocken) und "Banderas" (also Nazis), von denen die Ukraine laut russischer Propaganda bereinigt werden müsste. Ihre Geliebte verachtet dagegen die Bewohner der Krim als "Aufziehpuppen von Putin", die Russland verklären würden. Zwischen diesen Extremen versucht die Protagonistin, beide Nationen in sich zu vereinen. Doch Ukrainer werfen ihr ihre russische Sprache vor, Russen ihren ukrainischen Dialekt. Erst allmählich gelingt es der Erzählerin, ihre eigene Sprache zu finden.
Im Geiste der linguistischen Wende verwendet Melikova Sprache, um die Emanzipation der Protagonistin zum Ausdruck zu bringen. Schweigsam versucht sie zu Beginn, sich jeder Positionierung zu entziehen. Statt eine eigene Identität herauszubilden, verliert sie sich in der Bewunderung von Künstlerinnen. Kultur und Gesellschaft hält sie für zu trennende Subjekte, von denen Letzteres sie nicht beträfe. Auf den Kaukasuskrieg angesprochen, argumentiert sie, dass Russland für sie nicht Putin bedeute, sondern eine Vielzahl von Literaten, die sie bewundere.
Doch umso mehr sich die politische Lage zuspitzt, desto offensichtlicher wird, dass sie sich der Politik nicht entziehen kann. Den entscheidenden Wendepunkt bilden die gewaltsamen Ausschreitungen während des Euro-Maidans im Februar 2014. Statt des bisher überwiegenden Präteritums wird nun im Buch das Präsens verwendet, die Geschichte der Protagonistin in ein Davor und ein Danach eingeteilt. Nachdem die Hälfte der Bevölkerung bis 2014 Russisch gesprochen hat, legt Melikova dar, wie die Ukrainer und Ukrainerinnen ihre eigene Sprache verwenden, um sich von Russland abzugrenzen und die eigene Identität zu behaupten.
Aufmerksam berichtet Melikova vom Leben in der Ukraine und von der Sozialisation in einem Land, das weiterhin von der Sowjetunion und ihrem Zerfall geprägt ist. Der Großvater schmeißt kein Brot weg, seit er im Exil in Sibirien hungern musste. Der Vater singt der Tochter zum Einschlafen Lieder aus seiner Komsomolzen-Zeit vor und verliert seine Arbeitserlaubnis durch die Folgen der etablierten Korruption. Und der ukrainische Präsident Janukowytsch hinterlässt nach seiner Flucht eine Residenz mit goldener Toilettenschüssel.
Dennoch erscheint das studentische Leben in Kiew freiheitlich und westlich, mit Besuchen in Kneipen und langen Nachmittagen in Cafés. Bei einem Ausflug nach Prag fragt die Geliebte: "Warum sind die Tschechen in der EU, aber wir nicht? Was unterscheidet sie von uns?" Die EU erscheint als Sehnsuchtsort, dem man sich zugehörig fühlt und für den man sich bemühen will.
Melikova schafft ein feinfühliges Ensemble aus Gedichten, Tagebucheinträgen, journalistischen Artikeln, Briefen und der all das verbindenden Erzählung. Die Auseinandersetzung mit sich selbst verwischt die Grenze zwischen Realität und Traum, wird jedoch mitunter redundant. Zudem erklärt die Autorin jedes metaphorische Bild, als müsste sie sich vergewissern, dass auch ja alles verstanden wird. Überfrachtet mit Handlungssträngen ist der Roman dennoch nicht. Im Gegenteil: Genau das ist die Stärke des Buchs. Diese Coming-of-Age-Erzählung wächst über eine konventionelle Liebesgeschichte hinaus und umfasst die Komplexität eines Lebens, das sich den politischen Geschehnissen nicht entziehen kann - so sehr die Protagonistin es auch lange Zeit probiert haben mag. GRETA ZIEGER
Anna Melikova: "Ich ertrinke in einem fliehenden See". Roman.
Aus dem Russischen von Christine Pöhlmann. Matthes & Seitz, Berlin 2024. 477 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.