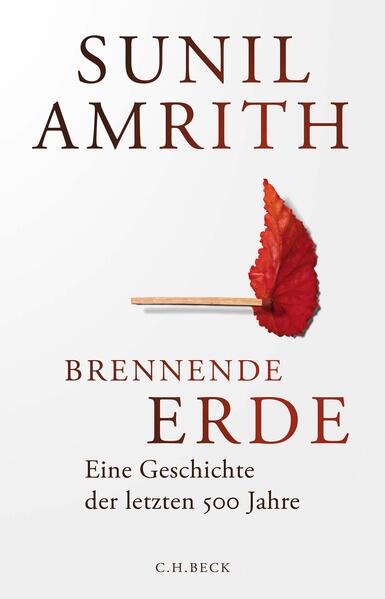
Zustellung: Sa, 21.06. - Di, 24.06.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Wie der Planet die Menschen geformt hat und die Menschen den Planeten - eine bahnbrechende neue Globalgeschichte der Erde
In diesem außergewöhnlichen Buch fügt der junge Historiker Sunil Amrith die Geschichten der Umwelt und der Imperien, der Genozide und der Ökozide, der Expansion menschlicher Freiheit und ihrer planetarischen Kosten zusammen. Ergreift auf eine Vielzahl von Quellen zurück und blickt auf die Hinterlassenschaft des portugiesischen Silberbergbaus in Peru ebenso wie auf die britische Jagd nach Gold in Südafrika oder die Ölextraktion in Zentralasien. Er erkundet Seewege, Schienen und Autobahnen, die Menschen an neue Orte gebracht haben, wo sie einander bekämpften oder sich die widerständige Natur unterwarfen. Sein Buch zeigt, dass wir einen anderen Blick auf unsere Geschichte gewinnen müssen, wenn wir die Weisheit erlangen wollen, die Erde zu retten.
Die erdumspannende Jagd nach Profit, kombiniert mit neuen Formen der Energie und neuen Möglichkeiten, Hunger und Mangel zu überwinden, hat ebenso wie die Freiheit, sich überall zu bewegen und die Welt zu erkunden, jeden Quadratzentimeter auf diesem Planeten verändert. Sunil Amrith verknüpft in eleganten Sprache und auf großer historischer Leinwand diese Entwicklungen zu einer großen Erzählung, die unsere Sicht verändert - vibrierend von Geschichten, Charakteren und einprägsamen Bildern. "Brennende Erde" macht uns bewusst, wie sehr das Ringen um Freiheit und Fortschritt mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Hand in Hand ging. Aber das Buch zeigt auch, wie allmählich ein neues Denken eingesetzt hat, gegen zahlreiche massive Widerstände.
In diesem außergewöhnlichen Buch fügt der junge Historiker Sunil Amrith die Geschichten der Umwelt und der Imperien, der Genozide und der Ökozide, der Expansion menschlicher Freiheit und ihrer planetarischen Kosten zusammen. Ergreift auf eine Vielzahl von Quellen zurück und blickt auf die Hinterlassenschaft des portugiesischen Silberbergbaus in Peru ebenso wie auf die britische Jagd nach Gold in Südafrika oder die Ölextraktion in Zentralasien. Er erkundet Seewege, Schienen und Autobahnen, die Menschen an neue Orte gebracht haben, wo sie einander bekämpften oder sich die widerständige Natur unterwarfen. Sein Buch zeigt, dass wir einen anderen Blick auf unsere Geschichte gewinnen müssen, wenn wir die Weisheit erlangen wollen, die Erde zu retten.
Die erdumspannende Jagd nach Profit, kombiniert mit neuen Formen der Energie und neuen Möglichkeiten, Hunger und Mangel zu überwinden, hat ebenso wie die Freiheit, sich überall zu bewegen und die Welt zu erkunden, jeden Quadratzentimeter auf diesem Planeten verändert. Sunil Amrith verknüpft in eleganten Sprache und auf großer historischer Leinwand diese Entwicklungen zu einer großen Erzählung, die unsere Sicht verändert - vibrierend von Geschichten, Charakteren und einprägsamen Bildern. "Brennende Erde" macht uns bewusst, wie sehr das Ringen um Freiheit und Fortschritt mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Hand in Hand ging. Aber das Buch zeigt auch, wie allmählich ein neues Denken eingesetzt hat, gegen zahlreiche massive Widerstände.
- "So schön wie überfällig, so atemberaubend wie niederschmetternd. 'Brennende Erde' wird Sie entflammen." Jill Lepore
- Sunil Amriths brillante Globalgeschichte unserer Abkehr von der Natur
- Beleuchtet die großen Linien der Umweltgeschichte von der frühen Neuzeit bis heute
- Zerstörung der Umwelt ist ein planetarischer Vorgang: lokale Ereignisse verändern den ganzen Planeten
- Wir haben nur eine Chance, wenn wir unsere Lebensweise ändern
- Wir müssen die Natur wieder als Partner begreifen, nicht als Untertan
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Fluchtträ ume
Einleitung: Natur und Freiheit
TEIL I: KEIME DER VERÄ NDERUNG (1200-1800)
1 Horizonte der Begierde
2 Winde des Todes
3 Land und Freiheit
4 Vororte der Hö lle
TEIL II: DIE KETTEN SPRENGEN (1800-1945)
5 Revolutionen in Leben und Tod
6 Unmö gliche Stä dte
7 Alpträ ume aus Stickstoff
8 Krieg gegen die Erde
TEIL III: DIE MENSCHLICHE AUSNAHME (1945-2025)
9 Freiheitsversprechen
10 Die menschliche Bedingtheit
11 Brennende Wä lder
12 Kipppunkte
13 400 Teile pro Million . . .
ANHANG
Epilog: Wege zur Wiederherstellung
Dank
Anmerkungen
Bildnachweise
Register
Einleitung: Natur und Freiheit
TEIL I: KEIME DER VERÄ NDERUNG (1200-1800)
1 Horizonte der Begierde
2 Winde des Todes
3 Land und Freiheit
4 Vororte der Hö lle
TEIL II: DIE KETTEN SPRENGEN (1800-1945)
5 Revolutionen in Leben und Tod
6 Unmö gliche Stä dte
7 Alpträ ume aus Stickstoff
8 Krieg gegen die Erde
TEIL III: DIE MENSCHLICHE AUSNAHME (1945-2025)
9 Freiheitsversprechen
10 Die menschliche Bedingtheit
11 Brennende Wä lder
12 Kipppunkte
13 400 Teile pro Million . . .
ANHANG
Epilog: Wege zur Wiederherstellung
Dank
Anmerkungen
Bildnachweise
Register
Produktdetails
Erscheinungsdatum
14. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
505
Autor/Autorin
Sunil Amrith
Übersetzung
Annabel Zettel
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 38 Abbildungen und 10 Karten
Gewicht
701 g
Größe (L/B/H)
217/153/45 mm
ISBN
9783406829277
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Eine faszinierende Umweltgeschichte voller neuer Perspektiven ein wichtiges Buch.
Deutschlandfunk Andruck, Dagmar Röhrlich
Seine Beweisführung unternimmt Sunil Amrith mit der zugleich schwindelig machenden und präzisen Dramaturgie einer Achterbahnfahrt. Man weiß nie, wann die nächste Kurve kommt und wie rasant es gleich wird, steigt am Ende aber leicht erschöpft und beglückt aus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Petra Ahne
Sehr gelungenes Buch
Perlentaucher, Das Kulturmagazin
Ein kluges, vielschichtiges und erzählerisch starkes Buch.
Vatican News, Mario Galgano
Eine beeindruckende Reise durch die letzten 500 Jahre Menschheits- und Fortschrittsgeschichte.
spektrum. de, Robin Gerst
Sehr erhellend und konstruktiv.
Hamburger Morgenpost, Buchtipp
Deutschlandfunk Andruck, Dagmar Röhrlich
Seine Beweisführung unternimmt Sunil Amrith mit der zugleich schwindelig machenden und präzisen Dramaturgie einer Achterbahnfahrt. Man weiß nie, wann die nächste Kurve kommt und wie rasant es gleich wird, steigt am Ende aber leicht erschöpft und beglückt aus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Petra Ahne
Sehr gelungenes Buch
Perlentaucher, Das Kulturmagazin
Ein kluges, vielschichtiges und erzählerisch starkes Buch.
Vatican News, Mario Galgano
Eine beeindruckende Reise durch die letzten 500 Jahre Menschheits- und Fortschrittsgeschichte.
spektrum. de, Robin Gerst
Sehr erhellend und konstruktiv.
Hamburger Morgenpost, Buchtipp
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Der Berg neigt sein Haupt
Die Illusion, Natur überwinden zu können: Sunil Amrith schildert die doppelte Ausbeutung von Mensch und Umwelt.
Von Petra Ahne
Von Petra Ahne
Die US-Umweltbehörde EPA gehört zu den Institutionen, die sich unter Präsident Trump gerade bis zur Unkenntlichkeit verändern. Der schon in Trumps erster Amtszeit betriebene Wandel von einer Naturschutz- zur Naturverschmutzungsbehörde ist dabei, sich zu vollenden. Noch aber kann man auf der Internetseite der EPA Spuren eines in seinem Fleiß geradezu rührenden Projekts entdecken: Kurz nach ihrer Gründung Anfang der Siebzigerjahre beauftragte die Behörde Fotografen, Umweltzerstörung in den USA und den Kampf dagegen zu dokumentieren. Nach ein paar Jahren hatte man über achtzigtausend Bilder gesammelt. Eine kleine Auswahl ist auf der Internetseite zu sehen: ein vielspuriger, von Autos verstopfter Freeway in Hollywood, ein Flugzeug, das Traubenplantagen großzügig mit Schwefel besprüht, ein Fluss, in dem tote Fische treiben, Smogwolken über Los Angeles.
Der Hinweis auf das Archiv findet sich in Sunil Amriths "Brennende Erde", das so gut ist, dass man beim Lesen nur langsam vorankommt. Man möchte zu den ganzen Episoden und Beispielen, die er anführt, nämlich sofort das Internet befragen und mehr wissen: über den um 1850 erschienenen Naturführer zu "Blumen, die in Londoner Gärten und verrauchten Städten gedeihen", aus dem ein britisch-pragmatischer Umgang mit den Nebeneffekten der Industrialisierung in England spricht. Über die "Villa Petrolea", eine von den Ölmagnaten-Brüdern Nobel gegründete Arbeitersiedlung in Baku, wo das Öl Ende des neunzehnten Jahrhunderts nur so sprudelte - und ja, einen Teil des Verdienstes steckte Bruder Alfred in den von ihm gestifteten berühmten Preis. Über das Wortgefecht von US-Vizepräsident Richard Nixon und Nikita Chruschtschow vor einer Musterküche, bei dem der sowjetische Staats- und Parteichef eine amerikanische Überlegenheit im Bereich Konsumgüter nicht einräumen wollte.
Sunil Amriths Buch ist gespickt mit originellen Nahaufnahmen, doch seine eigentliche Perspektive ist die Totale: eine Industrialisierungs-, Globalisierungs-, Kriegs-, Weltgeschichte der vergangenen fünfhundert Jahre, erzählt als Ergebnis eines Glaubens an die unbegrenzte Indienstnahme, an die Überwindung der Natur - und damit einer Illusion. Von Analysen wie Philipp Bloms "Die Unterwerfung" unterscheidet sich "Brennende Erde" durch die Abwesenheit jeder Eurozentrik und den doppelten Fokus auf die ökologischen und menschlichen Kosten des Fortschrittsprojekts. Dass das Versprechen auf immer bessere Lebensumstände durch Naturbeherrschung jeweils nur für den privilegierteren Teil der Weltbevölkerung galt, belegt Amrith minutiös. Er zeigt aber auch, dass es quer durch Länder und Systeme gegeben wurde, ohne seine ökologischen Voraussetzungen zu bedenken. Im Abstand weniger Jahrzehnte wurde etwa in den USA auf Grasland Weizen angebaut, bis die ausgelaugte Erde sich in Staubwolken über das Land legte, überfluteten im postkolonialen Indien Stauseen 1,5 Millionen Hektar Wald und dozierte Mao Zedong im kommunistischen China: "Wenn wir den hohen Berg bitten, sein Haupt zu neigen, dann muss er das tun."
Der in Yale lehrende Historiker Amrith weitet mit dem Buch sein Forschungsfeld, das sich zuvor auf Asien konzentrierte. Er beschreibt das Projekt als Konsequenz einer persönlichen Lernkurve. Aufgewachsen in Singapur, das auf der Überzeugung gebaut ist, dass sich die Umwelt ganz nach Bedarf formen lässt, und dessen Landfläche in den letzten Jahrzehnten um fünfundzwanzig Prozent vergrößert wurde, sei für ihn die Trennung von Natur und der eigenen Lebenswelt lange fraglos gewesen. Nach und nach wurde ihm klar, dass sich Gerechtigkeit und Freiheit, zwei Menschheitsthemen, die Amrith bewogen, Historiker zu werden, nicht von der planetaren Krise trennen lassen.
Seine Beweisführung unternimmt er mit der zugleich schwindelig machenden und präzisen Dramaturgie einer Achterbahnfahrt. Man weiß nie, wann die nächste Kurve kommt und wie rasant es gleich wird, steigt am Ende aber leicht erschöpft und beglückt aus. Eines der originellsten Kapitel führt die Perspektiven von Hannah Arendt, Indira Ghandi und Rachel Carson zusammen. Zwischen 1906 und 1917 geboren, waren sich alle drei der Folgen der inzwischen "Große Beschleunigung" genannten Vervielfachung von Produktionsleistung, Welthandel, Konsum, Naturzerstörung bewusst. Arendt, die Philosophin, erfüllte die nach immer Neuem verlangende Konsumkultur mit Unbehagen. Carson, die schreibende Meeresbiologin und Kämpferin gegen chemische Pestizide, insistierte, dass nur der nicht begangene Weg, "the road not taken", den Planeten retten würde. Die Einzige der drei mit politischer Gestaltungsmacht, die sich des Verlustes von Natur sehr bewusste indische Premierministerin Indira Ghandi, die bei der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 1972 eine viel beachtete Rede geschrieben hatte, nutzte diese Macht allerdings nicht gut und glitt mit während eines Ausnahmezustands durchgesetzten Maßnahmen ins Autoritäre ab.
Da ist man schon im letzten Viertel des Buchs und auf direktem Weg ins Heute, in dem sich der Mensch der Folgen seines Tuns längst bewusst ist, zugleich Regenwälder weiter brennen, Emissionen steigen und sich die in den Achtzigerjahren lancierte Erzählung der Öllobby, Klimaschutz sei leider ganz schlecht für die Wirtschaft, als haltbar erweist.
Man kann nur froh sein, dass sich der Quantensprung in der Energieerzeugung, die Verbrennung von Materie, die vor Millionen Jahren mal lebendig war, erst vor gut zweihundert Jahren ereignete. Nicht auszudenken, in welchem Zustand der Planet sonst jetzt wäre. Am Willen, begehrter Rohstoffe habhaft zu werden, welchen menschlichen Preis dies auch haben mochte, mangelte es nicht. Die Gier nach Gold und der messianische Eifer, die die iberische Eroberung der Amerikas anleiteten, dezimierten die dortige Bevölkerung ab 1492 um neunzig Prozent, die Menschen starben durch Gewalt, Hunger, eingeschleppte Infektionskrankheiten. Die Silberminen in den Anden, in die versklavte Afrikaner geschickt wurden, beschrieb ein spanischer Ordensbruder im Jahr 1600 als "Abbild der Hölle".
Und jetzt? Schade ist, dass das so substanzielle Buch da eher dünn wird, wo es um den Weg aus der Krise geht. Hoffnungsvolle Signale sind für Sunil Amrith ein erfolgreiches Computerspiel, das zu ökologischem Bewusstsein animiert und eine Gruppe von Fans koreanischer Popmusik, die Unternehmen zu klimaneutralem Handeln drängen. Gesellschaftlicher Wandel braucht viele einzelne Katalysatoren. Sunil Amriths Erzähltalent hätte man jedoch eine kraftvollere Vision zugetraut, wie sich Mensch und Natur wieder annähern können. Denn die braucht es jetzt.
Sunil Amrith: "Brennende Erde". Eine Geschichte der letzten 500 Jahre.
Aus dem Englischen von Annabel Zettel. C. H. Beck Verlag,
München 2025.
505 S., Abb., geb., 34 ,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 06.04.2025
Krieg gegen die Erde und Krieg gegen die Menschen
Wir hier in Mitteleuropa haben einen hohen Lebensstandard. Aber wie sind wir dazu gekommen, welche Opfer wurden dafür erbracht, welche Kriege geführt und können wir uns die jetzige Lebensweise weiterhin leisten?
Auf 500 Seiten führt uns Sunil Amrith durch die Geschichte der Erde und der Menschen in den letzten Jahrhunderten.
Wir müssen die Grausamkeiten erleben, wie Kriege gegen die Erde auch Kriege gegen die Menschen wurden, und umgekehrt.
Aber wir erleben auch Episoden, in denen der Mensch im Einklang mit der Natur seine Ressourcen vermehrt hat.
Dieses Buch ist eine Stunde in Geschichte und Lebenswissenschaften. Der Inhalt geht weit über das Schulwissen hinaus. Der Autor versteht es Fakten nicht nur darzulegen, sondern bringt uns uns auch dazu, uns emotional damit auseinanderzusetzen.
Lediglich die Meere wirken für mich in ihrer Rolle für Mensch und Erde etwas unterrepräsentiert, da wünsche ich mir für die nächste Ausgabe noch mehr...
Am Ende lässt mich das Buch tief bewegt zurück, mit Dankbarkeit für das, was wir haben und mit dem Wunsch, das Erbe unserer Erde für die künftigen Generationen zu bewahren.









