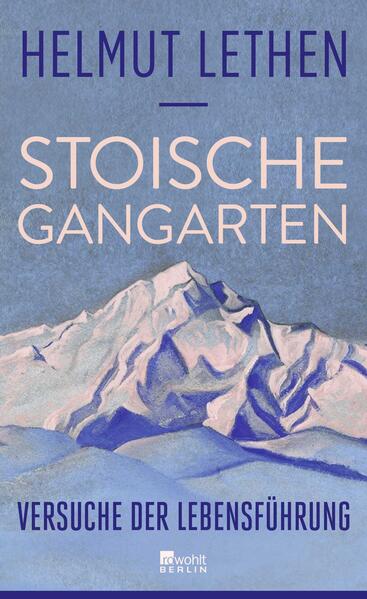Besprechung vom 13.08.2025
Besprechung vom 13.08.2025
So übt euch denn in Kontemplation
Abschied vom Habitus der Kälte, mit dessen Untersuchung er in den Neunzigerjahren den Zeitgeist getroffen hatte: Helmut Lethen widmet sich entlang seiner Lieblingsautoren verbliebenen Möglichkeiten stoisch gelassener Lebensführung.
Der August ist schon wieder furchtbar heiß, die Weltlage ohnehin brenzlig, nun scheint auch noch der begnadete Kältetechniker der Kulturwissenschaften, Helmut Lethen, seinen Glauben an die befreiende Macht der Coolness verloren zu haben. Diesen Eindruck erhält man bei der Lektüre von "Stoische Gangarten", Lethens neuem Buch. Darin wird schon auf den ersten Seiten der "Abschied von den Verhaltenslehren" proklamiert.
Gemeint ist die 1994 erschiene Schrift "Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen", in der Lethen, der damals in Utrecht lehrte, ein mentales Ordnungsschema entdeckte, dass in den 1920er- und 1930er-Jahren bei Intellektuellen quer durch die ideologischen Lager wirksam war. Aus den Texten politisch so unterschiedlich temperierter Autoren wie Ernst Jünger, Helmuth Plessner, Carl Schmitt, Walter Serner und Bertolt Brecht sprach für Lethen ein und derselbe Typus, die neusachliche "kalte persona", ganz auf Affektkontrolle und Anti-Innerlichkeit geeicht.
Der Band wurde bald zum kultisch rezipierten Klassiker. Das lag nicht zuletzt daran, dass Lethen bei seiner Untersuchung des Weimarer Kältehabitus zum unmissverständlichen Angriff auf die Authentizitätsduselei und den emotionalen Exhibitionismus der bundesdeutschen Gegenwart ausholte. Und genau damit traf er Mitte der Neunzigerjahre den Zeitgeist. Denn die Ära der Kommunen und der K-Gruppen, denen einst auch Lethen angehörte, war längst vorbei. Statt nach Alles-Private-ist-politisch-Exzessen sehnte man sich nach postmoderner Abgeklärtheit.
In seinem neuen Buch bezeichnet Lethen die "Verhaltenslehren" rückblickend als "Taschen-Machiavelli für den Hausgebrauch", als ein Kompendium für jene, die damals einen Ausweg aus "auferlegten, erzwungenen oder verletzenden Nahverhältnissen" suchten. Doch gerade diese lebenspraktische Dimension soll den "Stoischen Gangarten" nun ausdrücklich abgehen. Denn die Zuversicht, im "Freiheitsraum der Kälte" könnten sich Möglichkeiten einer souveränen Lebensführung auftun, hat den 86-jährigen Lethen verlassen. Verantwortlich für diese Verzagtheit ist eine Mischung aus Gesundheitsmalaisen, Todesfällen im Freundeskreis und Ohnmachtsgefühlen angesichts der geopolitischen Krisensituation. Vom modernisierten stoischen Ideal der Lebenskunst, das in den "Verhaltenslehren" vorgestellt worden war, bleibt heute nur die depressive Schrumpfform übrig: Der Hinweis, sich nicht durch Emotionen aus der Fassung bringen zu lassen und sich angesichts des Unverfügbarkeit des Schicksals in Kontemplation zu üben.
So resigniert-banal das zunächst anmutet, so unverzagt, regelrecht beschwingt vertieft sich Lethen in die Werke der Autoren, die ihn seit Jahrzehnten begleiten. Hinzu kommen Versatzstücke seiner eigenen Biographie, Betrachtungen zur Fotografie und Gedanken zum Zeitgeschehen. Alles verbindet sich zu einem anregend mäandernden Strom aus Beobachtungen, Zitaten und hermeneutischen Exerzitien. Einmal mehr geht es Lethen darum, seine Lieblingsdenkfiguren zu erproben, allen voran die Frage nach "Bewegungs-Suggestion" in Texten. Darunter fallen die seinsphilosophisch camouflierten Ausweichmanöver Gottfried Benns, der seine zeitweilige Komplizenschaft mit den Nazis unter Berufung auf übermächtig-dunkel wirkende Prozesse schönredete, ebenso wie die barocken Distanzwahrungsmaximen im "Handorakel" Baltasar Graciáns.
Zu Lethens offenkundigen Leib- und Magenzitaten zählt ein Satz aus Büchners Revolutionsdrama "Dantons Tod", der zum Leitmotiv des schmalen Bandes erhoben wird: "Geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden". Dem Gedanken, dass der Weg von einer Phrase zu ihrer Verkörperung, die Transformation einer Idee in eine bisweilen blutige Tat erstaunlich kurz und dabei unendlich komplex sein können, geht der Autor mit assoziationsfreudiger, schier unerschöpflicher Begeisterung nach und verlangt dem Leser dabei eine Extraportion an neostoischer Geduld ab.
Zu Bestform läuft Lethen auf, sobald sich ein Thema eher beiläufig in seine Ausführungen schleicht. Einige Absätze lang macht er sich mit Nietzsche und Schopenhauer Gedanken zum illusorischen Charakter der Liebe und widerspricht dabei der landläufigen Idealvorstellung, das frühe dopamingesteuerte Verliebtheitsstadium gehe mit der rückhaltlosen wechselseitigen Offenbarung zweier Individuen einher. Folgt man Lethen, ist das Gegenteil der Fall: Der anfängliche Liebestaumel wird deshalb als beglückend empfunden, weil man alles daransetzt, dem anderen eine Verbundenheit und "Gleichheit vorzuspielen, die es in Wahrheit nicht gibt" (Nietzsche), und sich somit endlich eine Verschnaufpause von den leidigen Authentizitätsansprüchen gewährt, die Menschen einander im nicht-romantischen Alltag zumuten.
Nachdem Lethen ein Kapitel lang seiner althergebrachten, ambivalenten Faszination für Ernst Jünger als Schriftsteller-Soldaten im "Ganzkörperstahlhelm" nachgegangen ist, meditiert er auf den letzten Seiten über einen Satz Peter Sloterdijks: "Vielleicht ist das Leben des Intellektuellen die Kulturform der Wehrlosigkeit". Dem schließt sich der Befund an, dass die deutsche Mentalität nach dem Zweiten Weltkrieg von "strukturellem Pazifismus" (Sönke Neitzel) geprägt wurde. Nur wie soll jetzt die Zeitenwende-Forderungen nach Wehrhaftigkeit eingelöst werden, fragt Lethen ins Blaue hinein.
Anschließend wird es konfus. Lethen bekennt sich zu der historischen Notwendigkeit des strukturellen Pazifismus, und er bekennt sich zum neuen Postulat der Militarisierung, ferner bekennt er sich zum Lähmungsgefühl, das durch Doppelbekenntnisse dieser Art hervorgerufen werden. Letztlich liefert Lethen hier eine erschütternd unmittelbare, völlig schutzlose Demonstration der Ratlosigkeit, die ihn befällt, nachdem er das Vorhaben, sich seine "Verhaltenslehren der Kälte" vom Leib zu schreiben, umgesetzt hat. Ein Kandidat, der die dadurch entstandene Leerstelle füllen könnte, ist nicht in Sicht. Das zu ertragen, erfordert ein beträchtliches Maß an sogenannter stoischer Gelassenheit und eine Kälteunempfindlichkeit gegen sich selbst, die nicht jedem gegeben ist. MARIANNA LIEDER
Helmut Lethen: "Stoische Gangarten". Versuche der Lebensführung.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2025.
224 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.