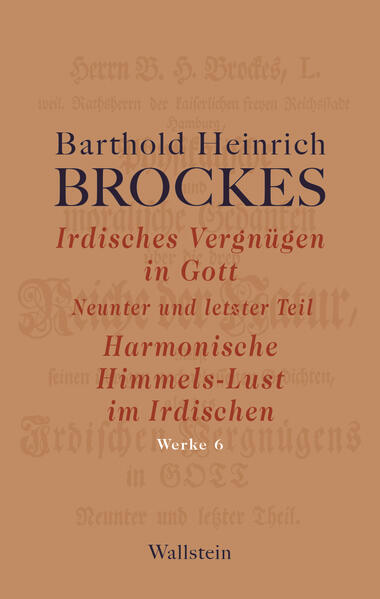
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
(Alexander Košenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 07. 2025)
»Wer sich einmal auf diesen Reichtum einlässt, sich in die farb- und lichtdurchtränkten Gedichte auf Rosen, Käfer & Co. vertieft, wird Brockes seinem Lektürekanon einverleiben. «
(Rainer Moritz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. 07. 2025)
 Besprechung vom 26.07.2025
Besprechung vom 26.07.2025
Wer Gott lobt, lobt auch den Tokajer
Die Neuausgabe von Barthold Heinrich Brockes' "Irdisches Vergnügen in Gott" ist abgeschlossen
Editionsgeschichten sind nicht selten Leidensgeschichten. Wer die Kärrnerarbeit auf sich nimmt, opulente literarische Werke neu herauszugeben, läuft nicht selten Gefahr, sich in Manuskriptbergen, Kommentierungsdetails oder Finanzierungsfragen heillos zu verstricken und nie an ein Ende zu gelangen. Umso erfreulicher, dass der Wallstein Verlag nun vermelden darf, seine sechsbändige, durch die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur unterstützte Edition von Barthold Heinrich Brockes' "Irdisches Vergnügen in Gott" abgeschlossen zu haben. 2012 hatte Herausgeber Jürgen Rathje den ersten Band dieses singulären Werkes vorgelegt und damit die Einladung ausgesprochen, den ungemein vielseitigen, polyglotten Hamburger Juristen, Politiker, Übersetzer und Dichter Brockes (1680 bis 1747) wiederzuentdecken.
Neun Teile umfasst das "Irdische Vergnügen in Gott". Der erste erschien 1721, der letzte ein Jahr nach Brockes' Tod, herausgegeben vom Hauslehrer seiner Kinder, Barthold Joachim Zinck, der nicht davor zurückschreckte, Kürzungen vorzunehmen, wenn ihm Brockes' detailversessene Lyrik ein wenig zu ausführlich geraten schien. Überhaupt stellt dieser Schlussband in gewisser Weise einen Etikettenschwindel dar, denn zu den Gedichten des "Irdischen Vergnügens" kommen nur wenige unbekannte aus dem Nachlass hinzu. Gewichtiger sind die unter dem Titel "Harmonische Himmels-Lust im Irdischen" zusammengefassten Überarbeitungen und Kürzungen, die Brockes vornahm für seine vielfach - unter anderem von Händel und Telemann - vertonten "musicalischen Gedichte und Cantaten".
Vor allem aber besteht der Band aus Versifikationen naturwissenschaftlicher und philosophischer Werke anderer. Den Anfang machen die Fragment gebliebenen "Betrachtungen über die drey Reiche der Natur", die auf der Studie "Physica, oder Natur-Wissenschaft" (1701) des Zürcher Naturforschers Johann Jakob Scheuchzer fußen und Brockes die Möglichkeit geben, sich in aller Ausführlichkeit den Metallen, Pflanzen und Tieren zu widmen. Daneben findet sich, abgesehen von einer Sammlung von Epigrammen, mit dem zuerst 1747 erschienenen "Anhang einer Anleitung zum vergnügten und gelassenen Sterben" eine weitere versifizierte Adaption, der die Abhandlung "Ars semper gaudendi" des flämischen Mathematikers Alphonse Antonio de Sarasa zugrunde liegt.
Ob Brockes eigene Gedichte niederschreibt oder Gedanken und Beobachtungen anderer zu Versen umformt - immer zeigt sich ein Geist, der zwar mit zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Forschungen, den Kunstgriffen der Rhetorik und der antiken Dichtung gleichermaßen vertraut ist und doch immer wieder Originelles und Eigenständiges formuliert, das sich von seinen Vorgängern des Barockzeitalters deutlich absetzt. Auch da, wo Brockes adaptiert, folgt er der Maßgabe, die er in einem Epigramm so formuliert: "Die Poesie ist eine Kunst, das Wesen der Natur zu schildern." Brockes, der bei Spaziergängen stets ein Vergrößerungsglas zur Hand hatte, besitzt ein Auge für die abseitigsten und unscheinbarsten Naturphänomene. Die minutiöse Beschreibung von Kupfer, Bernstein, Bohnen, Leoparden oder Kamelen verfolgt eine Absicht, die Brockes nicht müde wird in ständig neuen Wendungen zu wiederholen: "Gottes Ehre soll allein / Meiner Lieder Endzweck seyn."
Dieses Programm zieht Brockes durch. Was immer er auffindet und für beachtenswert hält, wird als Gelegenheit genutzt, Gott zu rühmen und den Nutzen der Schöpfung für den Menschen herauszustellen. Brockes wird so zum Virtuosen des Lobpreises, der überall erkennt, was er erkennen möchte: "Wir bewundern, Gott zum Preise, / Am Magneten dreyerley: / Daß er uns die Angel zeiget, / Daß er Ost- und Westwerts neiget, / Daß er Eisen an sich zieht, / Sind wir zu besehn bemüht."
Auch die Pflanzen- und Tierwelt wird danach befragt, was sie an Gutem für die Menschen bereithält. Die Quitte ist wegen ihrer heilenden Wirkung zu loben, das Rindvieh dafür, dass es zu allen Jahreszeiten nährt, und der Hund für seine unübertroffene Eigenschaft, Freundschaft und Treue zu schenken. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel, denn nicht für alle Tiere gilt diese Wertschätzung. Der Wolf zum Beispiel kommt schlecht weg: "Es scheint der Wolf sey mehr zur Strafe, als zum Vergnügen, auf der Welt; / Denn er ist nicht nur mördrisch, grausam, wild, tückisch, blutbegierig, gräßlich, / Und sonderlich fatal den Schafen, er ist dazu noch scheußlich häßlich."
Und wo man einmal rühmt und nach der Sinnhaftigkeit der Welt fragt, gibt es kein Halten mehr. In der Welt der Metalle steht das Gold obenan, weil es "in irdschen Dingen / Allen Mangel kann bezwingen", denn: "Was für Gutes auf der Welt / Wird gewirkt durch Gold und Geld." Die Kantate "Das Gewitter" wiederum hält wortreich die furchteinflößenden Effekte von Blitz und Donner fest - kein Grund freilich, am Grundsätzlichen zu zweifeln: "Es wird des Schöpfers Vater-Hand, / Im Ungewitter selbst, erkannt", und in einem weiteren, von David Christian Hövet vertonten Gedicht lässt es sich der sinnenfrohe Brockes nicht nehmen, zum Lobe alkoholischer Getränke anzusetzen: "Edler Tockayer! dein holdes Geträncke, / Heisset und bleibet ein himmlisch Geschencke." Fast müßig zu erwähnen, dass sich Brockes auch "ernsthafte Gedanken" über das "Tobackrauchen" gemacht hat.
Wo Brockes das Gotteslob hintanstellt und sich in alle Nuancen von Fauna und Flora vertieft, erweist er sich als Dichter von hoher Musikalität, der sich nicht mit oberflächlichen Betrachtungen abgibt. So findet er, um den Gesang der Nachtigall adäquat wiederzugeben, eine Vielzahl unterschiedlichster Verben, und den unermesslichen Variationen der Natur steht selbst ein Mann wie Brockes mitunter wehrlos gegenüber: Dann greift er zum Stilmittel der asyndetischen Aufzählung, die nur noch benennt, was im Einzelnen zu beschreiben eine Überforderung wäre. Gerade diese unverbundenen Substantivaneinanderreihungen gewinnen für heutige Leser eine überraschende Modernität.
Man hat Brockes, so sein Biograph Eckart Kleßmann, als "Vater der deutschen Naturlyrik" bezeichnet und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es ein Missverständnis wäre, ihm eine subjektive Sicht- und Dichtweise zu unterstellen, wie sie die nachfolgenden Generationen, wie sie Empfindsamkeit und Romantik etwa popularisierten. Durch die Natur zu schreiten und sie vor allem als Spiegelbild eigener Empfindungen und Gedanken zu begreifen, das ist nicht die Sache des Barthold Heinrich Brockes. Menschen kommen in seinem "Irdischen Vergnügen in Gott" ohnehin nicht sehr häufig vor.
Arno Schmidt, der in seinem Funkessay "Nichts ist mir zu klein" einst vehement für den "vergessenen Kollegen" Brockes warb, kümmerte sich nicht um literaturwissenschaftliche Epochenschubladen und nannte ihn einen "wirklichen Realisten", der die Augen aufgemacht habe und die Welt "vermittelst Beschreibung" zu bewältigen suchte. Diese Wahrnehmungslust Brockes' führt dazu, dass er, nicht zur uneingeschränkten Freude seiner dogmatischen Zeitgenossen, mit Sinnen- und Körperfeindlichkeit wenig anzufangen wusste. Dass "alle Lüste" zu meiden seien, lehnt der zwölffache Vater Brockes ab. Gottes Werk hat auch in dieser Hinsicht seinen Sinn: "Ich dachte bey mir selbst: das geht zu weit. / Da wir auf unsrer Welt aus Seel und Leib bestehen, / So muß ja die Beschaffenheit, / Wozu wir uns allhier durch Gott bereitet sehen, / Nicht sträflich, nicht verächtlich seyn."
So lohnt es sich, Barthold Heinrich Brockes von ganz unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Die nun abgeschlossene sechsbändige, von Jürgen Rathje behutsam kommentierte Werkausgabe bietet sich dafür an. Wer sich einmal auf diesen Reichtum einlässt, sich in die farb- und lichtdurchtränkten Gedichte auf Rosen, Käfer & Co. vertieft, wird Brockes seinem Lektürekanon einverleiben. Bleibt nur ein Wunsch: Da die von Hans-Georg Kemper besorgte, bei Reclam 1999 erschienene Auswahl seit Kurzem vergriffen ist, wäre es umso schöner, wenn es bald wieder ein handliches Best-of-Brockes-Bändchen gäbe. RAINER MORITZ
Barthold Heinrich Brockes: "Irdisches Vergnügen in Gott". Neunter und letzter Teil. Werke, Bd. 6.
Hrsg., kommentiert von Jürgen Rathje. Wallstein Verlag, Göttingen 2025. 864 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Irdisches Vergnügen in Gott" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.












