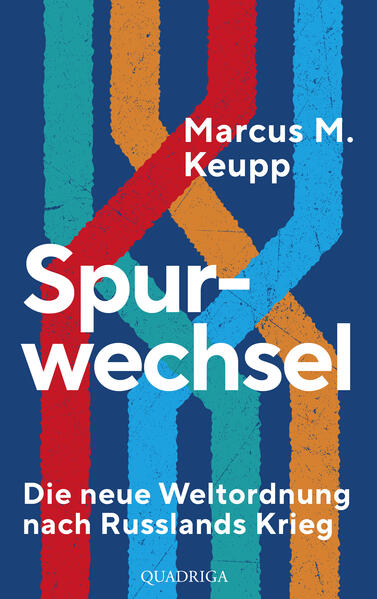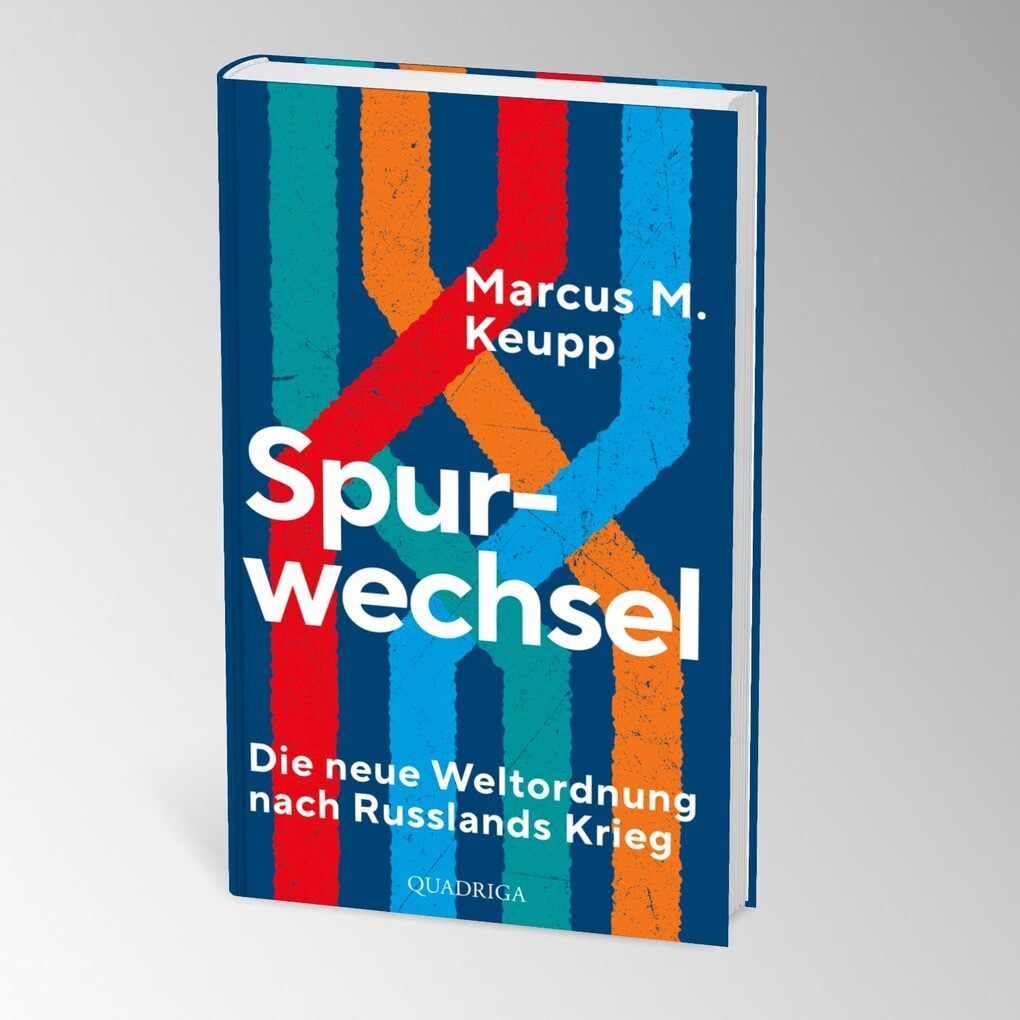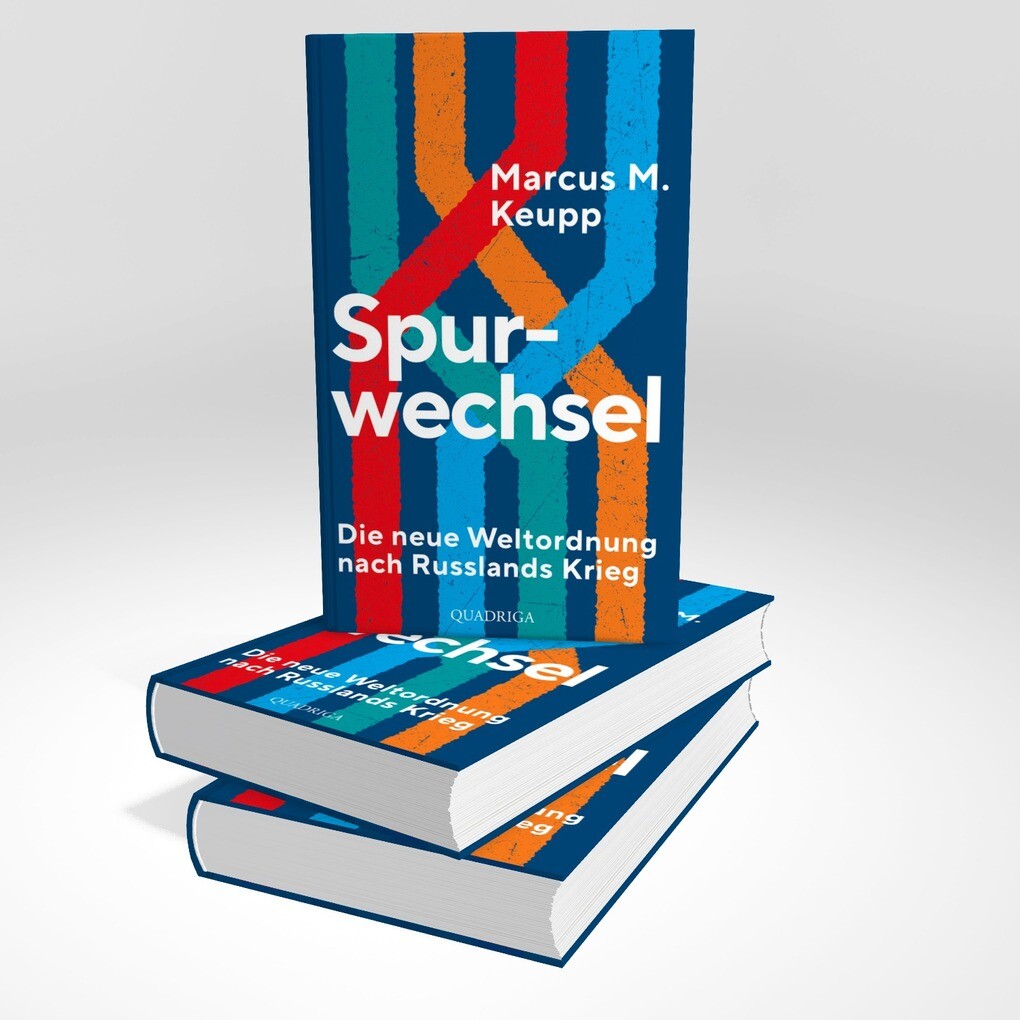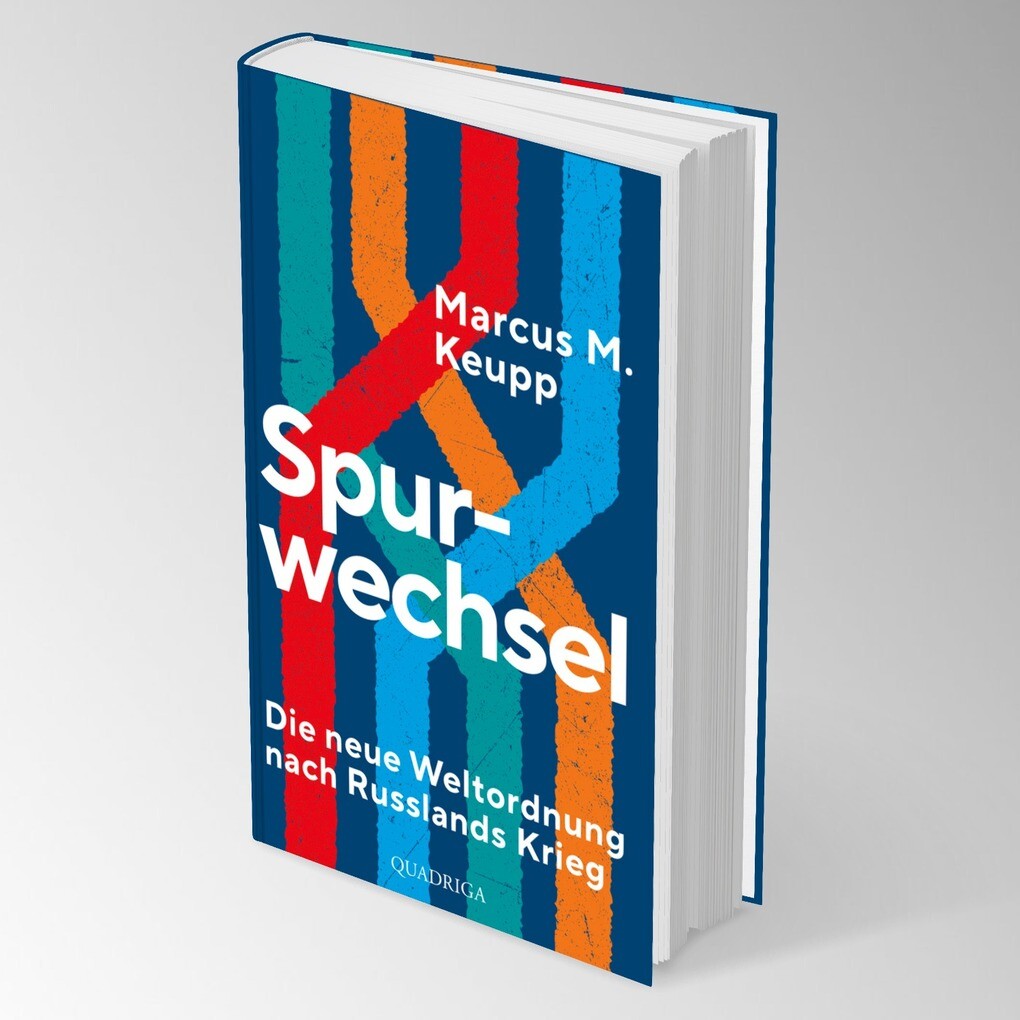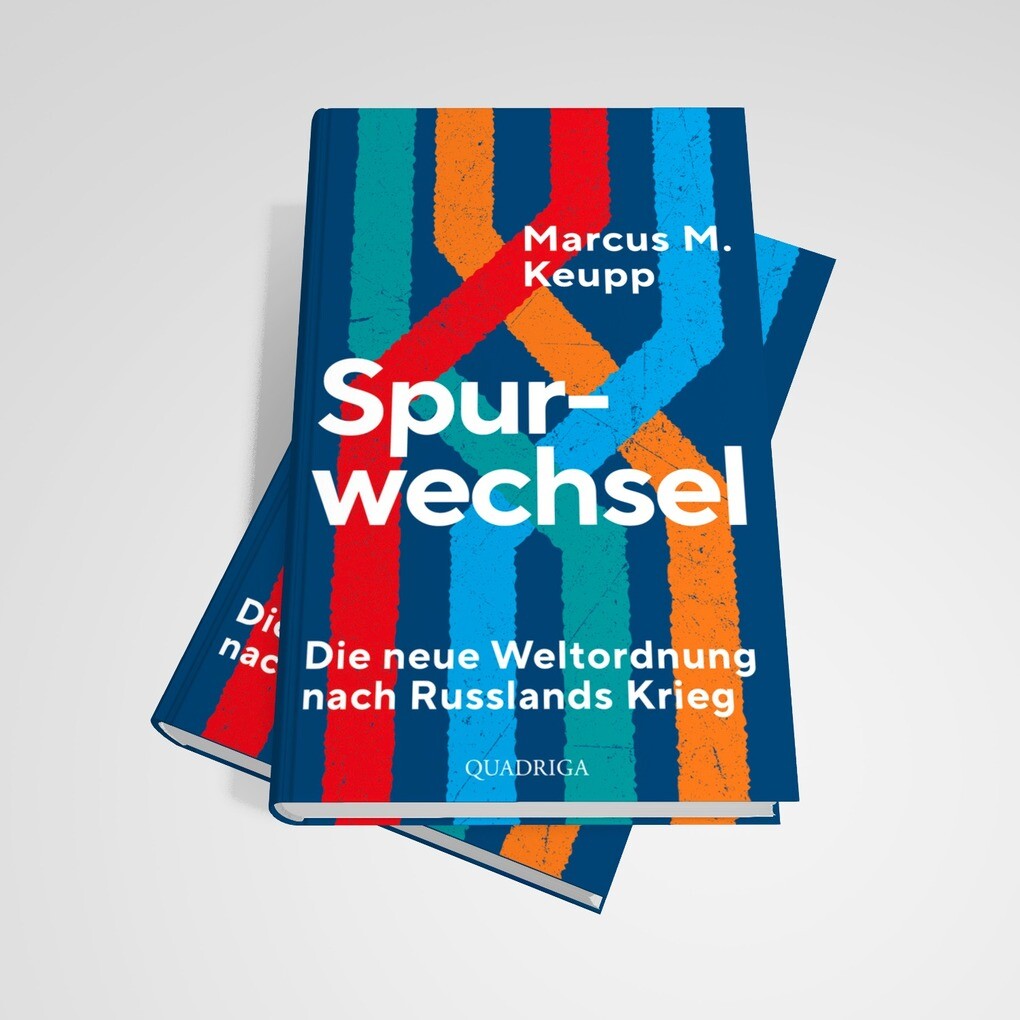Besprechung vom 29.07.2025
Besprechung vom 29.07.2025
Robuste Kalaschnikow-Ökonomie
Russlands Wirtschaft werde den Anschluss an den Weltmarkt verlieren, meint Marcus Keupp. Dem Regime Putins schade das jedoch nicht.
Ein weiteres Ultimatum. Eine weitere Frist. Donald Trump hat Wladimir Putin erneut Zeit eingeräumt. Dieses Mal forderte der amerikanische den russischen Präsidenten auf, den Krieg in der Ukraine innerhalb von fünfzig Tagen zu beenden, beginnend ab dem 14. Juli, sonst würden die Vereinigten Staaten sekundäre Zölle in Höhe von hundert Prozent gegen alle Länder einführen, die Geschäfte mit Russland machten. Ein parallel im amerikanischen Kongress vorbereiteter Gesetzesentwurf sieht Sanktionen in Form von Zöllen sogar in Höhe von fünfhundert Prozent gegen Staaten vor, die weiterhin russisches Öl kaufen. Zu ihnen zählen China, Indien und Brasilien, aber auch Mitglieder der Europäischen Union.
Und damit ist man mitten im Thema von Marcus M. Keupp. Der Leiter der Dozentur Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich beleuchtet nicht zuletzt die wirtschaftlichen Auswirkungen eines imperialen Krieges, den ein Land führt, das nach Keupps Beschreibung immer schon wie ein Imperium gedacht und gehandelt hat. Dieses Land ist in seinen Augen zwar mehr als nur eine riesige Tankstelle, die vorgebe, ein echtes Land zu sein, wie es John McCain 2014 und damit im Jahr von Russlands Besetzung der Krim und vom Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ostukraine formulierte. Aber Steuern und Abgaben auf Öl-, Gas-, Metall- und Mineralexporte bildeten nach wie vor das Rückgrat des Staatshaushalts, was auch Keupp die russische Volkswirtschaft als "im Kern eine Petrodollarökonomie" charakterisieren lässt.
Dabei wirkt Russland auf ihn heute wirtschaftlich stärker isoliert, als es die Sowjetunion je gewesen sei. Durch seine selbst gewählte Isolation nehme das Land nur noch unvollkommen am technologischen Austausch und der internationalen Forschung und Entwicklung teil.
Daraus zu schließen, die russische Wirtschaft werde durch die Kriegsfolgen zusammenbrechen, wie westliche Beobachter in den vergangenen Jahren immer wieder mutmaßten, ist nicht Keupps Ansatz. Im Gegenteil: Russlands technologischer Rückschritt wirke stabilisierend, genau wie auch der Rückzug in die Isolation. Die russische Volkswirtschaft wird sich nach seiner Vermutung auf einem niedrigeren technologischen Niveau neu konfigurieren, so wie sich auch die iranische Wirtschaft an das internationale Sanktionsregime angepasst habe. Es bilde sich eine "Kalaschnikow-Ökonomie: simpel, aber effektiv, schwerfällig, aber robust". Russland werde Güter und Dienstleistungen produzieren, die zwar nicht mehr wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt seien, aber die heimische Nachfrage befriedigen könnten. Infolgedessen wird sich Russland nach Keupps Prognose zwar zunehmend von der Weltwirtschaft entkoppeln, dadurch aber auch weniger anfällig für Konjunkturschwankungen sein - abgesehen vom Ölpreis.
Was folgt daraus politisch? Keupp glaubt nicht, dass die Kriegsökonomie, in die sich die russische Wirtschaft verwandelt hat, angehalten werden kann. Sie sei der einzige Wachstumstreiber, alle Wirtschaftspolitik auf sie zentriert. Selbst ein militärischer Rückschlag würde nach seiner Einschätzung daran nichts mehr ändern: Russland werde dann den Krieg pausieren oder abbrechen, sich konsolidieren und bei Gelegenheit erneut angreifen - insbesondere dort, wo Unterstützung aus dem Westen logistisch schwer zu organisieren sei und westliche Waffenlieferungen nur schwer hingelangten, etwa in den zentralasiatischen Ländern.
Nach dem Krieg ist für Keupp somit vor dem Krieg: Der geostrategische Raum möge sich verschieben, doch die imperialen Ambitionen Russlands blieben unverändert. Auch wenn nicht mehr gekämpft werde, der russisch-ukrainische Krieg in einem unklaren Zwischenzustand enden sollte - es werde produziert und aufgerüstet. Die Inflation steige, was in Russland aber erträglicher erscheine als eine Rezession.
In der russischen Innenpolitik sorgt der Krieg nach Keupps Wahrnehmung für eine dystopische Stabilisierung des Imperiums: Das Regime bestimme nun, was wahr sei, es kontrolliere die nationale Erinnerung genauso wie die politische Zukunft. Die imperialen Bruchstellen sind nach Keupps Beobachtung zwar nicht geheilt, aber kontrolliert und beruhigt - solange der Krieg andauere. Und das bedeute: Er dürfe niemals enden.
So dystopisch und teuer diese autoritäre Wende auch Keupp erscheint, sosehr sie den privaten Wohlstand in Russland vernichtet, so stabilisierend wirkt sie nach seiner Analyse auf die imperiale Mechanik. Wenn im Krieg akzeptiert sei, was im Frieden wirtschaftlich wie politisch zum unlösbaren Strukturproblem werde, wenn der Kriegszustand die innere Herrschaft besser und umfassender festige als jeder Frieden, dann werde er zum idealen Daseinszustand: "Krieg ist Frieden."
Keupp leitet daraus ab, womit man es bei Putins Russland auch in den kommenden Jahren zu tun haben dürfte: Das imperiale Denken zeige sich nun vollends unverstellt. Niemand sei mehr sicher, jeder Staat könne jederzeit untergehen, wenn das Imperium es so wolle. In dieser Logik negativen Unternehmertums ist es nach Keupps Schlussfolgerung nicht mehr nötig, gemeinsam etwas aufzubauen, Wettbewerbsvorteile zu entwickeln und internationalen Handel zu treiben - man könne auch einfach den Nachbarn unterwerfen und sich dessen Ressourcen aneignen. Das neue Geschäftsmodell laute: permanenter Krieg - auch, aber nicht nur gegen die westliche Welt. Ganz Eurasien steht nach Keupps Befürchtung wieder zur Disposition.
Wie kann, wie soll die Welt - nicht zuletzt die westliche - darauf reagieren? Keupp dekliniert durch, welche Hausaufgaben auf die Europäer warten: Europa fahre der Schrecken seiner Wehrlosigkeit heilsam in die Glieder. Es befreie sich von den Altlasten seiner Appeasement-Politik, die russische Interessen stets bevorzugt berücksichtigt und Russlands imperiale Expansion wesentlich begünstigt habe. Es investiere die Sondervermögen der Zeitenwende zielgerichtet und mache seine vernachlässigten Armeen wieder einsatzfähig.
Darüber hinaus entwirft Keupp ein globales Szenario: Je mehr Nordkorea Russland mit Truppen und Munition unterstütze, desto mehr werde Südkorea die Ukraine indirekt mit Artilleriemunition beliefern. Auch Pakistan, einer der größten Artillerieproduzenten Eurasiens, unterstütze die Ukraine bereits. Bei China zeigt sich Keupp sicher, dass es kein erstarktes Nordkorea an seiner Grenze werde tolerieren können, riskiere es damit doch ein Wiederaufflammen des nie beendeten Koreakriegs und damit eine amerikanische Truppenpräsenz direkt an seiner Grenze. Bei Südkorea und Japan erinnert er daran, dass sie zwar 2014 die Sanktionen gegen Russland nicht mitgetragen hätten, sich seit 2022 aber daran beteiligten. Japan habe seine pazifistische Politik aufgegeben und rüste auf, während Südkorea die Ukraine mit zivilen Hilfslieferungen unterstütze.
Keupp fasst diese globalen Allianzbildungen in der Formel zusammen, der russisch-ukrainische Krieg sei größer als sein Kampfraum. Weltanschauungen würden miteinander ringen. Wer sich hier behaupten will, muss nach seiner Überzeugung die Sprache der Stärke sprechen. Diese Auseinandersetzung werde lange dauern. Daher mahnt er, wer in dieser neuen Welt bestehen wolle, müsse sie nüchtern und illusionslos anschauen. Für Keupp gilt das insbesondere beim Blick nach Osten - ein Anspruch, den er selbst zweifelsfrei erfüllt. THOMAS SPECKMANN
Marcus M. Keupp: Spurwechsel. Die neue Weltordnung nach Russlands Krieg.
Quadriga Verlag, Köln 2025.
304 S., 25, - Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.