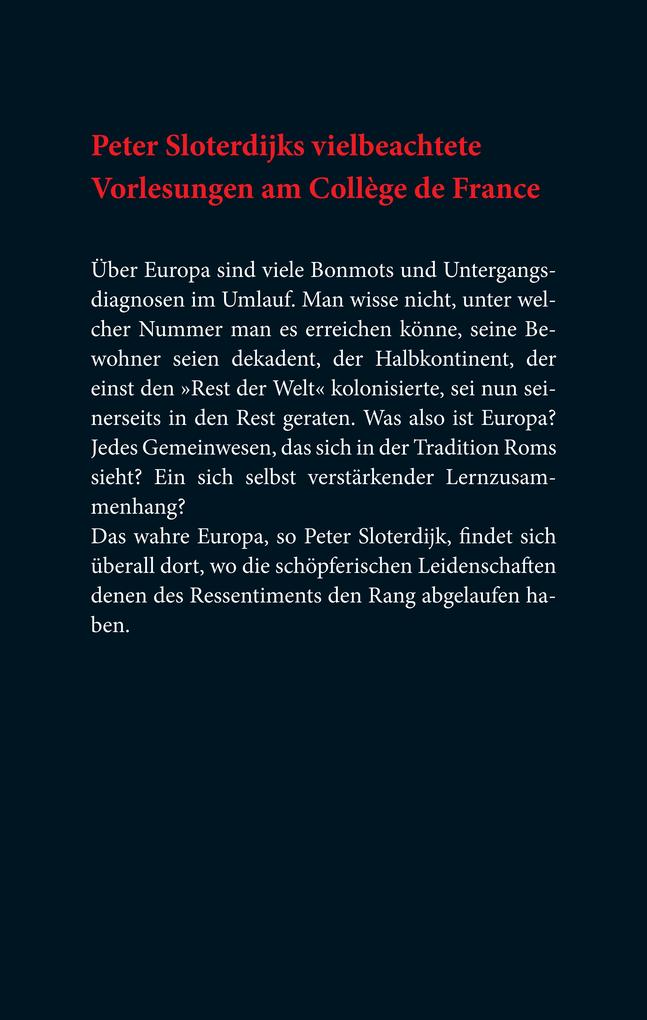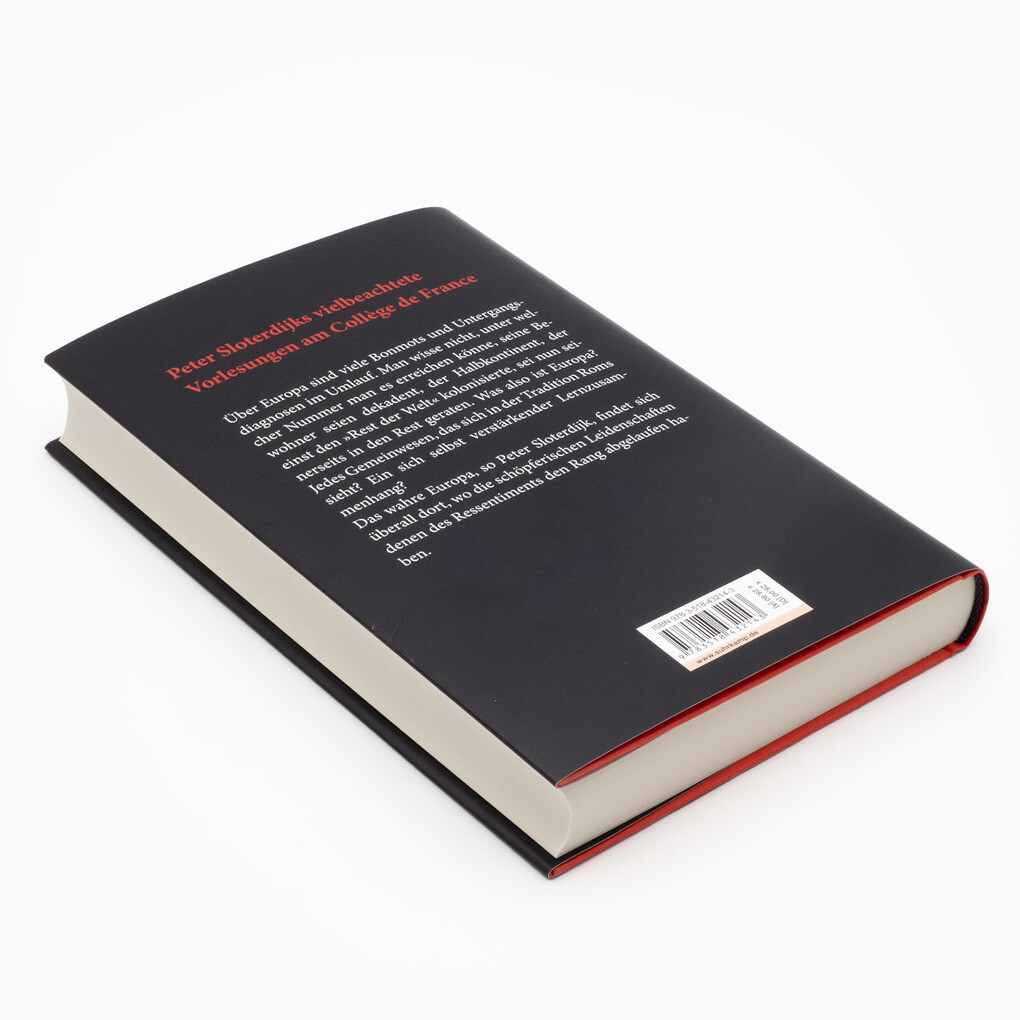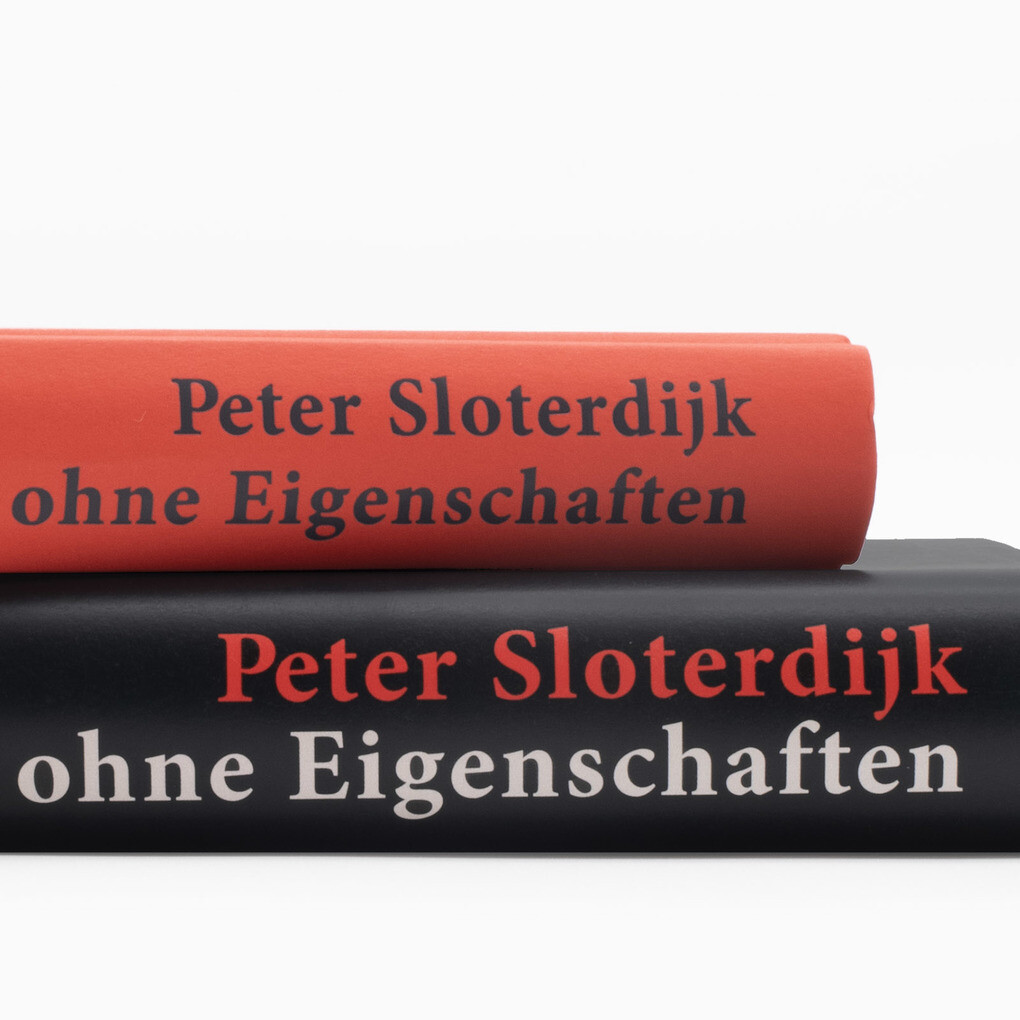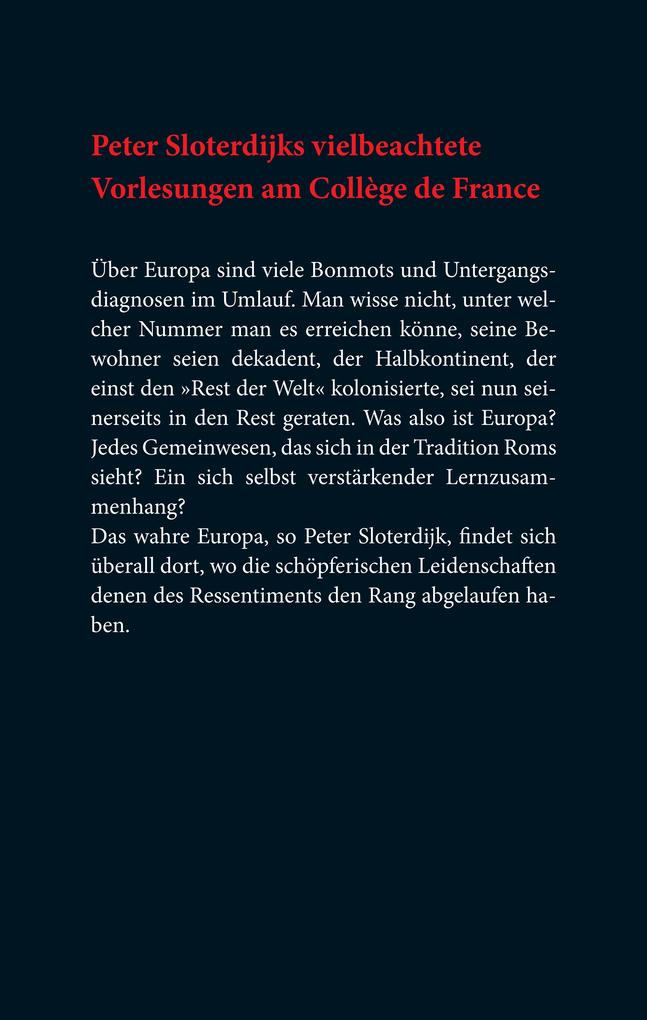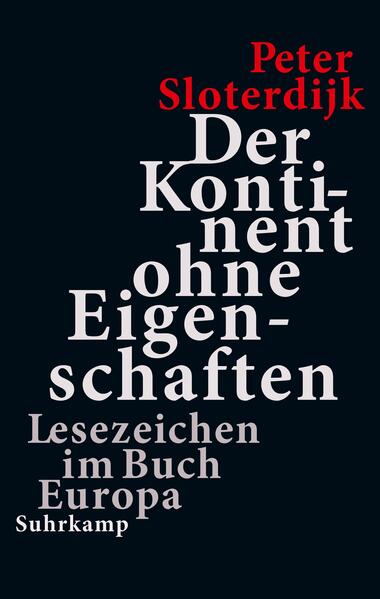
Zustellung: Fr, 30.05. - Mo, 02.06.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Über Europa sind viele Bonmots und Untergangsdiagnosen im Umlauf. Man wisse nicht, unter welcher Nummer man Europa erreichen könne, seine Bewohner seien dekadent, der Halbkontinent, der einst den »Rest der Welt« kolonisierte, sei nun seinerseits in den Rest geraten etc.
Doch wie im Fall Mark Twains erweisen sich Nachrichten vom Ableben der »Alten Welt« regelmäßig als stark übertrieben. Gleichwohl sind sich die Europäer ihrer Eigenschaften nicht mehr sicher: »Sie wissen nicht, woher sie kommen, erst recht nicht, wohin die Reise geht. « Um Orientierung zu stiften, blättert Peter Sloterdijk im Buch Europa einige Lesezeichen auf, etwa das des Kulturphilosophen Eugen Rosenstock-Huessy, der die »Autobiografie des westlichen Menschen« als Sequenz politischer Revolutionen erzählte. Sloterdijk öffnet auch das »Buch der Geständnisse«, aus dem sich ein bezeichnender Geist der Selbstkritik erklärt. Und er zitiert aus dem »Buch der Ausdehnungen«, das Europas Missionen im Zeitalter der nautischen Globalisierung illustriert.
Was ist Europa also? Jedes Gemeinwesen, das sich in der Tradition Roms sieht? Ein sich selbst verstärkender Lernzusammenhang? Das wahre Europa, so Sloterdijk, findet sich überall dort, wo die schöpferischen Leidenschaften denen des Ressentiments den Rang abgelaufen haben.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
3. Auflage
Seitenanzahl
296
Autor/Autorin
Peter Sloterdijk
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
458 g
Größe (L/B/H)
217/143/29 mm
ISBN
9783518432143
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»[Es] liest sich wie der Text zur Stunde. « Jens-Christian Rabe, Süddeutsche Zeitung
»[Sloterdijk ist] ein Feuerspeier der Gelehrsamkeit, der mit den Stichflammen seiner Assoziationen immer neu in Staunen versetzt. « Joseph Hanimann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Eine inspirierende Lektüre, die Europa kritisch und zukunftsorientiert beleuchtet. « Meron Mendel, Süddeutsche Zeitung
»[Ein] ebenso anspruchsvolles wie anregendes Buch . . . « Guido Kalberer, Neue Zürcher Zeitung
»Deutschlands wichtigster lebender Denker hat sich in Vorlesungen am Collège de France mit der Idee Europa auseinandergesetzt. « DIE WELT
». . . ein Weckruf für die allzu erschöpften europäischen Geister. « Peter Neumann, DIE ZEIT
»Peter Sloterdijk setzt in Der Kontinent ohne Eigenschaften Lesezeichen in einem Buch Europa. « Konrad Holzer, Buchkultur
»Sloterdijks originelle Gedanken über Europa sind nicht nur aus sprachlicher, sondern auch aus inhaltlicher Sicht eine äußerst lohnenswerte Lektüre. « Siegfried Reusch, der blaue reiter (Journal für Philosophie)
»[Sloterdijk ist] ein Feuerspeier der Gelehrsamkeit, der mit den Stichflammen seiner Assoziationen immer neu in Staunen versetzt. « Joseph Hanimann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Eine inspirierende Lektüre, die Europa kritisch und zukunftsorientiert beleuchtet. « Meron Mendel, Süddeutsche Zeitung
»[Ein] ebenso anspruchsvolles wie anregendes Buch . . . « Guido Kalberer, Neue Zürcher Zeitung
»Deutschlands wichtigster lebender Denker hat sich in Vorlesungen am Collège de France mit der Idee Europa auseinandergesetzt. « DIE WELT
». . . ein Weckruf für die allzu erschöpften europäischen Geister. « Peter Neumann, DIE ZEIT
»Peter Sloterdijk setzt in Der Kontinent ohne Eigenschaften Lesezeichen in einem Buch Europa. « Konrad Holzer, Buchkultur
»Sloterdijks originelle Gedanken über Europa sind nicht nur aus sprachlicher, sondern auch aus inhaltlicher Sicht eine äußerst lohnenswerte Lektüre. « Siegfried Reusch, der blaue reiter (Journal für Philosophie)
 Besprechung vom 07.01.2025
Besprechung vom 07.01.2025
Die Verniemandung eines Kontinents
Kühne Thesen im leisen Ton: Peter Sloterdijk liest Europa als Buch und lässt es dabei an Gelehrsamkeit nicht mangeln
Beim Applaus nach der Antrittsvorlesung im vergangenen Frühjahr zum Zyklus "Die Erfindung Europas durch Sprache und Kultur" am Collège de France, der Initialzündung zu diesem Buch, glaubte man mehr wohlwollende Anerkennung als offene Begeisterung herauszuhören. Peter Sloterdijk ist durch seinen Denkstil die wohl französischste Intellektuellenfigur Deutschlands, im Pariser Milieu allbekannt und gern gehört. Mit seinem souverän schleppenden Parlando wirkt er aber im freien Gespräch und in der gedruckten Fassung stärker als am Pult des Hörsaals. So kommt man als Leser dieses Buchs wohl noch besser auf die Rechnung als die Hörer damals am Collège de France.
Den Kontinent Europa mit einem Buch zu vergleichen, in das man Lesezeichen setzt, ist angesichts all des zum Thema schon Gesagten ein geschickter Ansatz. Keine neue Europa-Theorie also, verspricht der Autor. Statt die Frage nach der Identität, der Substanz oder dem Erbe Europas weiterzudrechseln, fragt Sloterdijk pragmatisch: Was tut Europa, wenn es am meisten bei sich selbst ist? Und antwortet in einem ersten Anlauf mit dem Blick eines Dramaturgen: Es reinszeniert seit anderthalbtausend Jahren ein altrömisch imperiales Befehlssystem.
Die Urszene dafür sieht er im Jahr 390, als der Mailänder Bischof Ambrosius dem Kaiser Theodosius den Zutritt in die Kirche verweigerte, weil dieser noch nicht Buße getan hatte für die Massaker von Thessaloniki. Die politische und die geistliche Macht, konstatiert Sloterdijk, hätten seither nie ganz die gleiche Sprache gesprochen und den Europäern so den Floh von der Freiheit ins Ohr gesetzt, das seltsame Privileg nämlich, zu jeder Zeit zwei Herren dienen zu dürfen.
Zwar habe das Wort "imperium" dann lange Zeit kaum mehr als einen "Baldachin aus sakral aufgeladenen Konzepten" von Einheit und Allgemeinheit abgegeben, schreibt der Autor. Ab dem fünfzehnten Jahrhundert jedoch sei Europa dann in politischer Hinsicht eine amphibische Größe geworden. Die imperiale Grundidee, die "Sein" mit "Befehlenkönnen" gleichsetzt, entfaltete sich in zweierlei Richtungen: nach innen hin mit dem Auftrag, staatsbildend nach römischem Muster tätig zu werden, nach außen hin mit dem Ziel, dem Mutterland nautisch-militärisch erschlossene Kolonien anzugliedern. Portugal, Spanien und Frankreich entwickelten als Erste diese doppelt ausgerichtete Befehlskompetenz in die Nähe und in die Ferne. Imperialität im Verein mit Latinität ist für Sloterdijk ein früher Marker Europas, der mit der Transposition des imperialen Imperativs in nationale Ambitionen später in England, Frankreich, Russland, Deutschland und transatlantisch bis in die USA weitere Kreise zog.
An solchen Stellen bestätigt sich Sloterdijk als das, wofür man ihn schätzt: ein Feuerspeier der Gelehrsamkeit, der mit den Stichflammen seiner Assoziationen immer neu in Staunen versetzt. Anmerkungen wie die über die "Verniemandung" unseres heutigen 27-Staaten-Europas - im Fernecho auf Odysseus' Antwort bei Homer nach Polyphems Frage "Wer da?" - sind brillante Einlagen. Manchmal gibt der Autor sich aber auch nur als ein Marketender, der aus den unteren Lagen seines Ideenkarrens abgelebtes kurioses Zeug hervorkramt und daran lang den Staub abklopft in der Überzeugung, da glänze doch noch etwas. So etwa in den Ausführungen zu Eugen Rosenstock-Huessys Revolutionsphantasien im Buch "Out of Revolution" aus den Dreißigerjahren, das die Geschichte Europas als eine Abfolge politisch-geistiger Umwälzungen erzählt, von der "Papstrevolution" Gregors VII. im elften Jahrhundert über Luther und Cromwell bis zur Französischen und zur russischen Revolution.
Sloterdijks barocke Ideenfülle, die gern leise spricht, wo Kühnes behauptet wird, und etwas lauter wird, wo es um Abseitiges geht, hat wohl auch in diesem Buch jedem etwas zu geben. Dass Europa weder räumlich als Gefäß, als "Kontinent", noch als Idee oder Substanz fassbar ist, gilt heute unter entspannteren Unionsmitgliedern schon fast als Selbstverständlichkeit. Wo die meisten aber im unüberschaubar gewordenen kulturgeschichtlichen Konvolut doch zumindest nach ein paar wesentlichen Charakterzügen suchen wie dem kritischen Geist, der Distanz zu sich selbst, der Ironie oder der freiheitsbegründenden persönlichen Autonomie, blättert Sloterdijk scheinbar beiläufig in den europäischen Buchseiten und streut einige Merkzeichen ein, wie etwa das der fixen Idee autobiographischen Wahr-Sagens bei Augustinus, Petrarca, Casanova, Rousseau, Goethe, oder jenes sendungsgewisser Entschlossenheit bei Kolumbus und im religiösen oder humanistischen Missionsgedanken, aber auch schon der frühen Skrupel in den expansionskritischen Schriften eines Bartolomé de Las Casas.
Über die heißeren Streitpunkte des europäischen Erbes gleitet Sloterdijk in seiner üblichen lakonischen Art hinweg, nicht ohne mitunter in den Fußnoten seine eigene ideologische Duftnote zu setzen. Die Europa-Kritik von Frantz Fanon und dessen Vorwort-Autor Sartre, von Susan Sontag, Giorgio Agamben, Edward Said? Übertrieben und einseitig. Dem "Saidismus" schreibt Sloterdijk sogar terroristische Neigungen zu und rät als Gegengift zu Mathias Énards Roman "Kompass". Eine erweiterte Vielsprachigkeit im Sinn eines Navid Kermani, eines Amin Maalouf, Ständiger Sekretär der Académie Française, oder von Édouard Glissants "Kreolisierung" kommt bei ihm nicht vor. Angesichts der "postkolonialen Studien" stellt der Autor vielmehr die Prognose, unsere Welt werde voll von Parodien sein oder sie werde nicht sein. Hier spätestens möchte man auch in dieses Buch ein Lesezeichen einlegen: das einer zu eng gefassten europäischen Selbstbezüglichkeit. JOSEPH HANIMANN
Peter Sloterdijk: "Der Kontinent ohne Eigenschaften". Lesezeichen im Buch Europas.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 296 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.