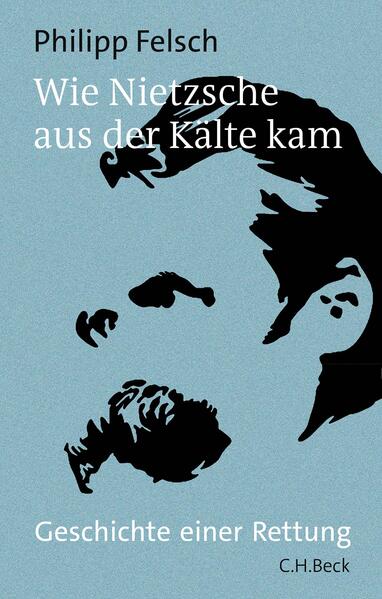
Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
NIETZSCHE ZWISCHEN DEN FRONTEN DES 20. JAHRHUNDERTS - EINE RASANTE GESCHICHTE
Nach 1945 liegt Nietzsches Ruf genauso in Trümmern wie der europäische Kontinent. Ausgerechnet Giorgio Colli und Mazzino Montinari, zwei italienische Antifaschisten, entschließen sich, den gefährlichen Denker zu rehabilitieren. Ihr Ziel: Nietzsches Nachlass neu zu entziffern, um alle postumen Verfälschungen rückgängig zu machen. Ihr Problem: Zehntausende kaum lesbarer Seiten, die sich in der DDR befinden, wo Nietzsche offiziell als Staatsfeind gilt. In seinem brillant geschriebenen Buch erzählt Philipp Felsch ein intellektuelles Abenteuer im Spannungsfeld des Kalten Krieges, das von Florenz über Weimar und Ost-Berlin bis ins Paris der Postmoderne führt.
Wer die von Giorgio Colli und Mazzino Montinari herausgegebene Nietzsche-Gesamtausgabe aufschlägt, betritt eine Wüste akribischer Gelehrsamkeit. In seinem aufregenden neuen Buch folgt Philipp Felsch den beiden Philologen auf ihrer epischen Suche nach dem echten Nietzsche, die zwischen die politischen und philosophischen Fronten des Kalten Krieges führt. Während Colli und Montinari im Osten ins Visier der Staatssicherheit geraten, schlägt ihnen im Westen der Widerstand der neuen Meisterdenker entgegen, die die Idee des authentischen Urtexts, ja der Wahrheit selbst in Frage stellen. Zu guter Letzt wird ihre Ausgabe sogar für den Fall der Mauer verantwortlich gemacht. Die Geschichte des Kampfs um Nietzsches Überlieferung, zugleich ein intellektuelles Porträt der Epoche, macht deutlich, welche Sprengkraft bis heute in seinem Denken liegt.
- Der schillerndste aller Philosophen und seine Wandlung vom rechten zum linken Denker
- Die Geschichte eines intellektuellen Abenteurers zwischen Florenz, Ost-Berlin und Paris
- Schriftstellerisch glänzend und intellektuell brillant
- Vom Autor des Kultbuches "Der lange Sommer der Theorie"
Inhaltsverzeichnis
Die Spielverderber
Einleitung
1. Jenseits der Gotenlinie
Lucca 1943/44
2. Akribie und Klassenkampf
Pisa 1948
3. Aktion Nietzsche
Florenz 1958
4. Über die Mauer und in die Wüste
Weimar 1961
5. Warten auf Foucault
Cerisy-la-Salle 1972
6. Burn After Reading
Berlin 1985
Dank
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Einleitung
1. Jenseits der Gotenlinie
Lucca 1943/44
2. Akribie und Klassenkampf
Pisa 1948
3. Aktion Nietzsche
Florenz 1958
4. Über die Mauer und in die Wüste
Weimar 1961
5. Warten auf Foucault
Cerisy-la-Salle 1972
6. Burn After Reading
Berlin 1985
Dank
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. März 2022
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
268
Autor/Autorin
Philipp Felsch
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 24 Abbildungen
Gewicht
506 g
Größe (L/B/H)
217/143/27 mm
ISBN
9783406777011
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 12.03.2022
Besprechung vom 12.03.2022
Parallelaktion für einen verfemten Philosophen
Ein Nachlass in Weimar: Philipp Felsch erzählt, wie Nietzsche wieder zu Ehren und die Kritische Edition seiner Schriften zustande kam.
Von Thomas Karlauf
Der Rezensent erinnert sich. In der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, als er seine ersten Texte veröffentlichte, galt Nietzsche unter den Deutschen als erledigt. Für jedes Zitat aus den Schriften dieses "Vordenkers des Faschismus" musste man sich rechtfertigen. Wer Genaueres über seine Philosophie wissen wollte, landete notgedrungen bei Autoren, deren Beschäftigung mit Nietzsche in die Dreißiger- und Vierzigerjahre fiel - Karl Jaspers, Karl Löwith und Martin Heidegger. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Nietzsche nicht nur kein Thema mehr, von ihm ging, wie Jürgen Habermas 1968 offenbar erleichtert feststellte, "nichts Ansteckendes" mehr aus.
Knapp zehn Jahre später tauchten im linksautonomen Milieu italienischer Universitätsstädte erste Zarathustra-Graffiti an Institutswänden auf. Nietzsche begann, zunächst in Frankreich und Italien, zeitversetzt dann auch in Westdeutschland, seine linken Kritiker links zu überholen. Was war passiert?
Die philosophische Postmoderne, die sich Mitte der Sechzigerjahre in Frankreich zu formieren begann, hatte in Nietzsche ein dankbares Objekt gefunden. Der Deutsche, der die Wahrheit als "eine Summe von menschlichen Relationen" definiert hatte, stand gleichsam Pate für eine der Grundforderungen der Poststrukturalisten nach Dekonstruktion. Alles bei Nietzsche ziele auf Decodierung und Fragmentierung, so Michel Foucault, und darin liege seine eigentliche Bedeutung. Von einem Werk im herkömmlichen Sinn könne so wenig die Rede sein wie von klassischer Autorschaft; am Ende sei die Interpretation wichtiger als der Text, der schließlich auch nur Interpretation sei.
Mehr als ein Staunen hätten die waghalsigen Nietzsche-Auslegungen der Franzosen vermutlich kaum bewirkt, wäre nicht um die gleiche Zeit dank der Beharrlichkeit zweier italienischer Philologen eine zuverlässige Textgrundlage geschaffen worden. Die von Giorgio Colli und Mazzino Montinari herausgegebene, in drei Ländern von 1967 an gleichzeitig erscheinende Kritische Gesamtausgabe schuf die Voraussetzung für eine ideologiefreie Beschäftigung mit Nietzsches Werk und ermöglichte so einen tatsächlichen Neuzugang.
Klug, souverän und anschaulich erzählt Philipp Felsch die Geschichte der Nietzsche-Renaissance als eine unfreiwillige, von gegenseitigem Misstrauen geprägte französisch-italienische Parallelaktion. Sowenig die italienischen Philologen mit der ungezügelten Nietzsche-Exegese der Franzosen anzufangen wussten, so wenig Verständnis zeigten diese ihrerseits für das Insistieren der Italiener auf Buchstabengenauigkeit. Beide Seiten erkannten jedoch die Gunst der Stunde und taten sich "trotz gegenläufiger Absichten und wechselseitiger Animositäten" zur gemeinsamen Rehabilitierung Nietzsches zusammen. Im ersten Band der französischen Ausgabe bei Gallimard werden Gilles Deleuze und Michel Foucault sogar als Mitherausgeber genannt. Wegen editorischer Schludrigkeiten, die auf ihr Konto gingen, weil sie sich mit dem Projekt nicht wirklich hatten anfreunden können, und nicht zuletzt aufgrund massiver Kritik an der neuen Ausgabe aus dem Heidegger-Lager traten Deleuze und Foucault jedoch noch im gleichen Jahr 1967 als Herausgeber zurück.
Im Mittelpunkt von Felschs hoch verdichteter, enorm anregender Studie steht die ungewöhnliche Freundschaft der beiden Italiener, mit deren Namen die neue Nietzsche-Ausgabe bis heute verbunden ist. Kennengelernt hatten sich Giorgio Colli und Mazzino Montinari während des Krieges am Gymnasium in Lucca, wo Colli, charismatischer junger Lehrer für Philosophie und Griechisch, einen kleinen Kreis von Schülern um sich scharte, mit denen er sich in klassische Texte vertiefte. Der fünfzehnjährige Montinari geriet in den Sog "einer erotisch aufgeladenen Lehrer-Schüler-Beziehung", die sein ganzes weiteres Leben bestimmte. Felsch spricht von einem "Rollenspiel" nach antikem Muster, an dem beide bis ins Alter festgehalten hätten.
Bei Kriegsende trennten sich ihre Wege vorübergehend. Montinari wurde politisch aktiv und schloss sich der Kommunistischen Partei Italiens an. Colli war nach mehreren Versuchen, im Journalismus Fuß zu fassen, Herausgeber einer Reihe "Klassiker der Philosophie" beim Verlag Einaudi geworden. Ende der Fünfzigerjahre versuchten sie mit einer Reihe, die in manchem das Konzept der späteren Edition Suhrkamp vorwegnahm, die Grenzen der akademischen Philosophie zu überwinden. Eröffnet wurde die Reihe 1958 mit Montinaris Übersetzung von Nietzsches dritter Unzeitgemäßer Betrachtung "Schopenhauer als Erzieher".
In der Bundesrepublik drehte sich die Nietzsche-Diskussion zu dieser Zeit um Vorwürfe, Nietzsches Schwester habe den Nachlass in ihrem Sinne missbraucht und ein nie geplantes Hauptwerk "Der Wille zur Macht" konstruiert. Über den in Weimar aufbewahrten Nachlass kursierten zahlreiche Gerüchte - gab es einen solchen Nachlass überhaupt, hatten nicht die Russen 1945 alles abtransportiert? Während Philologen aus der Bundesrepublik eine Reise in die DDR offenbar gar nicht erst in Erwägung zogen, fuhr Montinari, dem die DDR seit einem längeren Aufenthalt 1953 als das bessere Deutschland erschien, für eine erste Sichtung des Materials im April 1961 zwei Wochen nach Weimar. Im August, bei seinem nächsten Aufenthalt, wurde die Grenze dichtgemacht.
Montinari aber hatte die Aufgabe seines Lebens gefunden, ihn zog es in den Lesesaal des Goethe- und Schiller-Archivs, wo der Nietzsche-Nachlass seit 1950 aufbewahrt wird. Dort schwebte er "in dem Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, der aus der Zeit gefallen ist". Während er sich dem täglichen Exerzitium der Entzifferungsarbeit unterzog - einige Jahre wohnte er auch in Weimar, wo man ihn mit größter Zuvorkommenheit behandelte -, passte Colli in Florenz die Editionspläne an, verhandelte mit Verlagen und Geldgebern. Und immer häufiger musste er den Freund ermahnen, es mit der Sorgfalt nicht zu übertreiben und sich nicht ständig mit der Suche nach Nietzsches Quellen aufzuhalten.
Als knapp die Hälfte der auf vierzig Bände geplanten Kritischen Gesamtausgabe vorlag, beschloss der De Gruyter Verlag, in Koproduktion mit dem Deutschen Taschenbuchverlag eine fünfzehnbändige Studienausgabe herauszugeben. Giorgio Colli hat das Erscheinen dieser Ausgabe, mit der im Herbst 1980 die Wende in der Nietzsche-Rezeption markiert wurde, nicht mehr erlebt; er starb im Jahr zuvor im Alter von 61 Jahren. Mazzino Montinari erlag 1986 achtundfünfzigjährig einem Herzinfarkt. Aus dem Labyrinth der Handschriften hat er nicht mehr herausgefunden.
Philipp Felsch: "Wie Nietzsche aus der Kälte kam". Geschichte einer Rettung.
C. H. Beck Verlag, München 2022. 288 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Wie Nietzsche aus der Kälte kam" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









