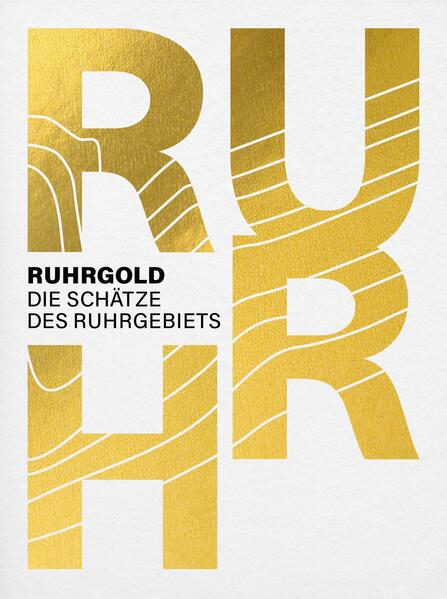
Zustellung: Di, 06.05. - Do, 08.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der neue Prachtband zum Ruhrgebiet: mehr als 300 Schätze aus Kunst und Kultur, Sport und Natur, Wirtschaft und Wissenschaft spiegeln die vielen Gesichter dieses faszinierenden Ballungsraums im Herzen Europas. Mehr als fünf Millionen Menschen leben hier, gestalten die rasante Transformation vom industriellen Kraftzentrum zur zukunftsweisenden Wissensökonomie. Vieles hat Modellcharakter. Manches ist skurril. 20 Kapitel, eingeleitet von namhaften Autorinnen und Autoren, geben Einblicke in den Mythos Ruhrgebiet. Eine Vermessung von Schroffheit und Schönheit, Tradition und Aufbruch, Vergangenheit und Zukunft.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
05. Oktober 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2024
Seitenanzahl
697
Herausgegeben von
Ferdinand Ullrich
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit ca. 500 farbigen Abbildungen
Gewicht
3726 g
Größe (L/B/H)
330/249/57 mm
ISBN
9783868326918
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 14.01.2025
Besprechung vom 14.01.2025
Neven Subotic kennt Leonie Reygers
Vom Zweibeiner zum Tausendfüßler: Ein Prachtband möchte den Reichtum des Ruhrgebiets vor Augen führen.
Früher war das Gold schwarz. Doch seit Ende 2018 ist es vorbei damit, die letzte Steinkohlezeche wurde geschlossen. Dass es noch anderes Gold gibt, das hier glänzt, ließ sich das Ruhrgebiet nicht so ohne Weiteres ansehen, das Klischee vom Kohlenpott prägte die Wahrnehmung, zumal die von außen, länger als die Wirklichkeit, auf dem Weg vom Zweibeiner, Kohle und Stahl, zum Tausendfüßler einer Forschungs- und Dienstleistungsregion konnten die Bilder im Kopf nicht mithalten. Dieser Prachtband, der es auf doppelte - nun denn - Brikettgröße bringt, will das ändern und den Reichtum sichtbar machen.
Das Buch strebt nach Repräsentanz, es geht um Selbstdarstellung und Image, Lebensqualität und Lebensgefühl. Inflation der Superlative ("größte", "grünste", "schönste") und Euphemismen ("Metropole"). Auch Schattenseiten werden angesprochen: die ÖPNV-Misere mehrmals, Kinderarmut und Kirchturmdenken nur kurz, graue Architektur und die Präsenz des Unfertigen gar nicht. "Die Schätze des Ruhrgebiets", so der Untertitel, werden auf siebenhundert Seiten ausgebreitet. Im Großformat und (überwiegend) in Farbe. Alles so schön bunt hier: Ein Nashorn ist schneeweiß, die Grubenlampe weinrot, ein Treppenhaus orange. Von A wie Aalto-Oper, Josef Albers und Aldi bis Z wie Zeche Zollverein: Eisenheim und Emscher-Umbau, Folkwang und Fußball, Knappschaft und Katzenklo, Krupp und Kumpel, Lichtburg und Landmarken, Mammutskelett und Margarethenhöhe, Pumpwerk und Phoenix-See, Schimanski, Schlingensief und Tana Schanzara, Steigerlied und Starlight-Express. Ein Ballungsraum ohne Mitte, zerschnitten und zusammenstehend.
Der Inhalt ist nicht historisch geordnet, auch nicht nach Orten oder Kunstsparten. Die 21 Kapitel sind mit allgemeinen Begriffen (wie "Arbeit" oder "Zukunft"), reviertypischen Tugenden (wie "Zusammengehörigkeit" oder "Humor") und Eigenheiten (wie "Energie" oder "Industrienatur") überschrieben und mit kurzen Essays von mehr oder (manchmal auch) weniger berufenen Autoren eingeleitet: Einer liest sich wie eine Kurzvorlesung, ein anderer wie ein Wikipedia-Eintrag, ein dritter wie aus einem Prospekt der Wirtschaftsförderung. In der Mehrzahl aber verbinden sie Information und Inspiration, Kennerschaft und ein Bekenntnis zur Region: Johan Simons identifiziert "Schönheit" mit dem Schauspielhaus Bochum, und Hilmar Klute erklärt Feierabend, Taubenverein, Eckkneipe, Schrebergarten, Naherholungsgebiet und inzwischen auch die Teestube als Inventar der "Genügsamkeit" im Ruhrgebiet. Neven Subotic lebt "Offenheit" vor: Dass er mit 22 Jahren in Dortmund eine karitative Stiftung gründete, ist auch eine Liebesbekundung an die Stadt, die mit einer Verbeugung vor Leonie Reygers, der Gründungsdirektorin des Museums am Ostwall, überrascht.
Ausgeführt werden die Begriffe mit Bildstrecken von jeweils etwa zwanzig Doppelseiten. In "Schönheit" stehen sich ein Bronzeknabe aus dem antiken Xanten und Lehmbrucks "Kniende", gedoubelt von einer Schauspielerin, gegenüber, und Gerhard Richters "Ruhrtalbrücke" läuft auf Conrad Felixmüllers "Hochöfen" in Haspe zu. In "Herkunft" folgt Gelsenkirchener Barock auf Grönemeyers "4630 Bochum", in "Gottvertrauen" strahlen der Hindu-Tempel in Hamm und die Kirche "Heilig Kreuz" von Rudolf Schwarz in Bottrop um die Wette, "Zusammenhalt" bezeugen das Stillleben auf dem Ruhrschnellweg und Andreas Gurskys "Dortmund 2009", Arbeit wird an Kauenhaken wie an dem Glasfenster von Jan Thorn Prikker in der Bahnhofshalle in Hagen festgemacht, auf dem der Künstler als Lehrer für Handel und Gewerbe figuriert.
Der Herausgeber Ferdinand Ullrich, der lange die Kunsthalle Recklinghausen geleitet hat, ist ein exzellenter Kenner des Ruhrgebiets, der Übersicht und Entdeckerfreude mitbringt und die Schätze nicht nur sortiert, sondern auch mit Assoziationslust in eine spannende Erzählung überführt: Das Kreuzgewölbe der Margaretenkirche in Kamen scheint mit dem Kamener Kreuz, der Terrassengarten des Klosters Kamp mit dem Krematorium von Peter Behrens in Hagen zu korrespondieren, der Duisburger Innenhafen, aus der Vogelperspektive betrachtet, mit dem Industriedenkmal Schiffshebewerk Henrichenburg über 125 Jahre hinweg auf Nachbarschaft anzustoßen.
Die Abbildungen sind mit knappen Legenden versehen und werden im Anhang "RuhrGold Wissen" (kunst-)historisch eingeordnet. Dazwischen aber tauchen ein paar Personen, Werke und Projekte auf, die dafür (noch) kaum etwas vorweisen können: wenig bekannte Künstler, Start-up-Unternehmen, ein Reisebüro (!) oder die Kunst-Biennale "Manifesta", die 2026 im Ruhrgebiet Station machen und bereits der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 zur Seite gestellt wird. Die Auswahl wirkt beliebig und lässt eine Protektion durch die finanzkräftige RAG-Stiftung vermuten, die für die Veröffentlichung mehr als nur ein schulterklopfendes Grußwort übrighat.
IBA Emscher Park, Sprache ("Hömma, ich muss dich watt sagen!"), Brauereien, aber auch naive Kunst, Uta Ranke-Heinemann und Taubenklinik - das ganze Ruhrgebiet soll es sein. Auf den zweiten Blick offenbaren sich Lücken und Asymmetrien: Die Konzerthäuser in Essen und Bochum werden vorgestellt, das in Dortmund, eine mäzenatische Initiative des Unternehmers (und Tenors) Ulrich Andreas Vogt, nicht, das Jüdische Museum in Dorsten, schon 1992 eröffnet, und die einzigartige Arbeitsweltausstellung DASA auch nicht. Die lebendige Alternativszene, aus der der von Ludger Claßen geführte Klartext-Verlag, der für das Ruhrgebiet zum Diskursforum wurde, und die von Norbert Wehr edierte Literaturzeitschrift "Schreibheft" hervorgingen, wird so wenig berücksichtigt wie Hans Scharoun, der in Marl und Lünen Schulen baute, oder Klaus Tenfelde, der das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets gründete. Die weltberühmte Cornelia Funke und der Außenseiter Wolfgang Welt fehlen geradeso wie Werbegenie Charles Wilp, Hugo Kükelhaus oder Albert Schulze Vellinghausen, der schon in den Fünfzigerjahren Ruhrgold schürfte.
So gerät der Prachtband aus der Balance, wird eingetrübt durch Werbung. Was hätte daraus werden können! Wovon sich das Ruhrgebiet, gerade auch mit Publikationen wie dieser, emanzipieren möchte, wird - die RAG-Stiftung verwaltet das Erbe des Bergbaus - bestätigt: seine Abhängigkeit von der großen Industrie. ANDREAS ROSSMANN
Ferdinand Ullrich: "Ruhrgold". Die Schätze des Ruhrgebiets.
Wienand Verlag, Köln 2024.
700 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "RUHRGOLD" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









