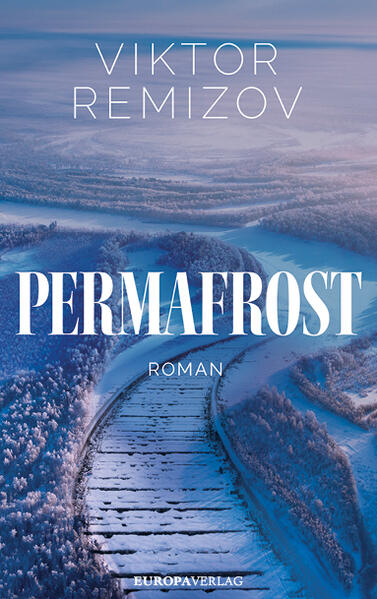
Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Grandioses russisches Epos über das ewig Menschliche und Politische: In einer Linie mit Solschenizyn und TolstoiDie Handlung des Romans spielt in den Jahren 1949-1953 in der abgelegenen sibirischen Siedlung Jermakowo, wo nach einer Laune Stalins ein ebenso gigantisches wie sinnloses Bauprojekt geplant war. Mithilfe von bis zu 120. 000 Gulag-Häftlingen sollte am Polarkreis, durch Taiga und Sümpfe eine anderthalbtausend Kilometer lange Eisenbahnstrecke verlegt werden, die den Unterlauf des Jenissejs mit dem Nordural verbindet. Das Projekt wird zur Metapher für den stalinschen Totalitarismus. Wie der Jenissej ist auch dieser Roman ein mächtiger, breiter, ruhiger Fluss - ohne plötzliche, unerwartete Windungen oder Stromschnellen. Bis zu den Verzweigungen der Nebenflüsse erlebt der Leser die vielfältige Schönheit und den Reichtum einer kargen Landschaft, in die der Mensch eindringt, um sie zu unterjochen, zu versklaven und zu zerstören. Und doch: Wenn man einmal an Bord von Kapitän Belows Schlepper gegangen ist, kann man sich der Kraft seiner Strömungen und Unterströmungen nicht mehr entziehen. Der ruhige Erzählfluss fesselt den Leser und lässt ihn bis zum letzten Satz und noch lange danach nicht los. Der Autor schildert menschliche Schicksale zwischen den Mühlsteinen der Geschichte, ohne die Realität zu übertreiben oder literarisch zu verschleiern. Das Böse wird nicht teuflischer geschildert, als es ist, das Gute nicht heiliggesprochen. Jede einzelne Handlung wird als das Ergebnis der emotionalen Entscheidung eines Menschen gezeigt, der versucht, sich selbst treu zu bleiben oder zumindest einigermaßen rechtschaffen im Fluss des Lebens mitzuschwimmen - oder wenigstens nicht darin unterzugehen. Die zunehmend tragische Verflechtung der einzelnen Hauptfiguren entfaltet eine unterschwellige Spannung und emotional nachhaltige Wirkung, der man sich kaum entziehen kann. Viktor Remizov hat für sein Werk, an dem er sieben Jahre schrieb, umfangreiches historisches Material studiert, das ihm die mittlerweile in Russland verbotene Menschenrechtsorganisation »Memorial« zur Verfügung stellte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1252
Autor/Autorin
Viktor Remizov
Übersetzung
Franziska Zwerg
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1214 g
Größe (L/B/H)
219/147/56 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag, mit Abbildungen und Karten
ISBN
9783958906006
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»"Permafrost" ist ein sibirischer, nordischer, historischer, industrieller Roman . . . Der Tod ist darin immer mit dem Leben verbunden, das selbst unter diesen unmenschlichen Bedingungen entsteht und weitergeht. Eine scheinbar düstere Geschichte, in die ein Licht hineinscheint, das immer nach der Dunkelheit kommt und das ohne Dunkelheit nicht existieren kann. « Vasili Avchenko
»Danke für die Wahrheit. Es ist zweifellos die Wahrheit. Daran müssen wir uns erinnern. So war es nun einmal. « Litres
»Remizovs Roman enthält viele wertvolle Details, die nicht erfunden werden können. Er hat sie alle gesammelt, zugehört, spioniert, gesehen, erinnerte sich. Viele historische Details, die bei Solschenizyn, Schalamow und anderen nicht zu finden sind. « Natsbest Veronika Kungurtseva
»In diesem ewigen Frost gibt es aber auch einen Platz für Liebe, verzweifelt, jedoch zuverlässig; Ehrlichkeit, manchmal naiv; Ideale, stark und unveränderlich. « Petr Aleshkovski, Novaya Gazeta
»Ein großartiges Buch. Ausgezeichnete Prosa und wunderbare Sprache. « Nikolai Obraztov
»So etwas habe ich im 21. Jahrhundert noch nicht auf Russisch gelesen! Ein wirklich großartiger Roman, der den bedeutendsten Werken des 20. Jahrhunderts in nichts nachsteht. Es ist absolut unmöglich, ihn aus der Hand zu legen. « Rumata Estorski
»Bilder der exotischen Natur des Nordens werden so gekonnt und kraftvoll beschrieben, wie es in unserer Literatur schon lange nicht mehr zu sehen war. Der Schauplatz ist die Umgebung des Jenissej, des riesigen Flusses, in dem immer noch Störe von der Größe eines Bootes zu finden sind. Der Roman ist eindrucksvoll, zutiefst antistalinistisch, obwohl Stalin in dem Buch nicht als Bösewicht dargestellt wird, sondern als alter Mann, der allmählich den Bezug zur Realität verliert. «
Sergej Beljakow, Internetjournal: Stol
»Dies ist bei weitem der interessanteste Beispieltext, den ich in letzter Zeit übersetzt habe. « ANDREW BROMFIELD
»Danke für die Wahrheit. Es ist zweifellos die Wahrheit. Daran müssen wir uns erinnern. So war es nun einmal. « Litres
»Remizovs Roman enthält viele wertvolle Details, die nicht erfunden werden können. Er hat sie alle gesammelt, zugehört, spioniert, gesehen, erinnerte sich. Viele historische Details, die bei Solschenizyn, Schalamow und anderen nicht zu finden sind. « Natsbest Veronika Kungurtseva
»In diesem ewigen Frost gibt es aber auch einen Platz für Liebe, verzweifelt, jedoch zuverlässig; Ehrlichkeit, manchmal naiv; Ideale, stark und unveränderlich. « Petr Aleshkovski, Novaya Gazeta
»Ein großartiges Buch. Ausgezeichnete Prosa und wunderbare Sprache. « Nikolai Obraztov
»So etwas habe ich im 21. Jahrhundert noch nicht auf Russisch gelesen! Ein wirklich großartiger Roman, der den bedeutendsten Werken des 20. Jahrhunderts in nichts nachsteht. Es ist absolut unmöglich, ihn aus der Hand zu legen. « Rumata Estorski
»Bilder der exotischen Natur des Nordens werden so gekonnt und kraftvoll beschrieben, wie es in unserer Literatur schon lange nicht mehr zu sehen war. Der Schauplatz ist die Umgebung des Jenissej, des riesigen Flusses, in dem immer noch Störe von der Größe eines Bootes zu finden sind. Der Roman ist eindrucksvoll, zutiefst antistalinistisch, obwohl Stalin in dem Buch nicht als Bösewicht dargestellt wird, sondern als alter Mann, der allmählich den Bezug zur Realität verliert. «
Sergej Beljakow, Internetjournal: Stol
»Dies ist bei weitem der interessanteste Beispieltext, den ich in letzter Zeit übersetzt habe. « ANDREW BROMFIELD
 Besprechung vom 08.05.2025
Besprechung vom 08.05.2025
Sisyphos am Polarkreis
Stalins gescheitertes Projekt einer Eisenbahn im hohen Norden war Ausdruck seines Größenwahns. Es inspirierte ein Wahnsinnswerk: Viktor Remizovs fast 1300 Seiten langer Gulag-Roman "Permafrost" liegt jetzt auf Deutsch vor.
Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen." Als Albert Camus diese Pointe unter seinen "Mythos des Sisyphos" setzte, war ihm bewusst, dass er schier Unmögliches verlangte. Ein Sträfling, der ohne jede Aussicht auf Entlassung seine Kräfte tagtäglich in sinnloser Schwerstarbeit erschöpft - glücklich? Kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht. Um die dafür benötigte Imaginationskraft aufzubringen, braucht es schon einen russischen Romancier: zum Beispiel einen, der auf 1243 Textseiten einen solchen Sisyphos auf seinen endlosen Wegen begleitet, sowie eine Übersetzerin, die über die gesamte Distanz Schritt hält.
Viktor Remizov und Franziska Zwerg ist dieses Kunststück gelungen. Remizov, Jahrgang 1958, studierter Geologe, bewies schon 2014 mit seinem Romandebüt "Asche und Staub", wie buchstäblich bewandert er in den Weiten der russischen Taiga ist. Literarisch aktiv wurde Remizov in den Achtzigerjahren. Damals schrieb er für die Schublade. Einiges spricht dafür, dass ihm diese Praxis wieder bevorstehen könnte. Denn das Material für sein Opus magnum, "Permafrost", hat er in siebenjähriger Kärrnerarbeit aus den Zeugnissen ehemaliger Gulag-Häftlinge und Archivalien der Gesellschaft "Memorial" zusammengetragen. 2021, im Erscheinungsjahr von "Permafrost", wurde "Memorial" dann verboten. Beide, die Menschenrechtsorganisation wie Remizovs Roman, haben sich die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen zum Ziel gesetzt. Sein Buch ist zwar formal ein Werk der Fiktion, basiert aber, wie gleich der erste Satz des Vorworts klarstellt, "auf wahren Begebenheiten". Wer die 89 Kapitel liest, dürfte sich spätestens beim sechzigsten, einer dreiundzwanzigseitigen Foltersitzung, beim Wunsch ertappen, "nur" mit Fiktion zu tun zu haben. Solche Beruhigung verweigert Remizov, und eine Beilage dokumentarischer Fotografien lässt keinen Zweifel: Diese Fakten sind hart, im doppelten Wortsinn. Sogar die realen Namen der beiden Protagonisten werden im Vorwort enthüllt.
Remizovs Monumentalwerk erfüllt alle Kriterien eines historischen Romans. Doch eher noch lässt es sich als gewaltiger Essay über die Frage lesen, ob es gelingen kann, unter menschenverachtenden Bedingungen etwas genuin Menschliches zu bewahren. Darin bildet "Permafrost" ein Gegenstück zum "Mythos des Sisyphos". Zwar heißen die Flüsse in diesem Reich der Halbtoten nicht Acheron, Lethe und Styx, sondern Turuchan, Jenissej und Tunguska; und der Tartaros, in dem die Verdammten hier ihre Strafe verbüßen, umfasst Millionen von Quadratkilometern. Doch das absurde Element, das im Zentrum von Camus' Neuauflage des Sisyphos-Mythos steht, gewinnt auch in Remizovs sibirischem Epos erdrückende Präsenz.
Absurd ist schon der historische Rahmen. Er wirkt, als hätte ihn ein böser Märchenkönig entworfen, einer von jener Sorte, die den Untertanen auferlegt, das Meer auszuschöpfen. Nur ist die unerfüllbare Aufgabe hier real: "Anderthalbtausend Kilometer Schienen sollten . . . verlegt werden, um den nördlichen Ural mit dem Unterlauf des Jenissej zu verbinden." Und zwar "Tausende von Kilometern jenseits des Polarkreises . . ., wo nicht einmal ein Tausendstel der Bevölkerung der UdSSR lebte." Die Rede ist von einem Projekt, mit dem der alternde Stalin 1947 sein Politbüro verblüffte: der Idee einer "Großen Stalinbahn" und eines Marinehafens am 68. Breitengrad. Auf den handfesten Einwand des Marineministers, "dass Kriegsschiffe dort zehn Monate im Jahr im Eis eingefroren sein würden", hatte Stalin eine noch handfestere Antwort. Der Marineminister wurde als britischer Spion zu zwanzig Jahren Besserungsarbeitslager verurteilt, und der Bau der Bahn konnte beginnen. In mehr als drei Jahren gelang es, "Gleise in drei Abschnitten" à 65, 125 und 23 Kilometer zu verlegen. Allerdings maßen die 23 Kilometer bei näherer Betrachtung nur vierzehn, die Teilstrecken waren nicht angebunden, die Schienen führten über gefrorenen Sumpf, im Frühjahr standen sie unter Wasser, Bahndämme rutschten ab, zurückgelassene Loks rosten bis heute in der Taiga. Das Projekt der Großen Stalinbahn verpuffte im Nichts. Anstelle von Tausenden Schienenkilometern standen am Ende Tausende verschlissener Häftlinge. Sollte dieser Verschleiß für Stalin der eigentliche Sinn der Übung gewesen sein, so war sie ein veritabler Erfolg: extrem kräftezehrende Arbeit von einwandfreier Sinnlosigkeit - selbst Zeus hätte es sich für Sisyphos kaum besser ausdenken können.
Absurd war in dieser Hölle auch die Relation von Vergehen und Strafen. Da stellte Väterchen Stalin sogar den olympischen Göttervater in den Schatten. Denn immerhin wusste Sisyphos selber noch, was er ausgefressen hatte, er kannte sein Kerbholz. Den meisten, die an der Großen Stalinbahn schufteten, war hingegen klar, dass sie sich aufgrund einer fingierten Anklage zu Tode schinden sollten. Dies galt jedenfalls für die politischen Häftlinge; und die Berufskriminellen, die zu Recht einsaßen, ließen die politischen für sich schuften. Ein ehemaliger Häftling räsoniert: "Ein kluger Mensch sagte, Stalins schwarzes Genie bestünde darin, dass er Unschuldige tötete. (. . .) Indem er Unschuldige tötete, machte er allen Angst. Wenn jemand sich unschuldig fühlte, bedeutete das nicht, dass man ihm nichts anhaben konnte."
Remizov durchleuchtet dieses Angstsystem in mehreren Schichten: von der Höhe des Kremls bis hinab in die "heiße Strafzelle", wo man in Einzelhaft bei fast fünfzig Grad Celsius gehalten wurde und Hering zu essen bekam, aber nichts zu trinken. Andere mussten nach draußen: "Das Thermometer am Pfahl zeigte minus siebenundvierzig" - Temperaturdifferenzen wie in Dantes Inferno, nur historisch belegt. Der Treibstoff, mit dem diese Hölle betrieben wird, ist die Angst; durchschnittlich auf jeder vierten Seite des Romans taucht das Wort einmal auf. Angst haben fast alle: Stalin vor seinen Ärzten, das Politbüro vor Stalin, die für das unmögliche Bauprojekt Verantwortlichen vor der Aufdeckung ihrer Potjomkinschen Dörfer, die Gefangenen vor den Kriminellen, die dort ihr eigenes Sklavensystem errichten - und alle und jeder vor Denunziation. Es ist eine animalische Angst, und eine emblematische Szene zu Romanbeginn weist sie als das Gesetz aus, das hier herrscht. Wie den Trojanern in der "Ilias" ein unentschiedener Kampf zwischen Adler und Schlange als Omen Gesprächsstoff liefert, so diskutieren in "Permafrost" Wachschützen und Gefangene über eine Jagd, die sich vor ihren Augen abspielt: zwei Seeadler gegen einen Hasen. Ergebnis: "Ausgehüpft!" So unzweideutig gilt in dieser Welt das Recht der Stärkeren. Sie rotten sich gegen den Schwachen zusammen.
Und trotzdem! Trotz des unerbittlichen Scharfblicks, mit dem Remizov die Strukturen durchdringt, auf denen die gigantische Strafkolonie namens Stalinismus basierte, hat er das Gegenteil eines trostlosen Buches geschrieben, nämlich eine Hymne an die Resilienz der Menschlichkeit: "Menschen sind zäh. Nur in Büchern bringt sie der Gram um."
Wie schafft er das? Seine Lösung ist so alt, schlicht und wirkungsvoll wie das epische Handwerk selbst: Er flicht ins historische Geschehen zwei Liebesgeschichten ein. Beide sind exemplarisch, beide haben scheinbar keine gute Prognose: die Liebe des jungen, glühenden Stalinisten Below zu einer verbannten Französin und die des Geologen Gortschakow, eines Sisyphos mit so unendlicher Haftzeit, dass er den Kontakt zu seiner Frau abbrach, um der Folter des Hoffens ein Ende zu setzen. Die mäandernden, abreißenden, wieder auftauchenden, sich kreuzenden Wege aller vier verfolgen wir von Moskau und vom Baltikum bis nach Sibirien - getrieben von der Urfrage aller Liebesromane, der jetzt aber die Urfrage der Existenz vorgeschaltet ist. Keine Wiedervereinigung ohne das blanke Überleben: Das war Homer. Was aber, wenn das Überleben so viel fordert, dass für die Wiedervereinigung emotional keine Kraft mehr bleibt? Das ist Neuland. Remizov hat dieses Neuland auf den Schienen der Stalinbahn, auf dem Eis des Jenissej exploriert. Seine Helden finden dabei vielleicht nicht das Glück, aber ihre Humanität. Das ist ein Wunder und erstaunlicherweise eines, das wir ihm glauben. URS HEFTRICH
Viktor Remizov:
"Permafrost". Roman.
Aus dem Russischen von Franziska Zwerg. Europa Verlag, München 2025. 1264 S., Abb., Karte, geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Permafrost" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









