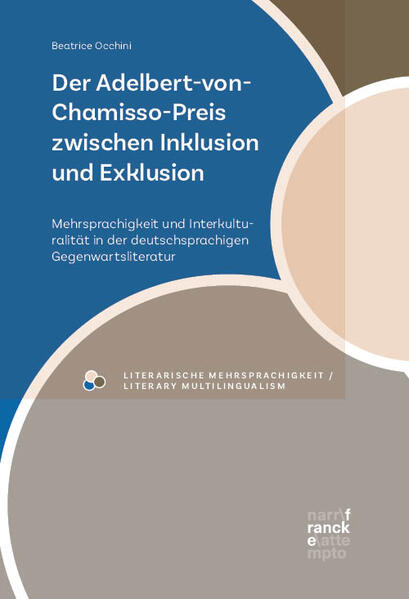
Zustellung: Do, 10.07. - Do, 17.07.
Versand in 6 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Buch untersucht den Literaturpreis Adelbert-von-Chamisso (1985-2017), eine der einflussreichsten sowie kontroversesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, deren kulturpolitische Tragweite weit über den Literaturbereich hinausreicht. Anhand einer Analyse originaler Archivunterlagen und literarischer Werke beleuchtet diese interdisziplinäre Arbeit innovativ die Reaktionsmechanismen des deutschen Kulturraums auf die Herausforderungen der soziokulturellen Transformationen durch Migration und Globalisierung. Die fünf Kapitel widmen sich dem Entstehungskontext, der Geschichte und Struktur des Preises, der Entwicklung und literaturwissenschaftlichen Rezeption der sogenannten , Chamisso-Literatur' sowie der Poetik zweier Preisträgerinnen, Terézia Mora und Uljana Wolf, als Beispiele für die jüngsten Entwicklungen in der Chamisso-Literatur.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die Anfänge: Gastarbeiterliteratur und Ausländerliteratur (1955-1985)
1. 1 Hintergrund und frühe literarische Produktion
1. 2 Projekte für die Förderung , ausländischer' Autor:innen
1. 3 Die ersten literaturwissenschaftlichen Kodifizierungen und ihre Kategorien: Betroffenheit, Gastarbeiterliteratur, Ausländerliteratur
1. 4 Die ambivalente Verortung der Literatur zwischen Politisierung und Sensibilisierung
2 Der Adelbert-von-Chamisso-Preis und die Entstehung der Chamisso-Literatur
2. 1 Struktur und Entwicklungsparabel des Chamisso-Preises
2. 2 Die Robert Bosch Stiftung und die hybride Zielsetzung des Projekts
2. 3 Die Konsekrationsmechanismen des Chamisso-Preises
2. 4 Aneignung eines Autors: Adelbert von Chamisso und seine , Schatten'
2. 5 Chamisso-Autor werden, Chamisso-Literatur schaffen
3 Entwicklung und Rezeption der Chamisso-Literatur(1985-heute)
3. 1 Zwischen Arbeitsmigration und kultureller Vielfalt (1985-2000)
3. 2 Die literaturwissenschaftliche Rezeption jenseits der Betroffenheit: Das interkulturelle Paradigma
3. 3 Die literaturwissenschaftliche Rezeption vom Dazwischen zum Durchdringen: das transkulturelle Paradigma
3. 4 Mehrsprachiges Experimentieren in der Chamisso-Literatur: Eine Bilanz
4 Aushandlung und Hinterfragung der konzeptuellen Architektur des Projekts
4. 1 Herkunft und Sprache: Die Konzeption und Neudefinition der Chamisso-Preisträger:innen
4. 2 Vom Ausländersein zum Kosmopolitismus: Das Herkunftskriterium
4. 3 Von der Fremdsprache zur Mehrsprachigkeit: Das Sprachigkeitskriterium
4. 4 Der Abbau konzeptueller Grundlagen und die Transformation des Preises
4. 5 Zwischen Inklusion und Exklusion: Der Abschluss des Projekts
4. 6 Variationen von "Germanness"
5 Grenzziehung, Fremdheit und Sprachigkeit bei Terézia Mora und Uljana Wolf
5. 1 Terézia Mora: das Minderheitendeutsch und die Autonomie der Literatur
5. 2 "Alles ist hier Grenze": Seltsame Materie
5. 3 "Gutes, altes Babylon": Alle Tage
5. 4 Uljana Wolf: Translinguale Lyrik und mehrsprachiges Gedicht
5. 5 Über die Grenze hinweg: kochanie ich habe brot gekauft
5. 6 Innerhalb der Grenze: falsche freunde
5. 7 Jenseits der Muttersprache: meine schönste lengevitch
5. 8 Terézia Mora und Uljana Wolf: Konstruktion und Dekonstruktion der Fremdheit
Schlussbemerkungen
Abstracts und Keywords
Literaturverzeichnis
Personenregister
Dank
1 Die Anfänge: Gastarbeiterliteratur und Ausländerliteratur (1955-1985)
1. 1 Hintergrund und frühe literarische Produktion
1. 2 Projekte für die Förderung , ausländischer' Autor:innen
1. 3 Die ersten literaturwissenschaftlichen Kodifizierungen und ihre Kategorien: Betroffenheit, Gastarbeiterliteratur, Ausländerliteratur
1. 4 Die ambivalente Verortung der Literatur zwischen Politisierung und Sensibilisierung
2 Der Adelbert-von-Chamisso-Preis und die Entstehung der Chamisso-Literatur
2. 1 Struktur und Entwicklungsparabel des Chamisso-Preises
2. 2 Die Robert Bosch Stiftung und die hybride Zielsetzung des Projekts
2. 3 Die Konsekrationsmechanismen des Chamisso-Preises
2. 4 Aneignung eines Autors: Adelbert von Chamisso und seine , Schatten'
2. 5 Chamisso-Autor werden, Chamisso-Literatur schaffen
3 Entwicklung und Rezeption der Chamisso-Literatur(1985-heute)
3. 1 Zwischen Arbeitsmigration und kultureller Vielfalt (1985-2000)
3. 2 Die literaturwissenschaftliche Rezeption jenseits der Betroffenheit: Das interkulturelle Paradigma
3. 3 Die literaturwissenschaftliche Rezeption vom Dazwischen zum Durchdringen: das transkulturelle Paradigma
3. 4 Mehrsprachiges Experimentieren in der Chamisso-Literatur: Eine Bilanz
4 Aushandlung und Hinterfragung der konzeptuellen Architektur des Projekts
4. 1 Herkunft und Sprache: Die Konzeption und Neudefinition der Chamisso-Preisträger:innen
4. 2 Vom Ausländersein zum Kosmopolitismus: Das Herkunftskriterium
4. 3 Von der Fremdsprache zur Mehrsprachigkeit: Das Sprachigkeitskriterium
4. 4 Der Abbau konzeptueller Grundlagen und die Transformation des Preises
4. 5 Zwischen Inklusion und Exklusion: Der Abschluss des Projekts
4. 6 Variationen von "Germanness"
5 Grenzziehung, Fremdheit und Sprachigkeit bei Terézia Mora und Uljana Wolf
5. 1 Terézia Mora: das Minderheitendeutsch und die Autonomie der Literatur
5. 2 "Alles ist hier Grenze": Seltsame Materie
5. 3 "Gutes, altes Babylon": Alle Tage
5. 4 Uljana Wolf: Translinguale Lyrik und mehrsprachiges Gedicht
5. 5 Über die Grenze hinweg: kochanie ich habe brot gekauft
5. 6 Innerhalb der Grenze: falsche freunde
5. 7 Jenseits der Muttersprache: meine schönste lengevitch
5. 8 Terézia Mora und Uljana Wolf: Konstruktion und Dekonstruktion der Fremdheit
Schlussbemerkungen
Abstracts und Keywords
Literaturverzeichnis
Personenregister
Dank
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
03. Februar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
256
Reihe
Literarische Mehrsprachigkeit / Literary Multilingualism, 9
Autor/Autorin
Beatrice Occhini
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
398 g
Größe (L/B/H)
19/157/220 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783772087752
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Adelbert-von-Chamisso-Preis zwischen Inklusion und Exklusion" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.













