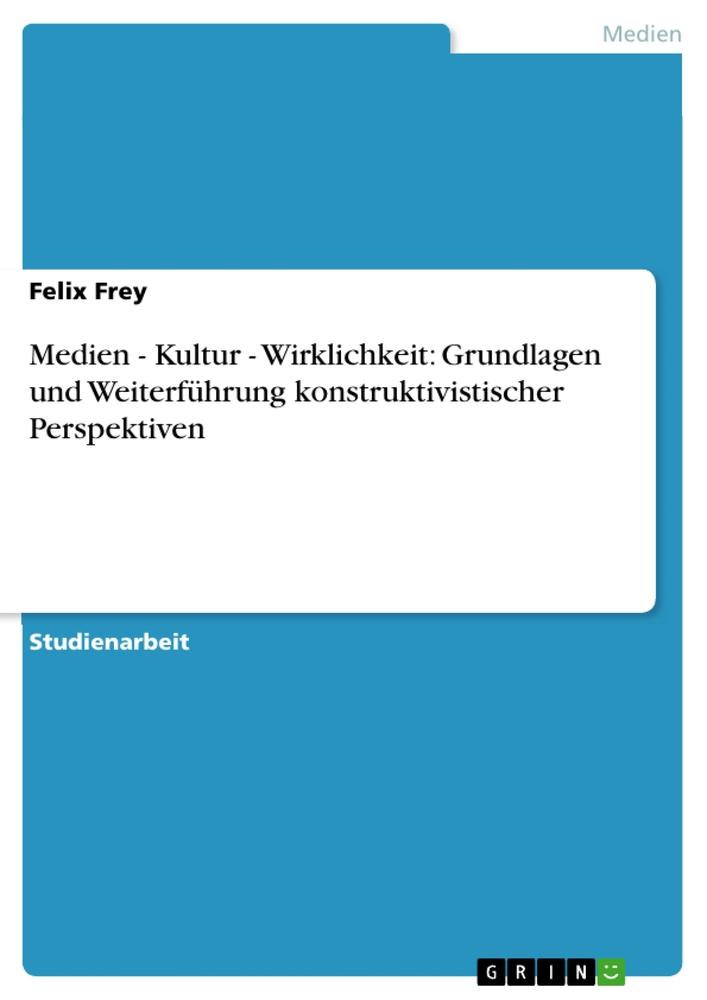
Zustellung: Di, 03.06. - Do, 05.06.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note: 1, 0, Universitä t Leipzig (Institut f. KMW), Veranstaltung: Einfü hrung in die Kommunikationswissenschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Jahrhunderten beschä ftigt sich die Epistemologie mit dem Problem des Verhä ltnisses von menschlicher Erkenntnis und Wirklichkeit. Dabei wurde zumeist als selbstverstä ndlich vorausgesetzt, dass eine solche Wirklichkeit unabhä ngig und auß erhalb des menschlichen Erkenntnisvermö gens existiert: Die Wirklichkeit ist gegeben und der Mensch kann auf dem steinigen Weg der Erkenntnis Zugang zu ihr erlangen, sie erkennen.
Diese Vorstellung der Erkennbarkeit der wirklichen , wahren Welt kritisiert der Konstruktivismus, indem er dem Menschen die Mö glichkeit des direkten Zugangs zur Wirklichkeit abspricht und Wirklichkeit bzw. das vermeintliche Wissen ü ber sie anstatt dessen als Ergebnis von unbewussten und unwillkü rlichen Konstruktionsprozessen im Individuum selbst und ausschließ lich dort - konzipiert. Der Mensch kann die Wirklichkeit also nicht erkennen, er bringt sie vielmehr selbst subjektiv konstruierend hervor.
Ganz neu ist diese Problematisierung von Wirklichkeit und Erkenntnis in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte nicht. Siegfried J. Schmidt zitiert Xenophanes und Demokrit ebenso, wie er eine Traditionslinie von Kant ü ber Nietzsche, Simmel, Cassirer u. a. zieht. Eine Neubegrü ndung erfuhren vorhandene konstruktivistische Ansä tze jedoch v. a. durch die Arbeiten des Psychologen Ernst von Glasersfeld, des Kybernetikers Heinz von Foerster, der Biologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela und im Anschluss an diese Gerhard Roth, deren neurophysiologische und kognitionswissenschaftliche Untersuchungen die bis dahin vorhandenen Ansä tze konstruktivistischer Argumentation in hohem Maß e plausibilisierten.
Die vorliegende Arbeit stellt zunä chst in Abschnitt 2 die Grundlagen der konstruktivistischen Auffassung von Wahrnehmung, Erkenntnis und Wirklichkeit vor. Dazu werden zunä chst relevante neurophysiologische Erkenntnisse und anschließ end die philosophisch-erkenntnistheoretische Argumentation beschrieben. Anschließ end wird der soziokulturelle Konstruktivismus von Siegfried J. Schmidt als Beispiel eines gleichermaß en evolvierenden wie elaborierten konstruktivistischen Versuchs, die Prinzipien des Konstruktivismus fü r i. w. S. gesellschaftliche Phä nomene fruchtbar zu machen, vorgestellt. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Ausfü hrungen auf den Aspekten Medien und Kultur, deren Beziehung zu beleuchten eine der wesentlichen Bestrebungen des Kommunikationswissenschaftlers Schmidt ist.
Diese Vorstellung der Erkennbarkeit der wirklichen , wahren Welt kritisiert der Konstruktivismus, indem er dem Menschen die Mö glichkeit des direkten Zugangs zur Wirklichkeit abspricht und Wirklichkeit bzw. das vermeintliche Wissen ü ber sie anstatt dessen als Ergebnis von unbewussten und unwillkü rlichen Konstruktionsprozessen im Individuum selbst und ausschließ lich dort - konzipiert. Der Mensch kann die Wirklichkeit also nicht erkennen, er bringt sie vielmehr selbst subjektiv konstruierend hervor.
Ganz neu ist diese Problematisierung von Wirklichkeit und Erkenntnis in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte nicht. Siegfried J. Schmidt zitiert Xenophanes und Demokrit ebenso, wie er eine Traditionslinie von Kant ü ber Nietzsche, Simmel, Cassirer u. a. zieht. Eine Neubegrü ndung erfuhren vorhandene konstruktivistische Ansä tze jedoch v. a. durch die Arbeiten des Psychologen Ernst von Glasersfeld, des Kybernetikers Heinz von Foerster, der Biologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela und im Anschluss an diese Gerhard Roth, deren neurophysiologische und kognitionswissenschaftliche Untersuchungen die bis dahin vorhandenen Ansä tze konstruktivistischer Argumentation in hohem Maß e plausibilisierten.
Die vorliegende Arbeit stellt zunä chst in Abschnitt 2 die Grundlagen der konstruktivistischen Auffassung von Wahrnehmung, Erkenntnis und Wirklichkeit vor. Dazu werden zunä chst relevante neurophysiologische Erkenntnisse und anschließ end die philosophisch-erkenntnistheoretische Argumentation beschrieben. Anschließ end wird der soziokulturelle Konstruktivismus von Siegfried J. Schmidt als Beispiel eines gleichermaß en evolvierenden wie elaborierten konstruktivistischen Versuchs, die Prinzipien des Konstruktivismus fü r i. w. S. gesellschaftliche Phä nomene fruchtbar zu machen, vorgestellt. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Ausfü hrungen auf den Aspekten Medien und Kultur, deren Beziehung zu beleuchten eine der wesentlichen Bestrebungen des Kommunikationswissenschaftlers Schmidt ist.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. September 2007
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
24
Autor/Autorin
Felix Frey
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
51 g
Größe (L/B/H)
210/148/3 mm
Sonstiges
Paperback
ISBN
9783638787260
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Medien - Kultur - Wirklichkeit: Grundlagen und Weiterführung konstruktivistischer Perspektiven" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









