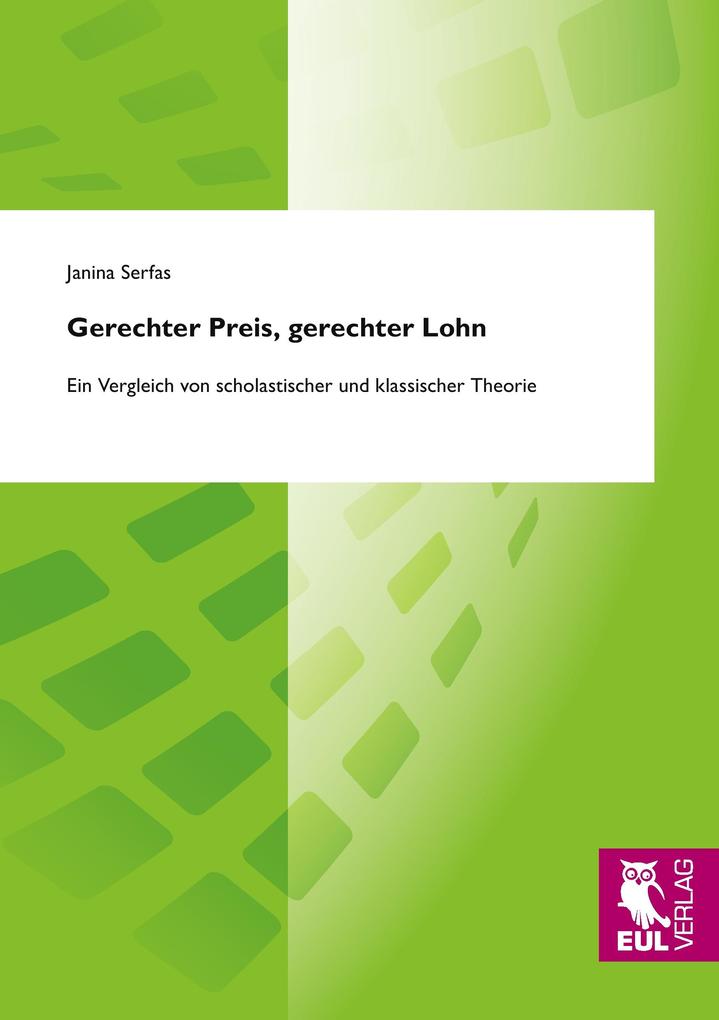
Zustellung: Di, 27.05. - Fr, 30.05.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Problem des gerechten Lohnes für geleistete Arbeit bzw. allgemein des gerechten Preises der Dinge ist von zeitloser Aktualität und hat über die Jahrhunderte, in denen sich die Wissenschaft damit beschäftigte, nichts von seiner Brisanz verloren.
Die scholastischen Gelehrten des Mittelalters, insbesondere Thomas von Aquin, entwickelten ausgehend von aristotelischen und christlichen Überlegungen die Lehre vom iustum pretium, dem gerechten Preis . Diese wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein, dem Zeitalter der spanischen Spätscholastik und des Ludwig Molina als einem ihrer Vertreter, immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiterentwickelt. In den darauffolgenden Jahrhunderten bildete sich, ausgehend von Adam Smith, ein neuer Ansatz einer Wirtschaftstheorie heraus, der heute als klassische Politische Ökonomie bezeichnet wird.
In dieser Arbeit wird ein Vergleich angestellt zwischen der scholastischen und der klassischen Theorie zum gerechten Preis bzw. gerechten Lohn. Kann der natürliche Preis oder der Marktpreis der klassischen Wirtschaftstheorie als gerecht im Sinne des scholastischen iustum pretium angesehen werden? Stellt die klassische Politische Ökonomie auf dem Weg zu unserer heutigen modernen Wirtschaftstheorie im Vergleich zur Scholastik eine konsequente Weiterentwicklung oder gar einen Rückschritt dar? Das gilt es im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen und eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Die vorliegende Publikation entstand als Masterarbeit am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Althammer.
Die scholastischen Gelehrten des Mittelalters, insbesondere Thomas von Aquin, entwickelten ausgehend von aristotelischen und christlichen Überlegungen die Lehre vom iustum pretium, dem gerechten Preis . Diese wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein, dem Zeitalter der spanischen Spätscholastik und des Ludwig Molina als einem ihrer Vertreter, immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiterentwickelt. In den darauffolgenden Jahrhunderten bildete sich, ausgehend von Adam Smith, ein neuer Ansatz einer Wirtschaftstheorie heraus, der heute als klassische Politische Ökonomie bezeichnet wird.
In dieser Arbeit wird ein Vergleich angestellt zwischen der scholastischen und der klassischen Theorie zum gerechten Preis bzw. gerechten Lohn. Kann der natürliche Preis oder der Marktpreis der klassischen Wirtschaftstheorie als gerecht im Sinne des scholastischen iustum pretium angesehen werden? Stellt die klassische Politische Ökonomie auf dem Weg zu unserer heutigen modernen Wirtschaftstheorie im Vergleich zur Scholastik eine konsequente Weiterentwicklung oder gar einen Rückschritt dar? Das gilt es im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen und eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Die vorliegende Publikation entstand als Masterarbeit am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Althammer.
Das Problem des gerechten Lohnes für geleistete Arbeit bzw. allgemein des gerechten Preises der Dinge ist von zeitloser Aktualität und hat über die Jahrhunderte, in denen sich die Wissenschaft damit beschäftigte, nichts von seiner Brisanz verloren.
Die scholastischen Gelehrten des Mittelalters, insbesondere Thomas von Aquin, entwickelten ausgehend von aristotelischen und christlichen Überlegungen die Lehre vom iustum pretium, dem gerechten Preis . Diese wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein, dem Zeitalter der spanischen Spätscholastik und des Ludwig Molina als einem ihrer Vertreter, immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiterentwickelt. In den darauffolgenden Jahrhunderten bildete sich, ausgehend von Adam Smith, ein neuer Ansatz einer Wirtschaftstheorie heraus, der heute als klassische Politische Ökonomie bezeichnet wird.
In dieser Arbeit wird ein Vergleich angestellt zwischen der scholastischen und der klassischen Theorie zum gerechten Preis bzw. gerechten Lohn. Kann der natürliche Preis oder der Marktpreis der klassischen Wirtschaftstheorie als gerecht im Sinne des scholastischen iustum pretium angesehen werden? Stellt die klassische Politische Ökonomie auf dem Weg zu unserer heutigen modernen Wirtschaftstheorie im Vergleich zur Scholastik eine konsequente Weiterentwicklung oder gar einen Rückschritt dar? Das gilt es im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen und eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Die vorliegende Publikation entstand als Masterarbeit am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Althammer.
Auszeichnung mit dem Alfons-Fleischmann-Preis am 20. November 2012.
Die scholastischen Gelehrten des Mittelalters, insbesondere Thomas von Aquin, entwickelten ausgehend von aristotelischen und christlichen Überlegungen die Lehre vom iustum pretium, dem gerechten Preis . Diese wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein, dem Zeitalter der spanischen Spätscholastik und des Ludwig Molina als einem ihrer Vertreter, immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiterentwickelt. In den darauffolgenden Jahrhunderten bildete sich, ausgehend von Adam Smith, ein neuer Ansatz einer Wirtschaftstheorie heraus, der heute als klassische Politische Ökonomie bezeichnet wird.
In dieser Arbeit wird ein Vergleich angestellt zwischen der scholastischen und der klassischen Theorie zum gerechten Preis bzw. gerechten Lohn. Kann der natürliche Preis oder der Marktpreis der klassischen Wirtschaftstheorie als gerecht im Sinne des scholastischen iustum pretium angesehen werden? Stellt die klassische Politische Ökonomie auf dem Weg zu unserer heutigen modernen Wirtschaftstheorie im Vergleich zur Scholastik eine konsequente Weiterentwicklung oder gar einen Rückschritt dar? Das gilt es im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen und eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Die vorliegende Publikation entstand als Masterarbeit am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Althammer.
Auszeichnung mit dem Alfons-Fleischmann-Preis am 20. November 2012.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einführung in die Thematik
2.1 Problem: Definition von Gerechtigkeit
2.2 Problem: Vom gerechten Preis zum gerechten Lohn?
3. Zur Scholastik
3.1 Vordenker der Scholastik
3.2 Die Hochscholastik des 13. Jahrhunderts: Objektive vs. subjektive Preistheorie
3.3 Die Scholastik des 14. und 15. Jahrhunderts: Zwischen Vertragsfreiheit und obrigkeitlicher Preisbindung
3.4 Die spanische Spätscholastik des 16. Jahrhunderts: Marktfreiheit bei Ludwig Molina
3.5 Fazit zur Scholastik
4. Zur Klassik
4.1 Vor Beginn der Klassik: Der Merkantilismus
4.2 Vordenker der Klassik: Die Physiokraten
4.3 Adam Smith
4.4 David Ricardo und Thomas Robert Malthus
4.5 John Stuart Mill
4.6 Fazit zur Klassik
5. Zum Vergleich zwischen Scholastik und Klassik
5.1 Die Klassik als konsequente Weiterentwicklung der Scholastik?
5.2 Die Ökonomie entwickelt sich zur eigenständigen Wissenschaft
6. Schlussbetrachtung
2. Einführung in die Thematik
2.1 Problem: Definition von Gerechtigkeit
2.2 Problem: Vom gerechten Preis zum gerechten Lohn?
3. Zur Scholastik
3.1 Vordenker der Scholastik
3.2 Die Hochscholastik des 13. Jahrhunderts: Objektive vs. subjektive Preistheorie
3.3 Die Scholastik des 14. und 15. Jahrhunderts: Zwischen Vertragsfreiheit und obrigkeitlicher Preisbindung
3.4 Die spanische Spätscholastik des 16. Jahrhunderts: Marktfreiheit bei Ludwig Molina
3.5 Fazit zur Scholastik
4. Zur Klassik
4.1 Vor Beginn der Klassik: Der Merkantilismus
4.2 Vordenker der Klassik: Die Physiokraten
4.3 Adam Smith
4.4 David Ricardo und Thomas Robert Malthus
4.5 John Stuart Mill
4.6 Fazit zur Klassik
5. Zum Vergleich zwischen Scholastik und Klassik
5.1 Die Klassik als konsequente Weiterentwicklung der Scholastik?
5.2 Die Ökonomie entwickelt sich zur eigenständigen Wissenschaft
6. Schlussbetrachtung
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. Oktober 2012
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
132
Autor/Autorin
Janina Serfas
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
202 g
Größe (L/B/H)
210/148/9 mm
ISBN
9783844101973
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gerechter Preis, gerechter Lohn" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









