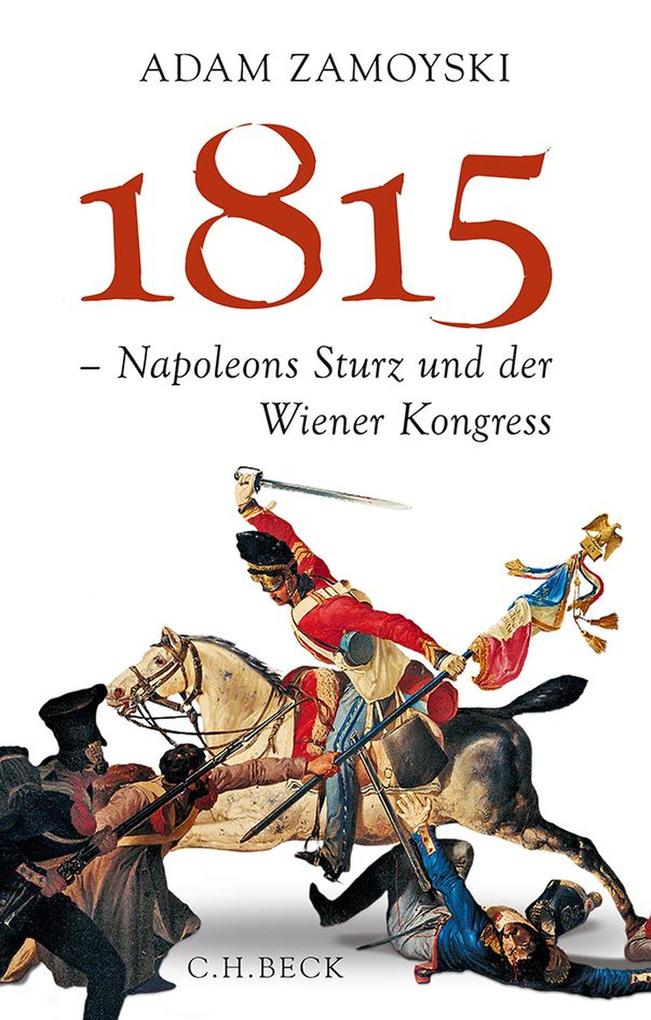Detailversessen, aber ohne große Linie
Nach '1812', das ich quasi in einem Stück gelesen habe, nahm ich mir vor einiger Zeit Zamoyskis Ausführungen zum Wiener Kongress vor. Das Buch heißt in der deutschen Übersetzung schlicht '1815' - wohl in Anlehnung an Zamoyskis Bestseller '1812'. In der englischen Originalausgabe kommt diese Jahreszahl im Titel gar nicht vor. Zu Recht, denn der Wiener Kongress begann schon in der zweiten Jahreshälfte von 1814 und seine Ergebnisse und Beschlüsse waren eigentlich zu Beginn des Jahres 1815 schon gefasst. Das kleine Intermezzo von Napoleons Hundert-Tage-Herrschaft und dessen endgültiger Niederlage bei Waterloo im Juni 1815 änderten nur wenig am Gesamtpaket. Wie schon in '1812' ist Zamoyskis Erzählstil lebendig und er vermag den an Geschichte interessierten Leser mitzunehmen in die ereignisreiche Epoche vor 200 Jahren, als Europa nach den Zerstörungen und Umwälzungen der Napoleonischen Kriege neu geordnet werden musste. Drahtzieher und Mastermind hinter diesen Bemühungen war Österreichs leitender Minister, Fürst Metternich, der Europas führende Politiker und Herrscher nach Wien zu einem Kongress einlud. Aber was in '1812' noch Spannung erzeugt, nämlich der streng chronologische Aufbau des Buches, wirkt in '1815' ermüdend und lässt die Handlung in viele tausend Facetten und Klein-Klein zerspringen. Der Autor hetzt durch offizielle Sitzungen, private Begegnungen, opulente Bälle und Ausflüge und umfangreiche Korrespondenzen, verliert dabei aber den roten Faden und lässt den geneigten Leser oft mehr verwirrt als informiert zurück. Man erfährt viel, eigentlich zu viel: über fein gesponnene Intrigen, Liebeleien, Frauen, die ihren Körper für politische Zwecke einsetzen, eitle und Testosteron gesteuerte Herrscher, Rachegelüste und wenige Stimmen der Vernunft. Die ganze Zeit über steht Metternichs großes Projekt auf der Kippe, Krieg zwischen den Teilnehmern kann jederzeit ausbrechen. Zu unterschiedlich sind Vorstellungen, Wünsche und gesellschaftliche Strukturen in den Siegermächten und jenen Staaten, die von Napoleon profitiert haben und keine ihrer Erwerbungen wieder rausrücken wollen. Es grenzt an ein Wunder, dass es nach monatelangen Verhandlungen doch zu einer Übereinkunft kommt. Napoleons Rückkehr an die Macht schweißt die Protagonisten dann noch einmal zusammen, aber nach Waterloo brechen die alten Grabenkämpfe wieder neu aus. Zamoyskis Fazit nach über 600 Seiten: der Wiener Kongress war nicht der große Wurf, als der er in der neueren Geschichtsschreibung dargestellt wurde. Frieden herrschte danach nur wenige Jahre, wenn auch der ganz große Konflikt erst 100 Jahre später ausbrach und Europas alte Ordnung zerstörte. Auch Zamoyskis Werk ist nicht der große Wurf. Am Ende ist man trotz der enormen Faktenhuberei enttäuscht und fragt sich, ob der Autor mit weniger Seiten nicht effektiver gewesen wäre.