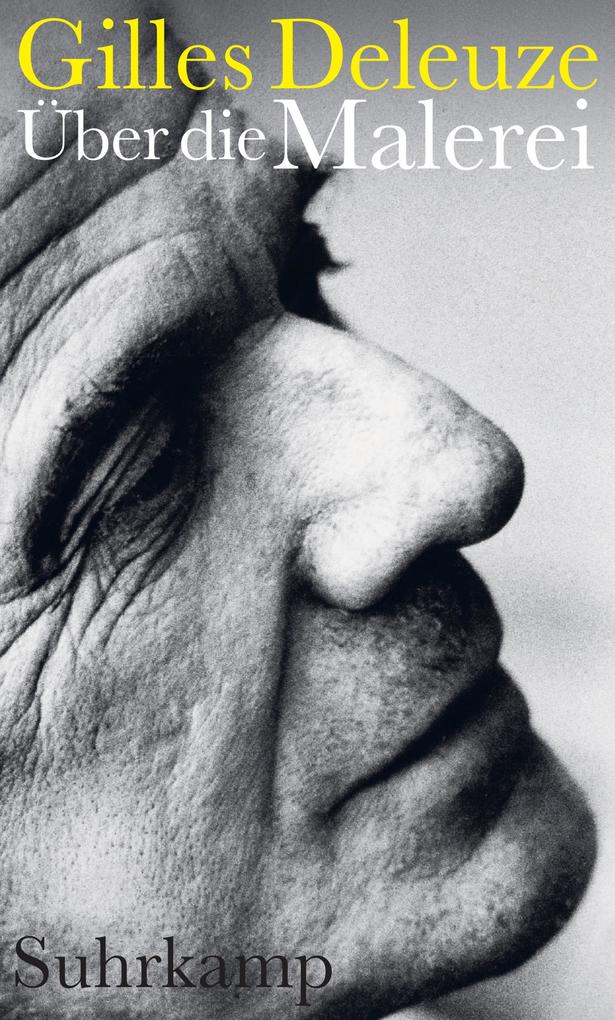
Welche Beziehung hat die Malerei zur Katastrophe, zum Chaos? Was ist eine Linie, eine Ebene, ein optischer Raum? Gibt es so etwas wie Farbregime? Von 1970 bis 1987 hielt Gilles Deleuze eine wöchentliche Vorlesung an der legendären Experimentaluniversität Vincennes, die immer wieder in die Schlagzeilen und in Konflikt mit der Staatsmacht geriet. Die acht Vorlesungen von 1981, die in diesem Band nun erstmals veröffentlicht werden, zeigen Deleuze in action. Sie sind ganz der Frage der Malerei und der schöpferischen Kraft gewidmet.
Das Nachdenken über Werke von Cézanne, van Gogh, Michelangelo, Turner, Klee, Pollock, Mondrian, Bacon, Delacroix, Gauguin oder Caravaggio sind für Deleuze der willkommene Anlass, wichtige philosophische Konzepte aufzurufen und zu durchdenken: Diagramm, Code, digital und analog, Modulation und andere mehr. Gemeinsam mit seinen Studierenden erneuert er diese Begriffe und stellt unser Verständnis der kreativen Tätigkeit der Kunstschaffenden auf den Kopf. Konkret und fröhlich wird Deleuze' Denken hier in seiner Bewegung nachvollziehbar und lebendig.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Jahrzehnte nach der aufregenden und leidenschaftlichen Atmosphäre der deleuzianischen Seminare ermöglicht es die schriftliche Fassung dieser Vorlesungen nun, sein Denken wieder mit Leben zu erfüllen. « Libération
»Die Vorlesungen haben einen Sound und bieten eine außergewöhnliche Materie in Bewegung , eine lebendige Textur. Nun liegt es an den Lesern und Leserinnen, die Schätze darin zu finden. « Télérama
». . . faszinierende Versuche, dem Geschehen auf der Leinwand etwas abzugewinnen, das diesem nicht theoretische Grundlagen verleiht, sondern die Momente von Katastrophe und Chaos, die er im Leben der Farben und Formen erkennt, für das eigene Denken fruchtbar zu machen. « Der Tagesspiegel
»Es ist ein Strudel an Gedanken, die Kunstgeschichte und Entwicklung der Philosophie zusammenzwingen und verdeutlichen, wie ich eines aus dem anderen ergeben und entwickeln kann. . . . Ein Buch für Neugierige, die es bleiben wollen. « Helmut Mauró, Süddeutsche Zeitung
». . . irre, wie gut [Deleuze] in die Gegenwart passt. « Ronald Düker, Philosophie Magazin
»[Deleuze'] Insistieren auf den eigenen Gesetzen der Malerei erscheint gegenwärtig als wichtiges Korrektiv zur Reduktion der Kunst auf abrufbare Inhalte. « Peter Geimer, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Über die Malerei erinnert die Kunstwelt daran, etablierte Praktiken und Standards wieder und wieder auf den Prüfstand zu stellen. « Ursula Grünenwald, Textor
 Besprechung vom 25.04.2025
Besprechung vom 25.04.2025
Zuerst müssen die Klischees beseitigt werden
Mit Deutungen einzelner Gemälde wollte er sich gar nicht erst aufhalten: Gilles Deleuzes 1981 gehaltene Vorlesungen über Malerei erinnern daran, dass Kunst eigenen Gesetzen folgt.
Für das Frühjahrssemester 1980 hatte Roland Barthes am Pariser Collège de France ein Seminar über Marcel Proust und die Fotografie angekündigt. Im Zentrum der Veranstaltung sollten sechzig historische Porträtaufnahmen stehen, die der Pariser Fotograf Paul Nadar von Persönlichkeiten aus dem Umfeld Prousts angefertigt hatte. Barthes verstand diese Bilder als historisches Archiv, das die imaginäre Welt des proustschen Romans mit Fragmenten des Realen durchsetzte. Von diesem "Labormaterial" hatte er beim französischen Kulturministerium Diapositive anfertigen lassen, die nach und nach an der Seminarwand erscheinen und die Seminarteilnehmer ihrer "toxischen Wirkung" aussetzen sollten.
Zu der Veranstaltung ist es nicht mehr gekommen, da Barthes im März 1980 an den Folgen eines Verkehrsunfalls starb. Ein Jahr später hielt am anderen Ende der Stadt Gilles Deleuze seine Vorlesungen über Malerei. Was den Umgang mit Bildern betrifft, könnten die Unterschiede zu Barthes' "Intoxikation" seiner Zuhörer nicht größer sein. "Reproduktionen mag ich euch nicht zeigen, denn dann hat man keine Lust mehr zu reden", bemerkt Deleuze am Beginn der Vorlesung. Als er in einer der Sitzungen dann doch einmal die Reproduktion eines Gemäldes von Francis Bacon herumgehen lässt, fügt er entschuldigend hinzu: "Ich schäme mich, euch Bilder zu zeigen, es sollte eigentlich eine bilderlose Vorlesung sein."
Für diese ikonische Abstinenz lassen sich verschiedene Gründe denken. Vielleicht fand Deleuze die ästhetische Qualität der Reproduktionen von Kunstwerken einfach zu schlecht. Vielleicht hätte ihn das unmittelbare Nebeneinander von Bild und Text aber auch bei der sprachlichen Entfaltung seiner Überlegungen gestört. Oder war Deleuze der Überzeugung, das Zeigen von Bildern sei in einer Philosophievorlesung prinzipiell nicht notwendig, da philosophische Begriffsbildung sich der unmittelbaren Anschauung entzieht? Über Malerei zu sprechen, bedeutet für Deleuze, "Begriffe zu bilden, die in direktem Bezug zur Malerei stehen, und zur Malerei allein". Für diese Begriffe liefern ihm einzelne Gemälde Anhaltspunkte, darüber hinaus geht es Deleuze aber um generalisierbare Aussagen zur Malerei, nicht um die Deutung einzelner Gemälde.
Auf diese Abstraktionsebene muss man sich einlassen, wenn man von der Lektüre der nun auch auf Deutsch erschienenen Vorlesungstexte etwas haben will. Nach der staatlich verordneten Schließung der Reformuniversität Vincennes, wo Deleuze seit 1970 unterrichtet hatte, war die Hochschule nach Saint Denis im Norden von Paris umgezogen. Die nun publizierte Fassung der Malerei-Vorlesungen beruht auf Tonbandmitschnitten, deren mündlichen Charakter der Herausgeber in der Transkription des Textes weitgehend beibehalten hat. Dass der Verlag für diese Form den reißerischen Slogan "Deleuze in action!" wählt, wäre nicht nötig gewesen.
Eine angemessene Beschreibung gibt der Autor selbst, wenn er bemerkt, ein Vortragender müsse im Reden "Augenblicke der Inspiration" herbeiführen und "sich selbst so weit bringen, mit Enthusiasmus sprechen zu können". Der Text macht anschaulich, wie Deleuze seine Thesen Schritt für Schritt entwickelt, was ihn inspiriert und begeistert, ärgert oder langweilt. Besonders einfältig findet er etwa die Vorstellung vom "weißen Blatt", das dem Künstler am Beginn seiner Arbeit entgegenstarre. Das Problem des Anfangs sei gerade nicht die Leere, sondern im Gegenteil der aufdringliche Überschuss an Banalitäten: Die Klischees sind schon da, noch bevor der erste Strich gezogen ist.
Die künstlerische Arbeit beginnt daher als Auslöschung der vielen falschen Bilder. Deleuze nennt dieses Anfangsstadium die "Katastrophe" des Malakts, einen "präpikturalen Moment des Chaos". Durch diese Katastrophe muss der Maler hindurchgehen, wenn sein Gemälde zum "geordneten Abgrund" werden soll. Scheitert diese Anstrengung, ist das Resultat bloßes Kunsthandwerk oder Dekoration.
Dass Deleuzes Vorlesungen nach den Worten des Herausgebers das "Laboratorium" künftiger Bücher bilden, hat den Nebeneffekt, dass Lesern der Bücher zentrale Inhalte der Vorlesungen bereits bekannt sind. So ist neben den Überlegungen zur "Katastrophe" des Malakts auch der zentrale Begriff des "Diagramms" bereits in der 1981 erschienenen Bacon-Monographie formuliert. Nach Deleuze stellt ein Maler nicht Formen, sondern Kräfte dar. Der Begriff des "Diagramms" bezeichnet dabei die "operative Instanz" dieser Kräfte, eine Art Matrix, die von Künstler zu Künstler variiert. Ihre Entfaltung entzieht sich der unmittelbaren Sichtbarkeit, denn für Deleuze bestimmt nicht das Auge den Malakt, sondern die vom Auge losgelöste Hand.
Den klassischen Gegensatz zwischen "figurativer" und "abstrakter" Malerei stellt Deleuze dabei grundsätzlich infrage. "Ähnlichkeit aufzulösen gehörte schon immer zum Akt des Malens." Auch die vormoderne Malerei beruhte bereits auf der Abstraktion vom Gegenstand. Einen wirklichen Bruch markiert für Deleuze erst die "konturlose Linie" Jackson Pollocks. In diametralem Gegensatz zum amerikanischen Kunstkritiker Clement Greenberg begreift Deleuze Pollocks Linien als eine rein manuelle Kunst, "Rebellion der Hand gegenüber dem Auge".
Es ist beinahe ein halbes Jahrhundert her, dass Deleuze seine Philosophie der Kunst formuliert hat. Seither haben sich die Erwartungen an bildende Kunst grundlegend verändert. Kunstwerke werden heute zunehmend als statement, Botschaft und Kommentar zu Fragen der Zeit betrachtet. Von dieser Erwartung an die diskursive Dienstleistung der Kunst ist Deleuze weit entfernt. Ob ein Gemälde ein Thema hat, interessiert ihn nicht - an Michelangelo bewundert er die "wunderbare Gleichgültigkeit" gegenüber dem Sujet. "Die Malerei schafft ihr eigenes Faktum."
Dieses Insistieren auf den eigenen Gesetzen der Malerei erscheint gegenwärtig als wichtiges Korrektiv zur Reduktion der Kunst auf abrufbare Inhalte. Die Lektüre der Vorlesungen wird dabei nicht zuletzt für Maler von Interesse sein, zentrale Bezugspunkte sind die Arbeitsnotizen Cézannes, Kandinskys und Klees. Der Erfahrung im Verfertigen der eigenen Gedanken entspricht bei Deleuze eine hohe Aufmerksamkeit für den Entstehungsprozess eines Gemäldes. Nicht weniger entscheidend als das sichtbare Bild ist der vorangegangene Akt seiner Herstellung, sein allmähliches Hervortreten aus der "Katastrophe". PETER GEIMER
Gilles Deleuze: "Über die Malerei". Vorlesungen März-Juni 1981.
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 432 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Über die Malerei" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









