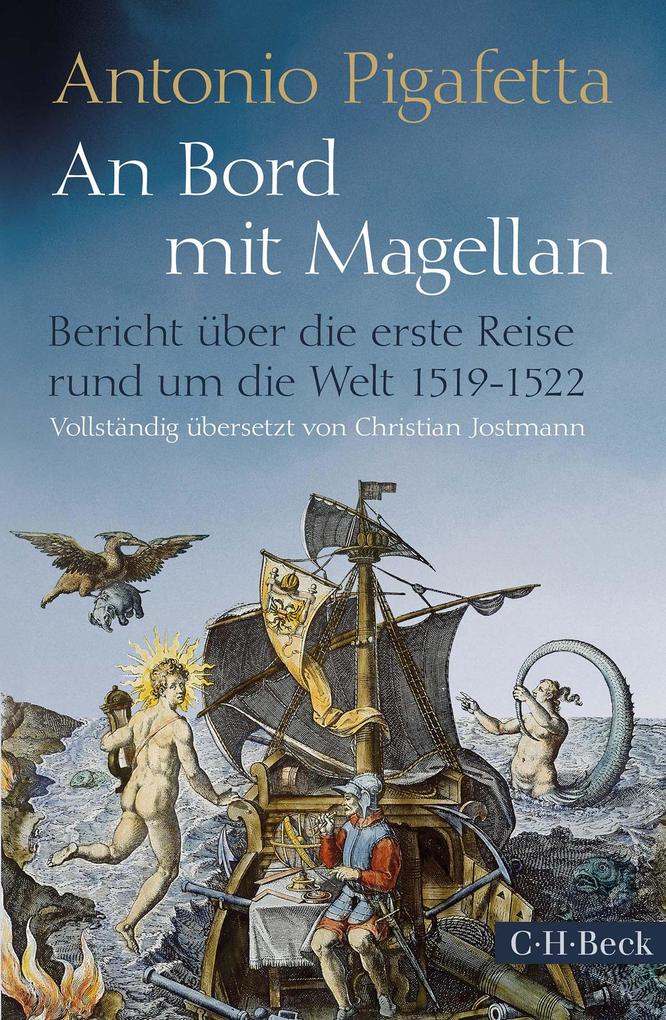
Ferdinand Magellan stach im Auftrag der spanischen Krone in See, um eine Westroute zu den sagenhaften Gewürzinseln, den Molukken, zu finden. Mit an Bord war Antonio Pigafetta, der während der dreijährigen Reise fleißig Tagebuch führte. Stoff dafür gab es mehr als genug. Eindrücklich schildert er den entbehrungsreichen Alltag auf den Schiffen, all die Gefahren und Abenteuer sowie den Kampf gegen die Elemente, den die Besatzung durchstehen musste. Vor allem aber erzählt er von seinen zahlreichen Begegnungen mit den Menschen anderer Kulturen: den Tupi im heutigen Brasilien, den Tehuelche Patagoniens, den Chamorros auf Guam, den Visayern auf den heutigen Philippinen, den Einwohnern Mindanaos, Borneos, der Molukken und Timors. Mit geradezu ethnologischem Blick und erstaunlich einfühlsam beobachtete Pigafetta genau, was er sah, stellte mit Hilfe von Dolmetschern Fragen und lernte sogar selbst die Sprachen der Indigenen. Sein Reisebericht ist geprägt von einem neugierigen Blick auf das Fremde und zeichnet das eindrucksvolle Bild einer bunten, wilden, offenen und unbegreiflich weiten Welt.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 03.05.2025
Besprechung vom 03.05.2025
Agenten des Imperiums
Auf der Suche nach Gewürzen, Gold und Sklaven: Antonio Pigafettas Bericht von der ersten Umsegelung der Welt erscheint erstmals vollständig auf Deutsch.
Echte Entdecker - Pioniere - haben keine Ahnung, was als Nächstes kommt. Wie auch, sie sind ja die Ersten. Und ihre Erkundungsfahrten sind streng geheim, im Namen des Imperiums. Erst wenn sie erfolgreich zurückgekehrt sind, wird ihr Unternehmen triumphierend verkündet. Gescheiterte Erkundungsfahrten dagegen verschwinden in tiefen Schubladen und mit ihnen ihre Kommandanten. Oder haben Sie schon einmal etwas von Tomé Pires gehört?
Fernando de Magallanes dagegen und sein Chronist Antonio Pigafetta sind als heroische Seefahrer berühmt. Pigafettas Bericht der ersten Weltumsegelung von 1519 bis 1521 ist jetzt erstmals vollständig auf Deutsch erschienen. Er bietet aufregenden Lesestoff - wenn auch nicht unbedingt als Zeugnis eines "erstaunlich einfühlsamen" Beobachters oder "Humanisten", wie die Verlagsankündigung und der Herausgeber Christian Jostmann den Autor charakterisieren. Pigafetta war im Dienst des spanischen Imperiums unterwegs, auf der Suche nach Gewürzen, Gold und Sklaven, dem Erdöl des sechzehnten Jahrhunderts. Sein Held und Vorgesetzter Magellan war nicht aufgebrochen, um die Welt zu umsegeln, sondern um eine Route zu den begehrten Gewürzinseln in Südostasien zu finden, die nicht durch das Territorium des Rivalen Portugal verlief.
Gemeinsam war den spanischen und portugiesischen Unternehmungen der Einsatz von Arbeitsmigranten. Schon für die Expeditionen der Portugiesen am Beginn des sechzehnten Jahrhunderts waren Kämpfer aus ganz Europa engagiert worden, unter anderem aus Tirol und aus den Niederlanden. Der Lotse, der Vasco da Gamas berühmte Überfahrt von Afrika nach Indien überhaupt erst ermöglicht hatte, hieß Ahmed ibn Madjid und stammte aus Oman. Bei den Spaniern war das genauso. Columbus war Genuese; Magellan hieß eigentlich Fernão de Magalhães und war Portugiese; Pigafetta stammte aus dem oberitalienischen Vicenza.
Sein Bericht gibt drastische Einblicke in die Mischung von Improvisation, Gewalt, Gier und schierem Glück, die für eine solche Expedition rund um die Welt vor fünf Jahrhunderten notwendig war. Alle nautischen Berechnungen waren Geheimsache. Heftige Konflikte brachen zwischen den Schiffsführern ebenso auf wie zwischen ihnen und der Mannschaft, bis zu Befehlsverweigerung, offener Meuterei und Desertion. Pigafetta beschreibt die Indigenen in Brasilien, Patagonien und auf den südostasiatischen Archipelen mit drastischem Vokabular, als "schwarz, nackt und unbehaart" und wie aus der antiken Unterwelt, andere als "Riesen", tätowiert und mit durchbohrten Ohren; oder als "formidable Krieger und Bogenschützen", die sich nur von rohem Menschenherz ernährten, "mit Orangen- und Zitronensaft".
Pigafetta beschreibt Ananas - "sehr süße Pinienzapfen, wahrhaftig die herrlichste Frucht, die es gibt!" - und andere essbare Pflanzen, war aber ahnungslos: Für die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Informationen waren die Seefahrer von der lokalen Bevölkerung abhängig. Deren angebliche Bekehrung zum Christentum und Unterwerfung unter die spanische Krone konnte auch abrupt in gewalttätige Konfrontationen umschlagen. Bei einer solchen Kraftprobe auf den heutigen Philippinen fand der Generalkapitän Magellan 1521 den Tod. Ihn stilisiert Pigafetta nachträglich zum edelmütigen christlichen Helden, während er den Namen seines Nachfolgers, der ihn immerhin heil nach Spanien zurückgebracht hat, kein einziges Mal nennt.
Je näher die schrumpfende Expeditionsflotte ihrem Ziel kam, den Inseln, auf denen Nelken und Muskat wachsen, desto brutaler ging sie vor. "Wir brannten ein Dorf nieder, weil es dem König und uns nicht gehorchen wollte." Eine Dschunke vor Palawan, die das Zeichen zum Einholen der Segel nicht befolgt, wird geentert; die Besatzung muss sich mit der Lieferung von Reis, Schweinen, Ziegen und Hühnern freikaufen. Vor Mindanao: "Um Neues über Maluco (die Molukken) zu erfahren, kaperten wir mit Gewalt ein Boot und töteten sieben Männer." Je weiter die Agenten des spanischen Königs nach Westen vorstießen, desto häufiger begegneten sie den Zeichen konkurrierender Imperien. Pigafetta berichtet von Porzellan, Seidenstoffen und Gongs aus China ebenso wie von schwer bewaffneten portugiesischen Schiffen, die von dem 1511 eroberten Malakka aufgebrochen seien, um die Spanier abzufangen. Am Schluss bringt nicht westliche Navigationskunst, sondern ein gekidnappter indonesischer Lotse die Flotte an ihr Ziel. Die vermeintlich neu entdeckte Welt in Übersee ist regiert von Spionage, Überläufern und Verrat, und die Spanier versuchen zunehmend verzweifelt, ihre randvoll mit kostbaren Gewürzen überladenen Schiffe gegen die Bohrmuscheln abzudichten, die sie von unten zerfressen.
Ein Imperium, macht Pigafettas Bericht deutlich, ist vor allem eines, nämlich eine Erzählform. Ein Imperium darf alle Grenzen überschreiten, unter Berufung auf seine göttliche Mission, es macht deshalb nie Fehler und kennt nur Erfolge - auch wenn nach 1082 Tagen Reise nur ein einziges der ursprünglich fünf Schiffe wieder in Spanien anlegte, auf ihm achtzehn Überlebende von ursprünglich mehr als 240 Besatzungsmitgliedern. Siebzehn weitere und mehrere entführte Indios gerieten in portugiesische Gefangenschaft.
Diese raue Wirklichkeit von globalem Handelskrieg und Menschenraub lässt sich aus Pigafetta nur teilweise erschließen. Sein ursprüngliches Reisetagebuch, dem spanischen König übergeben, ist als Geheimsache in den spanischen Archiven verschwunden. Der uns heute bekannte Text ist eine nachträglich stark bearbeitete Version, angereichert mit manipulierten nautischen Angaben und Plagiaten aus älteren portugiesischen Reiseberichten und dem Großmeister des Malteserordens gewidmet; denn das war Pigafettas nächster Karriereschritt, im Krieg gegen ein weiteres Imperium, das osmanische. Dazu passt auch seine verdächtig ausführliche Beschreibung der Anstrengungen der Flotte, fremde Völker zum Christentum zu bekehren, kombiniert mit Beschreibungen von Partys an exotischen Herrscherhöfen mit Palmwein und nackten Tänzerinnen und der Tapferkeit Magellans als christlichem Märtyrer.
Pigafettas Listen von Wörtern aus den Sprachen der Tupi in Brasilien, der Tehuelche Patagoniens, der Chamorros auf Guam und der Bewohner der Philippinen und des heutigen Indonesien, bei Jostmann erstmals auf Deutsch abgedruckt, kann man als Belege für seinen "geradezu ethnologischen Blick" auffassen. Am meisten sagen sie aber über ihn selbst als Agenten des Imperiums aus - er notiert die Vokabel für Waffen, für weibliche und männliche Geschlechtsteile und für die Syphilis (ein europäischer Import aus der Karibik), für kostbare Gewürze, Duftstoffe und Sklaven. Auf den Molukken kommen noch die Windrichtungen dazu und die Zahlen, von eins bis einer Million.
Denn jedes Imperium denkt groß. Jedes Imperium ist davon überzeugt, dass es einzigartig sei, auf Erfolgskurs und allen anderen überlegen. Jedes Imperium beruht auf Bluff. Manchmal wirkt er: Im selben Jahr 1519, in dem Pigafetta und Magellan aufbrachen, hatte sich auch Hernan Cortés auf den Weg nach Mexiko gemacht. Ein portugiesischer Kollege all dieser Entdecker, Tomé Pires, hatte die große militärische Expedition nach Malakka in den Jahren zuvor als Schreiber mitgemacht und seine Beobachtungen in einer dicken "Suma Oriental" festgehalten. 1519 machte er sich erneut auf den Weg, zum Hof des Kaisers von China. Dort wurden er und seine Begleiter aber nicht als Gesandte einer Großmacht behandelt, sondern als illegale Einwanderer und Piraten verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Pires hat möglicherweise überlebt, konnte aber China nie mehr verlassen. Ist er eigentlich auch ein Entdecker? VALENTIN GROEBNER
Antonio Pigafetta: "An Bord mit Magellan". Bericht über die erste Reise rund um die Welt 1519-1522.
Aus dem Spanischen von Christian Jostmann. Verlag C. H. Beck, München 2025.
221 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








