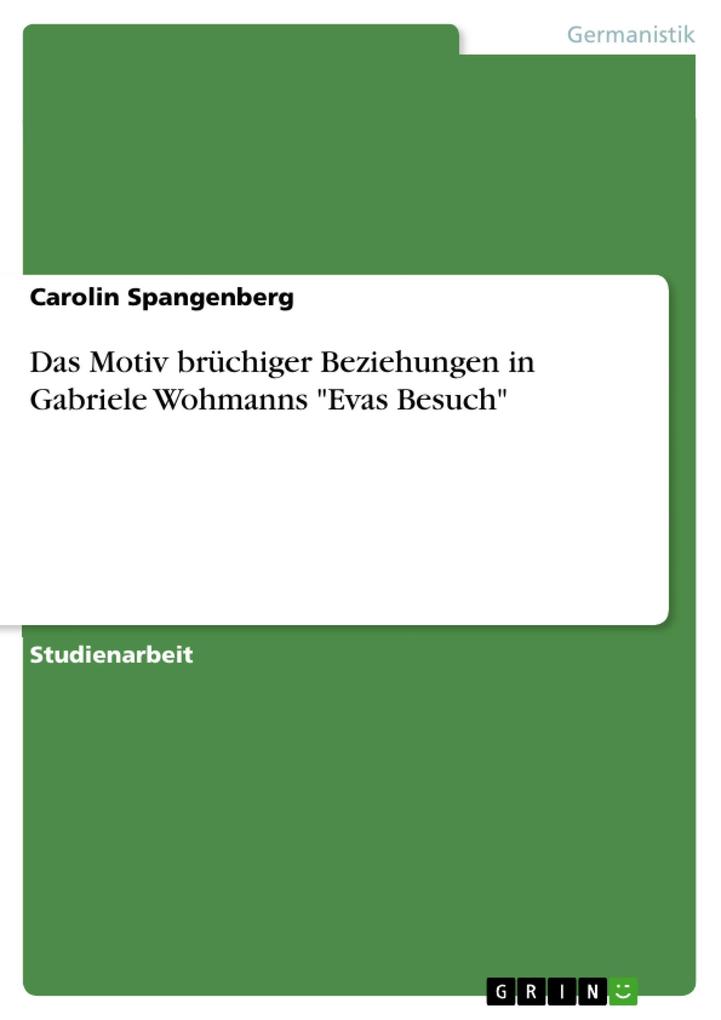
Sofort lieferbar (Download)
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2, 0, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Philosophische Fakultät), Veranstaltung: Die Gruppe 47. Zur Literatur der Nachkriegszeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Ich habe mich an dieser Stelle für ein Vorwort entschieden, um hier einige wichtige
biographischen Lebensdaten und -abschnitte aufzuzeigen, die für die Strukturgebundene
Analyse des ausgewählten Textes nicht von Besonderheit wären, allerdings das
Verständnis meiner Wahl für Gabriele Wohmann und gleichzeitig das der Intention und
Thematik ihrer Texte aufzeigt und vertieft.
Gabriele Wohmann wurde am 21. 05. 1932 in Darmstadt als Tochter von Luise und Paul
Guyot geboren. Sie studierte Neuere Sprachen, Musikwissenschaften und Philosophie
und nach ihrer Heirat 1953 fand ihr Gelerntes im Schreiben Anklang und seit 1956 ist sie
als ungemein produktive Schriftstellerin tätig.
" Schreiben ist eine Krankheit, Nichtschreiben auch. Das Tun ist ein Zwang, das Nichttun
auch."1
Gabriele Wohmann bezeichnet sich selbst als " Graphomanin" und lebt mit ihrer
Schreibkrankheit, akzeptiert sie als bestimmtes Element ihres sonst normal verlaufenden
Lebens. Sie wehrt sich gegen Gewöhnung, gegen das Sich- Einrichten im Alltag, lebt aber
demgegenüber ganz bewusst in festen Bahnen, braucht Gewissheit und selbst
geschaffenen Rhythmus als Fundament ihrer Arbeit. "Ich bin kein Fabulierer, keine
Person- und Stofferfinder, ich habe den Authentitätstick, also werde ich beim Schreiben
auch immer so ziemlich in meiner eigenen Nähe bleiben."2 Diese Selbstaussage fordert
dazu auf, das Leben der Autorin, ihre Herkunft und Bildung, ihr soziales Umfeld, ihre
Gewohnheiten und Intentionen als Grundsubstanz für ihr Schreiben ernst zu nehmen.
Sie selbst versichert: "Ganz ohne das Ausgehen von eigenen Erfahrungen oder
Empfindungen kann ich überhaupt nicht schreiben. Ich berichte, zwar in einer anderen
Person steckend, von Erfahrungen, die ich gemacht haben könnte."3
Ihre Texte handeln vom Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, nicht gelebt zu haben, vom
Aneinander vorbeireden, von Abgrenzungen und Klammern, von Enttäuschungen und
moralischem Druck, der Angst vor Einsamkeit, vom fatalen Tröster Alkohol und all den
Unzulänglichkeiten, die das Durchleben des Alltags begleiten. Sie seziert immer neu knapp und doch detailliert menschliches (Nicht-) Miteinander, ausgehend von kleinen
banalen Begebenheiten, hinter denen persönliche Tragödien stecken können. [. . .]
1 Siblewski, 1982, S. 8
2 Häntzschel, 1982, S. 7
3 Häntzschel, 1982, S. 7
biographischen Lebensdaten und -abschnitte aufzuzeigen, die für die Strukturgebundene
Analyse des ausgewählten Textes nicht von Besonderheit wären, allerdings das
Verständnis meiner Wahl für Gabriele Wohmann und gleichzeitig das der Intention und
Thematik ihrer Texte aufzeigt und vertieft.
Gabriele Wohmann wurde am 21. 05. 1932 in Darmstadt als Tochter von Luise und Paul
Guyot geboren. Sie studierte Neuere Sprachen, Musikwissenschaften und Philosophie
und nach ihrer Heirat 1953 fand ihr Gelerntes im Schreiben Anklang und seit 1956 ist sie
als ungemein produktive Schriftstellerin tätig.
" Schreiben ist eine Krankheit, Nichtschreiben auch. Das Tun ist ein Zwang, das Nichttun
auch."1
Gabriele Wohmann bezeichnet sich selbst als " Graphomanin" und lebt mit ihrer
Schreibkrankheit, akzeptiert sie als bestimmtes Element ihres sonst normal verlaufenden
Lebens. Sie wehrt sich gegen Gewöhnung, gegen das Sich- Einrichten im Alltag, lebt aber
demgegenüber ganz bewusst in festen Bahnen, braucht Gewissheit und selbst
geschaffenen Rhythmus als Fundament ihrer Arbeit. "Ich bin kein Fabulierer, keine
Person- und Stofferfinder, ich habe den Authentitätstick, also werde ich beim Schreiben
auch immer so ziemlich in meiner eigenen Nähe bleiben."2 Diese Selbstaussage fordert
dazu auf, das Leben der Autorin, ihre Herkunft und Bildung, ihr soziales Umfeld, ihre
Gewohnheiten und Intentionen als Grundsubstanz für ihr Schreiben ernst zu nehmen.
Sie selbst versichert: "Ganz ohne das Ausgehen von eigenen Erfahrungen oder
Empfindungen kann ich überhaupt nicht schreiben. Ich berichte, zwar in einer anderen
Person steckend, von Erfahrungen, die ich gemacht haben könnte."3
Ihre Texte handeln vom Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, nicht gelebt zu haben, vom
Aneinander vorbeireden, von Abgrenzungen und Klammern, von Enttäuschungen und
moralischem Druck, der Angst vor Einsamkeit, vom fatalen Tröster Alkohol und all den
Unzulänglichkeiten, die das Durchleben des Alltags begleiten. Sie seziert immer neu knapp und doch detailliert menschliches (Nicht-) Miteinander, ausgehend von kleinen
banalen Begebenheiten, hinter denen persönliche Tragödien stecken können. [. . .]
1 Siblewski, 1982, S. 8
2 Häntzschel, 1982, S. 7
3 Häntzschel, 1982, S. 7
Produktdetails
Erscheinungsdatum
05. März 2003
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
15
Dateigröße
0,38 MB
Autor/Autorin
Carolin Spangenberg
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783638174992
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gabriele Wohmann: Evas Besuch - Interpretation der Kurzgeschichte unter Berücksichtigung des Motivs Brüchigkeit und Fragwürdigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Bezug zur Gruppe 47" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









