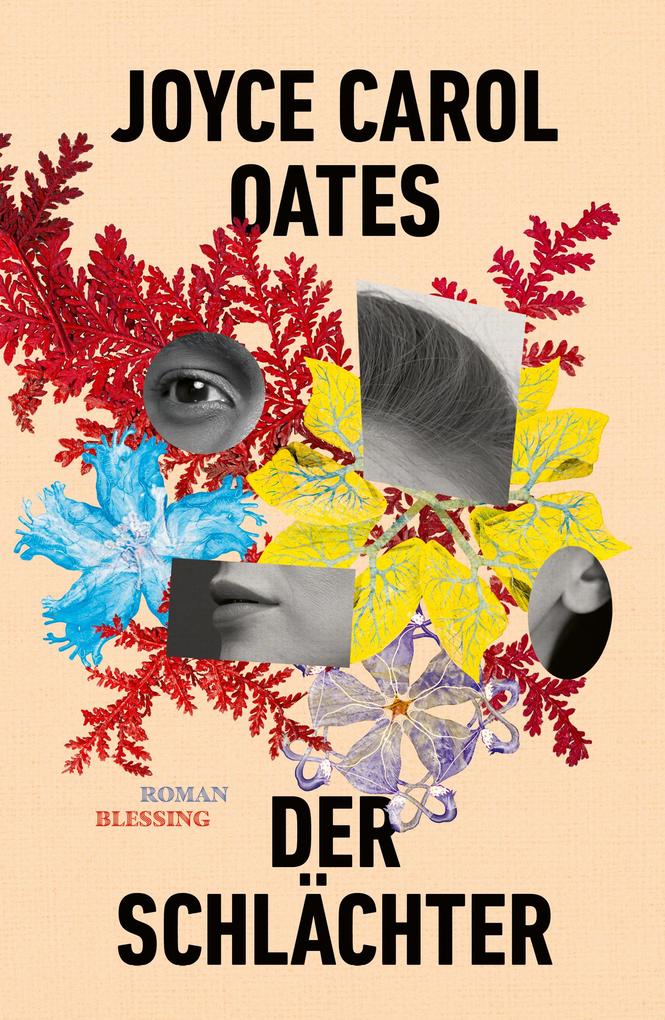
Sofort lieferbar (Download)
Düster wie Bram Stoker, feministisch wie Margaret Atwood: Der neue Roman von einer der bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart
Pennsylvania, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dr. Silas Weir ist ein junger Arzt aus gutem Hause, doch ohne Charisma und Talent. Beim Anblick von Blut wird er ohnmächtig, Frauenkörper stoßen ihn ab. Um seinen strengen Vater zu beeindrucken, versucht er, auf unorthodoxe Weise als Chirurg voranzukommen, was ihn gesellschaftlich isoliert. Dann wird er durch eine Aneinanderreihung von Zufällen Direktor der Staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke in New Jersey. Hier beginnt Weir, vorgeblich im Dienste des medizinischen Fortschritts, Experimente an den meist schwarzen und irischen Insassinnen durchzuführen. Bald gilt er als führender, wenn auch berüchtigter Experte für Gynäkologie und Psychiatrie. Bis eine junge Dienstmagd zu seiner Obsession, seinem wichtigsten Versuchsobjekt und schließlich zu seinem Verhängnis wird.
Pennsylvania, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dr. Silas Weir ist ein junger Arzt aus gutem Hause, doch ohne Charisma und Talent. Beim Anblick von Blut wird er ohnmächtig, Frauenkörper stoßen ihn ab. Um seinen strengen Vater zu beeindrucken, versucht er, auf unorthodoxe Weise als Chirurg voranzukommen, was ihn gesellschaftlich isoliert. Dann wird er durch eine Aneinanderreihung von Zufällen Direktor der Staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke in New Jersey. Hier beginnt Weir, vorgeblich im Dienste des medizinischen Fortschritts, Experimente an den meist schwarzen und irischen Insassinnen durchzuführen. Bald gilt er als führender, wenn auch berüchtigter Experte für Gynäkologie und Psychiatrie. Bis eine junge Dienstmagd zu seiner Obsession, seinem wichtigsten Versuchsobjekt und schließlich zu seinem Verhängnis wird.
»Oates' Anklage gegen die physische und psychische Behandlung von Frauen durch das medizinische Establishment ist eine fesselnde, anspruchsvolle Lektüre. « Publishers Weekly
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Mai 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
448
Dateigröße
4,04 MB
Autor/Autorin
Joyce Carol Oates
Übersetzung
Silvia Morawetz
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783641330637
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Der Roman, der auf Tatsachen beruht, ist ein, ja, gewaltiger feministischer Schocker. « Focus
»Ihr ist mit 'Der Schlächter' ein feministischer Horrorroman gelungen, dessen Lektüre noch lange nachhallt. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Meisterhafter Mix aus Fakten und Fiktion. « Für Sie
»Oates ist eine der wichtigsten US-Autorinnen der Gegenwart und zeigt das auch mit ihrem meisterhaften Werk, das lustvoll den viktorianischen Stil zitiert und das man am liebsten in einem Rutsch lesen möchte. . . « Nürnberger Nachrichten
»Mix aus Fakten und Fiktion, der zugleich fesselt und erschüttert und einmal mehr das große Können der US-Schriftstellerin Oates beweist. « Hör zu
»Ihr ist mit 'Der Schlächter' ein feministischer Horrorroman gelungen, dessen Lektüre noch lange nachhallt. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Meisterhafter Mix aus Fakten und Fiktion. « Für Sie
»Oates ist eine der wichtigsten US-Autorinnen der Gegenwart und zeigt das auch mit ihrem meisterhaften Werk, das lustvoll den viktorianischen Stil zitiert und das man am liebsten in einem Rutsch lesen möchte. . . « Nürnberger Nachrichten
»Mix aus Fakten und Fiktion, der zugleich fesselt und erschüttert und einmal mehr das große Können der US-Schriftstellerin Oates beweist. « Hör zu
 Besprechung vom 25.06.2025
Besprechung vom 25.06.2025
Lässt sich stellvertretend Rache nehmen?
Historischer Roman II: Die Schrecken der amerikanischen Medizingeschichte mit Joyce Carol Oates' feministischem Epos "Der Schlächter"
Dass es mit Silas Aloysius Weir kein gutes Ende nehmen wird, erfährt der Leser gleich zu Beginn: ". . . wir hatten noch nicht angefangen ihn zu ermorden, da war es schon vorbei." Der Arzt war "auf den schmutzigen Boden geplumpst wie ein von Gott persönlich gefälltes blödes Tier" und wand sich "jämmerlich in seinem eigenen Blut". Getrieben von "seliger Wut" fallen die entrechteten, versklavten, gemarterten, vergewaltigten Frauen über ihren Peiniger her.
Die amerikanische Autorin Joyce Carol Oates, gerade 87 Jahre alt geworden und seit vielen Jahren als Kandidatin für den Literaturnobelpreis gehandelt, nimmt, so scheint es, auf den ersten Seiten ihres Romans "Der Schlächter" (im Original "The Butcher", 2024) Rache. Stellvertretend für all die im Namen von Medizin und Wissenschaft gemarterten Frauen bohrt sie das Messer in das blasse Fleisch des Arztes - "Halleluja!".
Ihr jüngstes Werk ist ein Blick in die Abgründe der amerikanischen Medizingeschichte und Geschichte der Sklaverei, der den Leser umso mehr schwindeln lässt, da keine der grausamen Schilderungen der Phantasie der Autorin entsprungen ist, sondern den Köpfen der führenden Mediziner jener Zeit. Einer Zeit, in der Frauen mit der Diagnose "Hysterie" stigmatisiert, entrechtet und eingesperrt wurden.
Für ihren Roman, den sie als postum erschienene Autobiographie von Dr. Silas Aloysius Weir, Leiter der "Heilanstalt für weibliche Geisteskranke" in Trenton, New Jersey, angelegt und um Berichte dreier Frauen ergänzt hat, verschmilzt Oates gleich mehrere historische Figuren: Als Hauptquelle dient die Autobiographie des "Vaters der modernen Gynäkologie", J. Marion Sims (1813 bis 1883). Sims wird nicht nur die Erfindung des heute noch verwendeten Spekulums zugeschrieben und die erste erfolgreiche Operation von Fisteln - schmerzhaften Geburtsverletzungen, die zu Inkontinenz und früher, wie noch heute, zum Ausstoß der Betroffenen aus der Gemeinschaft führten -, Sims übte für seine medizinische Forschung auch vor allem an schwarzen, versklavten Frauen. Nicht mehr arbeitsfähig und damit "wertlos" waren sie ihm von ihren Besitzern überlassen worden. An mehr als zehn Frauen soll Sims medizinische Experimente durchgeführt haben.
Die siebzehnjährige Anarcha (um 1828 bis 1869), deren Name zu den wenigen gehört, die in seinen Aufzeichnungen überliefert wurden, und die Oates als Vorbild für die irische Waise Birgit Kinealy dient, musste allein mehr als dreißig Operationen über sich ergehen lassen - meist ohne Anästhesie, denn wie viele seiner Zeitgenossen war Sims davon überzeugt, dass Schwarze weniger Schmerz empfinden.
Ihre "gespenstische" und "engelsgleiche" Schönheit ist es auch, die den verliebten Weir in Oates' Roman überhaupt erst dazu bringt, ihre Fistel heilen zu wollen. Ist der aufstrebende Arzt doch zutiefst angeekelt von dem weiblichen Körper, den "widerwärtigen" weiblichen Geschlechtsorganen, der Vagina, dem "Höllenloch aus Schmutz und Verderbtheit" - und lässt sich mit der Behandlung von "Frauenleiden" doch schwer Anerkennung gewinnen.
Benannt hat Oates ihre Romanfigur nach Silas Weir Mitchell (1829 bis 1914), dem "Vater der Nervenheilkunde", der "Frauenleiden" wie Depressionen und "Hysterie" gerne mit der quälenden "Ruhe-Kur" behandelte, bei der Patientinnen zum Teil über Monate ihr Bett nicht verlassen durften und die eine der Patientinnen in Oates' Roman in beklemmenden Worten beschreibt.
Oates' Romanfigur ist weder von Grund auf böse noch ein Sadist. Autoritätshörig und geprägt von misogynen, rassistischen Vorstellungen, ist der talentlose Arzt vielmehr nicht in der Lage, die Überzeugungen seiner Zeit infrage zu stellen. Das Leid der Frauen ist für ihn notwendiges Übel, das nur vordergründig dem wissenschaftlichen Fortschritt dient.
Gekränkt von der Verachtung seines Vaters und der fehlenden Anerkennung durch die medizinische Fachwelt, für die die Beschäftigung mit "Frauenleiden" keinen Wert hat, strebt er nach nichts mehr als nach Applaus, einem "Platz im Pantheon der Medizin" - und geht dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen.
Nicht einmal der Tod eines Kindes, an dem er zu Beginn seiner Laufbahn herumexperimentiert, kann seinen Aufstieg zum Experten für Gynäkologie und Psychiatrie stoppen. Stammt das zweijährige Mädchen doch von "Tagelöhnern & Taugenichtsen" und er aus einer einflussreichen Familie.
Seine familiären Beziehungen sind es auch, die ihm eine Anstellung in der Klinik in Trenton verschaffen, in der er später als Direktor, ungestört an den meist irischen und schwarzen Insassinnen, experimentiert.
Wie Henry Cotton (1876 bis 1933), der das New Jersey State Hospital in Trenton von 1907 bis 1930 leitete und als weitere Inspirationsquelle für Oates' Roman diente, ist Weir davon überzeugt, dass psychiatrische Erkrankungen durch lokale Infektionen hervorgerufen werden, bei Frauen etwa durch Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane oder der Zähne, die er ihnen dann im Namen einer vermeintlichen Heilung so großzügig wie stümperhaft entfernt.
Blut, Gestank, Dreck; versehrte, verlauste und geschändete Körper, die sich in Todesangst winden - Oates' Beschreibungen sind nur schwer zu ertragen. Durch die Unmittelbarkeit der autobiographischen Schilderungen des Arztes wird das Grauen nicht geringer, im Gegenteil: Der Schrecken lauert zwischen den Zeilen, in der obszönen Diskrepanz zwischen dem nüchtern anmutenden Zeugnis des "Schlächters" und dem Martyrium seiner Patientinnen, das der Leser zum großen Teil nur erahnen kann.
Oates hat mit ihrem Roman, der gekonnt Fragen von Race, Class und Gender verhandelt, diesen Frauen, den "Ungenannten" und den "Stummen" und "Vergessenen", wie es in der Widmung heißt, ein Denkmal gesetzt. Ihr ist mit "Der Schlächter" ein feministischer Horrorroman gelungen, dessen Lektüre noch lange nachhallt. ANTEA OBINJA
Joyce Carol Oates: "Der Schlächter". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz. Blessing Verlag, München 2025. 448 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 24.06.2025
Eine heftige Geschichte über die Anfänge der Psychiatrie, der Gynäkologie anhand des Lebensweges eines grausamen, machiavellistischen Arztes
LovelyBooks-Bewertung am 08.06.2025
Ein moderner Schauerroman, der nichts für schwache Nerven ist. Großartig erzählt von der Dame des Schreckens!









