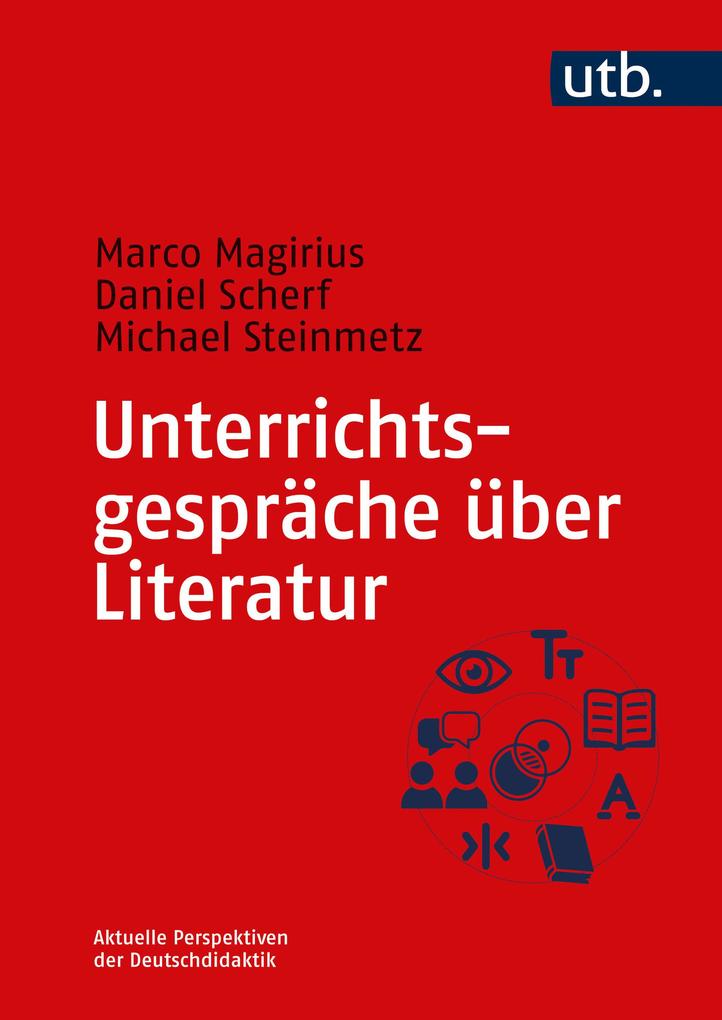
Sofort lieferbar (Download)
Dieses Buch bietet einen strukturierten Einblick in literaturdidaktische Konzeptionen und die empirische Forschung zu Literaturgesprächen in der Schule. Es vermittelt praxisnahe Planungshilfen für die Gestaltung inspirierender Literaturgespräche.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
1 Einleitung 11
1. 1 Zielstellung des Bandes 11
1. 2 Einordnung in die Lern- bzw. Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts 12
1. 3 Ästhetische Gegenstände 17
1. 4 Schlussfolgerungen für Gespräche im Literaturunterricht 22
1. 5 Zum Abschluss: Drei Thesen zu Unterrichtsgesprächen über Literatur 24
2 Vorliegende Konzepte 27
2. 1 Einführung in das Kapitel 27
2. 2 Das Vorlesegespräch und das Sehgespräch 32
2. 2. 1 Theoretische Grundlagen 33
2. 2. 2 Rolle der Lehrkraft 34
2. 2. 3 Praktische Umsetzung 34
2. 2. 4 Problematisierung 37
2. 2. 5 Zum Weiterlesen 38
2. 3 Literarische Gespräche der Frankfurter Arbeitsgruppe um Valentin Merkelbach 38
2. 3. 1 Theoretische Grundlagen 39
2. 3. 2 Rolle der Lehrkraft 40
2. 3. 3 Praktische Umsetzung 41
2. 3. 4 Problematisierung 41
2. 3. 5 Zum Weiterlesen 42
2. 4 Das Heidelberger Modell des literarischen Unterrichtsgesprächs 42
2. 4. 1 Theoretische Grundlagen 42
2. 4. 2 Rolle der Lehrkraft 44
2. 4. 3 Praktische Umsetzung 44
2. 4. 4 Problematisierung 46
2. 4. 5 Zum Weiterlesen 47
2. 5 Das Forschende Literaturgespräch 47
2. 5. 1 Theoretische Grundlagen 48
2. 5. 2 Rolle der Lehrkraft 49
2. 5. 3 Praktische Umsetzung 50
2. 5. 4 Problematisierung 51
2. 5. 5 Zum Weiterlesen 52
2. 6 Das Lernunterstützende Literaturgespräch 52
2. 6. 1 Theoretische Grundlagen 53
2. 6. 2 Rolle der Lehrkraft 56
2. 6. 3 Praktische Umsetzung 57
2. 6. 4 Problematisierung 57
2. 6. 5 Zum Weiterlesen 58
2. 7 Weitere Positionen und Konzepte 58
3 Anwendungsbeispiele 65
3. 1 Einleitung 65
3. 2 Anwendungsbeispiel für ein Vorlesegespräch 65
3. 2. 1 Hinführung 65
3. 2. 2 Textbeschreibung Das Gold des Hasen 66
3. 2. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 70
3. 2. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 72
3. 2. 5 Vorgehen kurz gefasst 72
3. 2. 6 Geeignete Texte 73
3. 3 Anwendungsbeispiel für ein literarisches Gespräch nach dem Heidelberger Modell 74
3. 3. 1 Hinführung 74
3. 3. 2 Textbeschreibung Eine kaiserliche Botschaft 74
3. 3. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 76
3. 3. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 78
3. 3. 5 Vorgehen kurz gefasst 79
3. 3. 6 Geeignete Texte 79
3. 4 Anwendungsbeispiel für ein Forschendes Literaturgespräch 80
3. 4. 1 Hinführung 80
3. 4. 2 Textbeschreibung Der Löwe, der Fuchs und der Esel 81
3. 4. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 84
3. 4. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 85
3. 4. 5 Vorgehen kurz gefasst 85
3. 4. 6 Geeignete Texte 86
3. 5 Anwendungsbeispiele für Lernunterstützende Literaturgespräche 86
3. 5. 1 Hinführung 86
3. 5. 2 Textbeschreibung Die Nacht, in der ich fliegen konnte 88
3. 5. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 92
3. 5. 4 Textbeschreibung Ausgestochen 95
3. 5. 5 Was müssen die Lehrpersonen tun? 98
3. 5. 6 Was müssen die Lernenden mitbringen? 100
3. 5. 7 Vorgehen kurz gefasst 101
3. 5. 8 Geeignete Texte 101
4 Empirische Forschung zu Unterrichtsgesprächen über Literatur 103
4. 1 Einleitung 103
4. 2 Rekonstruktive Studien: Gesprächs- und Lernprozesse im Blick 106
4. 2. 1 Rekonstruktive Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 106
4. 2. 2 Beispiel: Vertextungsverfahren in Unterrichtsgesprächen über Literatur (Heller 2021a; 2021b) 109
4. 2. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit:
Vertextungsverfahren in einer Vorlesesituation im Anfangsunterricht auffinden und typisieren 111
4. 3 Kategorisierende Erforschung von Unterrichtsgesprächen 114
4. 3. 1 Kategorisierende Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 114
4. 3. 2 Beispiel: Umgang mit Leer- und Unbestimmtheitsstellen von
Schüler:innen im Anfangsunterricht (Rist 2022) 118
4. 3. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit: Umgang mit
Unbestimmtheit in Bilderbuch-Gesprächen in der Sekundarstufe 121
4. 4 Quantitative Forschung auf Ebene des Gesamtgesprächs 123
4. 4. 1 Quantitative Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 123
4. 4. 2 Beispiel: ÄSKIL 129
4. 4. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit: Prüfung von
Unterschieden zwischen von Lehrer:innen und von Studierenden geleiteten Gesprächen 131
Literatur 135
1 Einleitung 11
1. 1 Zielstellung des Bandes 11
1. 2 Einordnung in die Lern- bzw. Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts 12
1. 3 Ästhetische Gegenstände 17
1. 4 Schlussfolgerungen für Gespräche im Literaturunterricht 22
1. 5 Zum Abschluss: Drei Thesen zu Unterrichtsgesprächen über Literatur 24
2 Vorliegende Konzepte 27
2. 1 Einführung in das Kapitel 27
2. 2 Das Vorlesegespräch und das Sehgespräch 32
2. 2. 1 Theoretische Grundlagen 33
2. 2. 2 Rolle der Lehrkraft 34
2. 2. 3 Praktische Umsetzung 34
2. 2. 4 Problematisierung 37
2. 2. 5 Zum Weiterlesen 38
2. 3 Literarische Gespräche der Frankfurter Arbeitsgruppe um Valentin Merkelbach 38
2. 3. 1 Theoretische Grundlagen 39
2. 3. 2 Rolle der Lehrkraft 40
2. 3. 3 Praktische Umsetzung 41
2. 3. 4 Problematisierung 41
2. 3. 5 Zum Weiterlesen 42
2. 4 Das Heidelberger Modell des literarischen Unterrichtsgesprächs 42
2. 4. 1 Theoretische Grundlagen 42
2. 4. 2 Rolle der Lehrkraft 44
2. 4. 3 Praktische Umsetzung 44
2. 4. 4 Problematisierung 46
2. 4. 5 Zum Weiterlesen 47
2. 5 Das Forschende Literaturgespräch 47
2. 5. 1 Theoretische Grundlagen 48
2. 5. 2 Rolle der Lehrkraft 49
2. 5. 3 Praktische Umsetzung 50
2. 5. 4 Problematisierung 51
2. 5. 5 Zum Weiterlesen 52
2. 6 Das Lernunterstützende Literaturgespräch 52
2. 6. 1 Theoretische Grundlagen 53
2. 6. 2 Rolle der Lehrkraft 56
2. 6. 3 Praktische Umsetzung 57
2. 6. 4 Problematisierung 57
2. 6. 5 Zum Weiterlesen 58
2. 7 Weitere Positionen und Konzepte 58
3 Anwendungsbeispiele 65
3. 1 Einleitung 65
3. 2 Anwendungsbeispiel für ein Vorlesegespräch 65
3. 2. 1 Hinführung 65
3. 2. 2 Textbeschreibung Das Gold des Hasen 66
3. 2. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 70
3. 2. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 72
3. 2. 5 Vorgehen kurz gefasst 72
3. 2. 6 Geeignete Texte 73
3. 3 Anwendungsbeispiel für ein literarisches Gespräch nach dem Heidelberger Modell 74
3. 3. 1 Hinführung 74
3. 3. 2 Textbeschreibung Eine kaiserliche Botschaft 74
3. 3. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 76
3. 3. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 78
3. 3. 5 Vorgehen kurz gefasst 79
3. 3. 6 Geeignete Texte 79
3. 4 Anwendungsbeispiel für ein Forschendes Literaturgespräch 80
3. 4. 1 Hinführung 80
3. 4. 2 Textbeschreibung Der Löwe, der Fuchs und der Esel 81
3. 4. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 84
3. 4. 4 Was müssen die Lernenden mitbringen? 85
3. 4. 5 Vorgehen kurz gefasst 85
3. 4. 6 Geeignete Texte 86
3. 5 Anwendungsbeispiele für Lernunterstützende Literaturgespräche 86
3. 5. 1 Hinführung 86
3. 5. 2 Textbeschreibung Die Nacht, in der ich fliegen konnte 88
3. 5. 3 Was müssen die Lehrpersonen tun? 92
3. 5. 4 Textbeschreibung Ausgestochen 95
3. 5. 5 Was müssen die Lehrpersonen tun? 98
3. 5. 6 Was müssen die Lernenden mitbringen? 100
3. 5. 7 Vorgehen kurz gefasst 101
3. 5. 8 Geeignete Texte 101
4 Empirische Forschung zu Unterrichtsgesprächen über Literatur 103
4. 1 Einleitung 103
4. 2 Rekonstruktive Studien: Gesprächs- und Lernprozesse im Blick 106
4. 2. 1 Rekonstruktive Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 106
4. 2. 2 Beispiel: Vertextungsverfahren in Unterrichtsgesprächen über Literatur (Heller 2021a; 2021b) 109
4. 2. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit:
Vertextungsverfahren in einer Vorlesesituation im Anfangsunterricht auffinden und typisieren 111
4. 3 Kategorisierende Erforschung von Unterrichtsgesprächen 114
4. 3. 1 Kategorisierende Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 114
4. 3. 2 Beispiel: Umgang mit Leer- und Unbestimmtheitsstellen von
Schüler:innen im Anfangsunterricht (Rist 2022) 118
4. 3. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit: Umgang mit
Unbestimmtheit in Bilderbuch-Gesprächen in der Sekundarstufe 121
4. 4 Quantitative Forschung auf Ebene des Gesamtgesprächs 123
4. 4. 1 Quantitative Studien: Objekt- und Gegenstandsbereiche, Erkenntnisziele und Erkenntnisse 123
4. 4. 2 Beispiel: ÄSKIL 129
4. 4. 3 Ausblick auf eine eigene Forschungsarbeit: Prüfung von
Unterschieden zwischen von Lehrer:innen und von Studierenden geleiteten Gesprächen 131
Literatur 135
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
152
Dateigröße
4,39 MB
Reihe
Aktuelle Perspektiven der Deutschdidaktik
Autor/Autorin
Marco Magirius, Daniel Scherf, Michael Steinmetz
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783838562681
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Unterrichtsgespräche über Literatur" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










