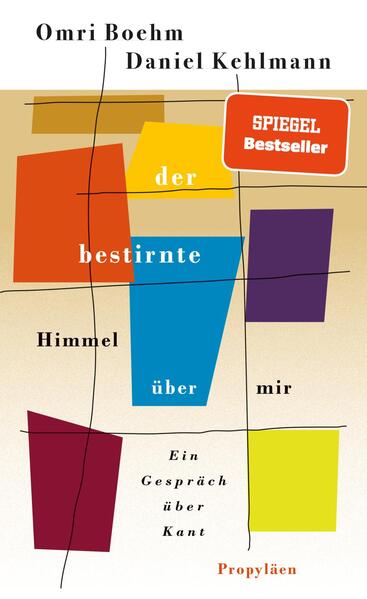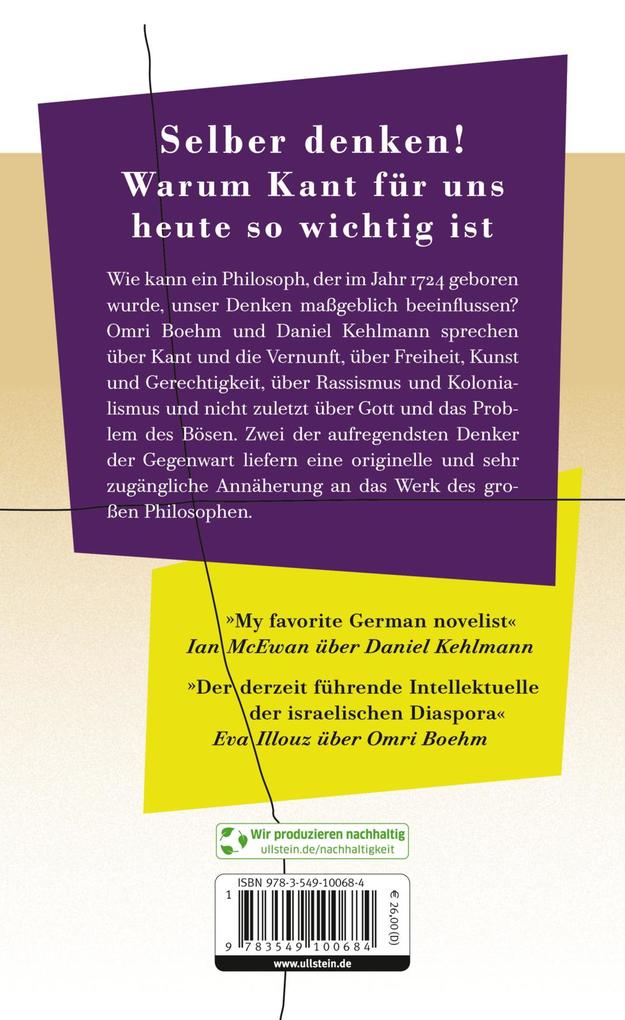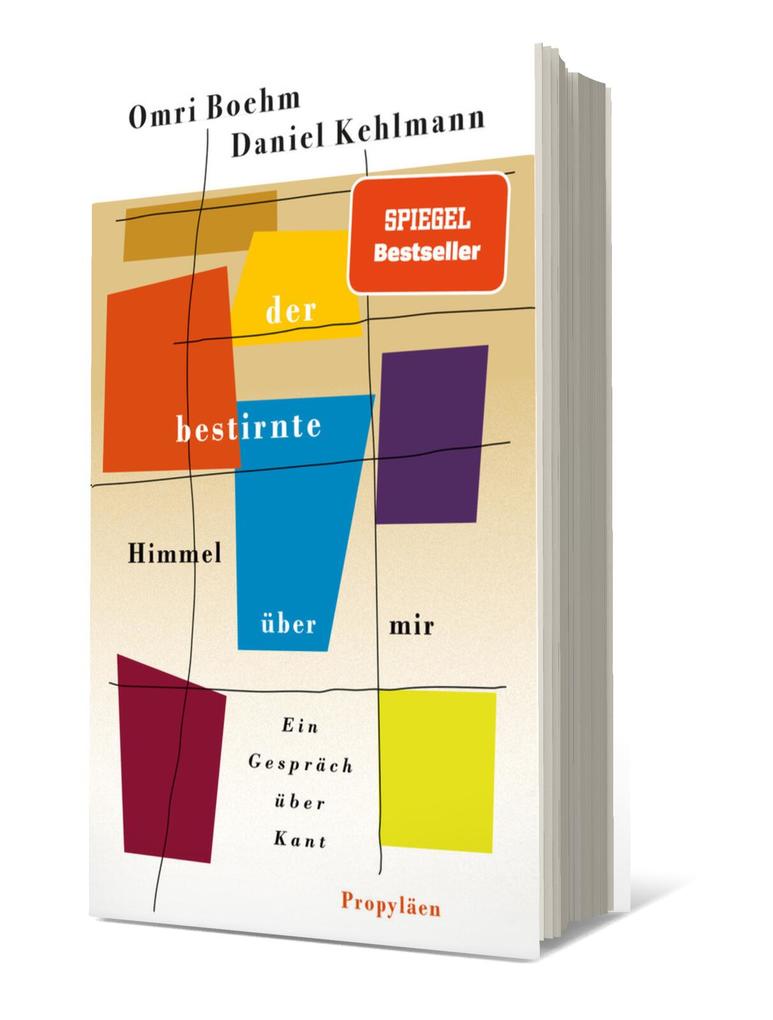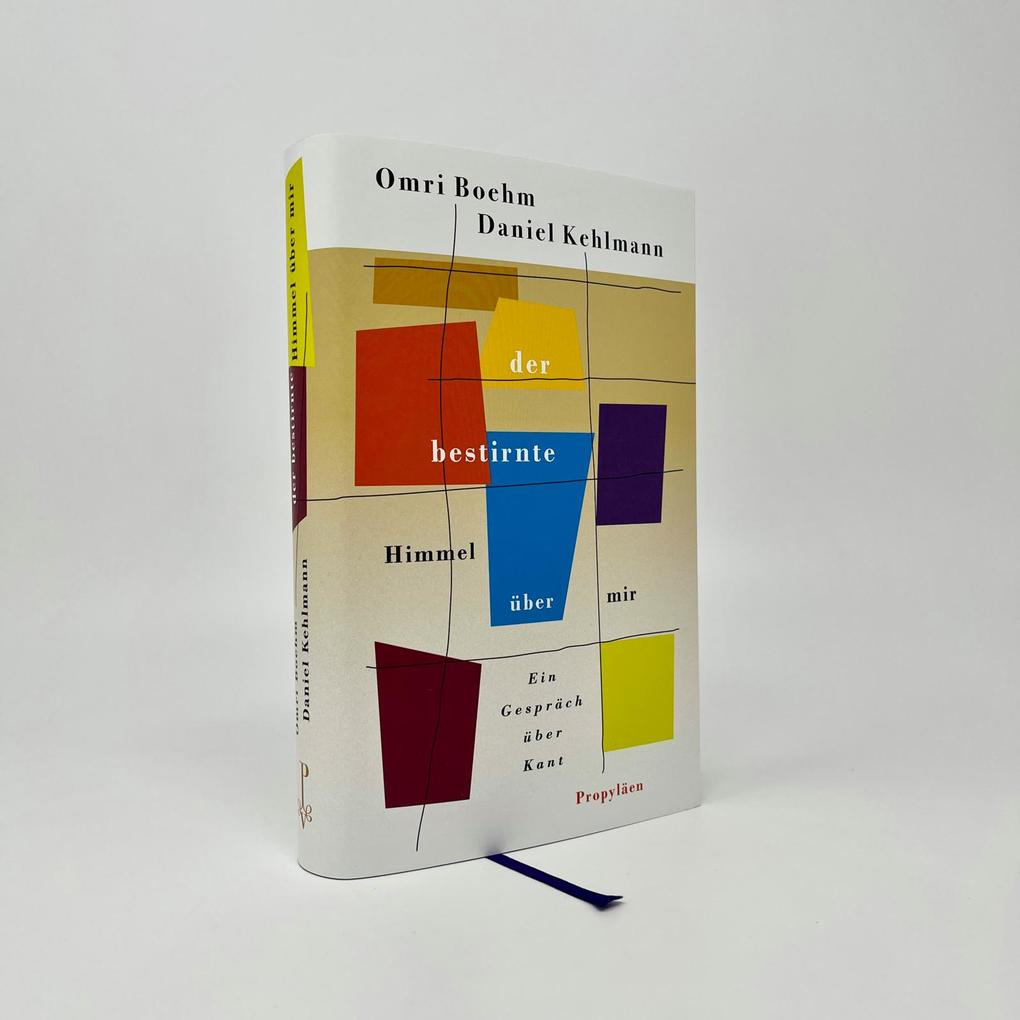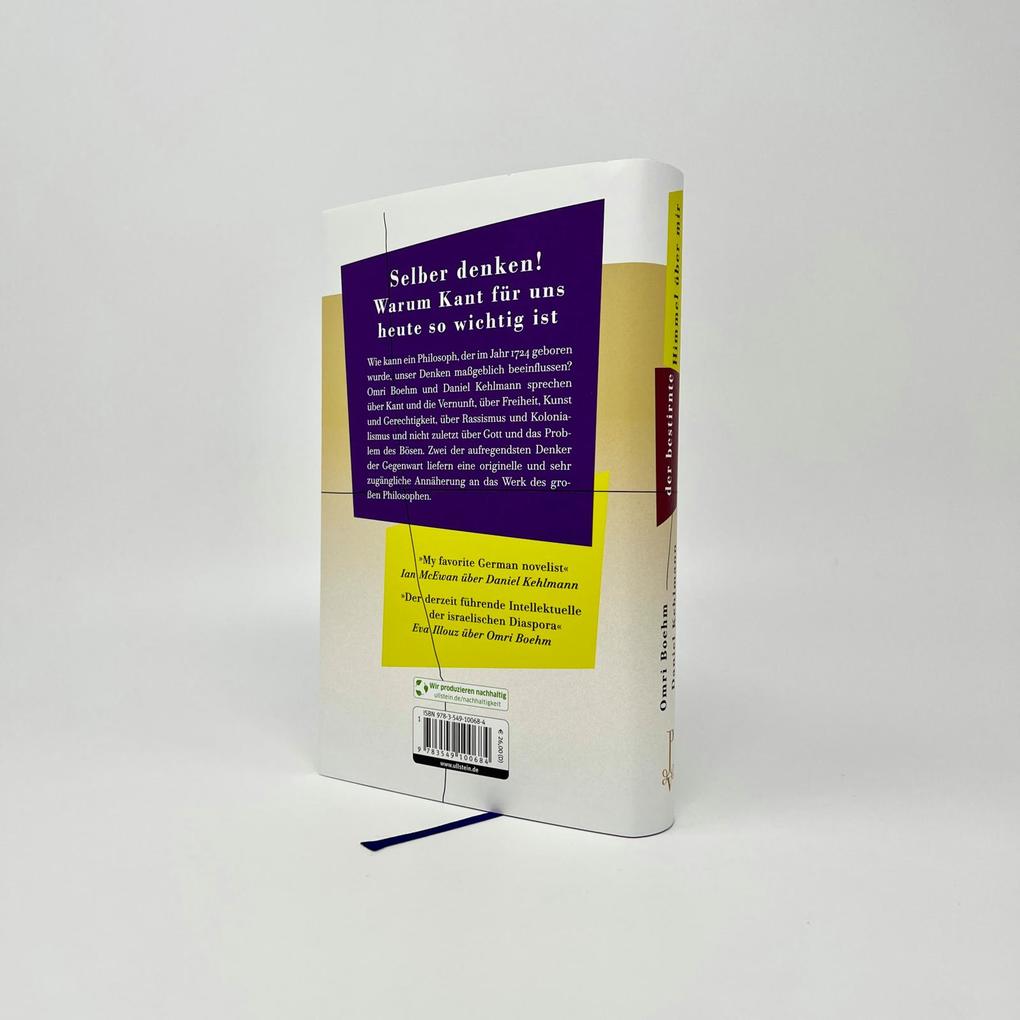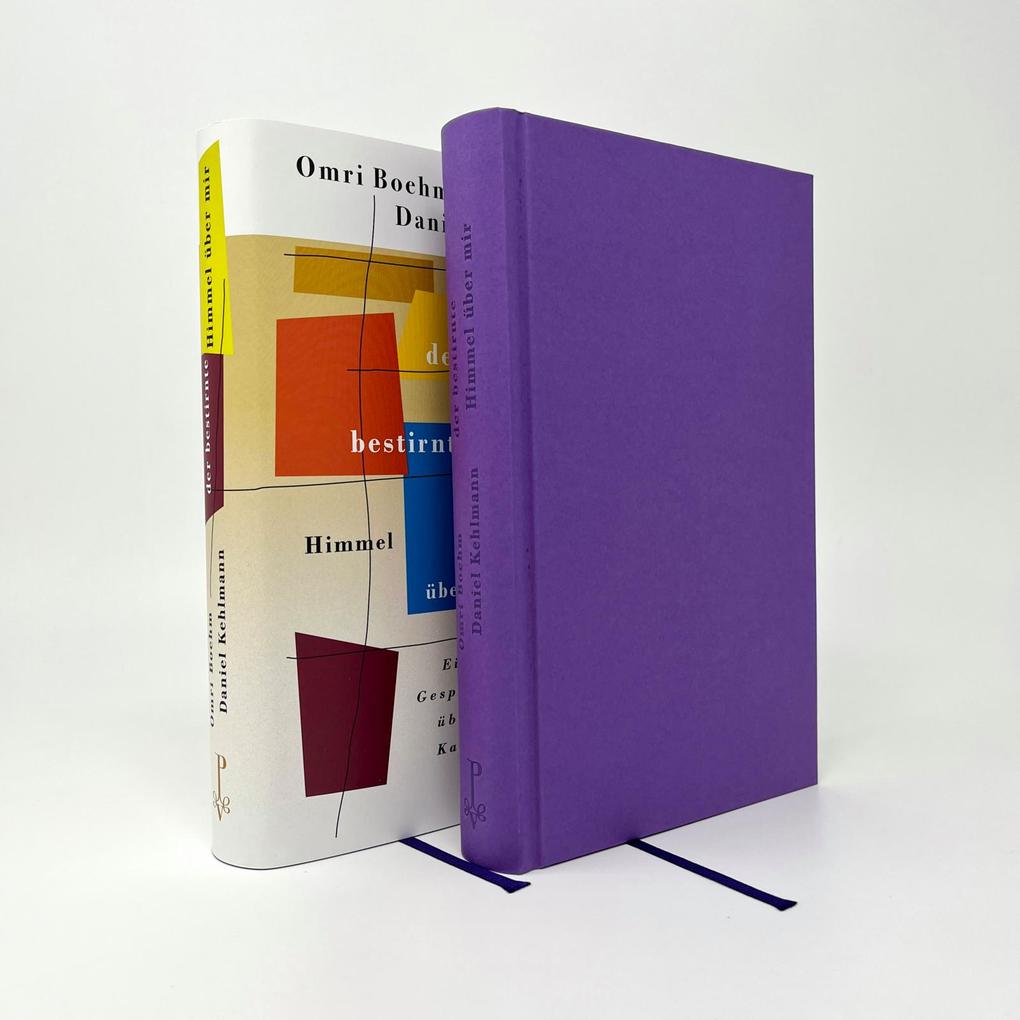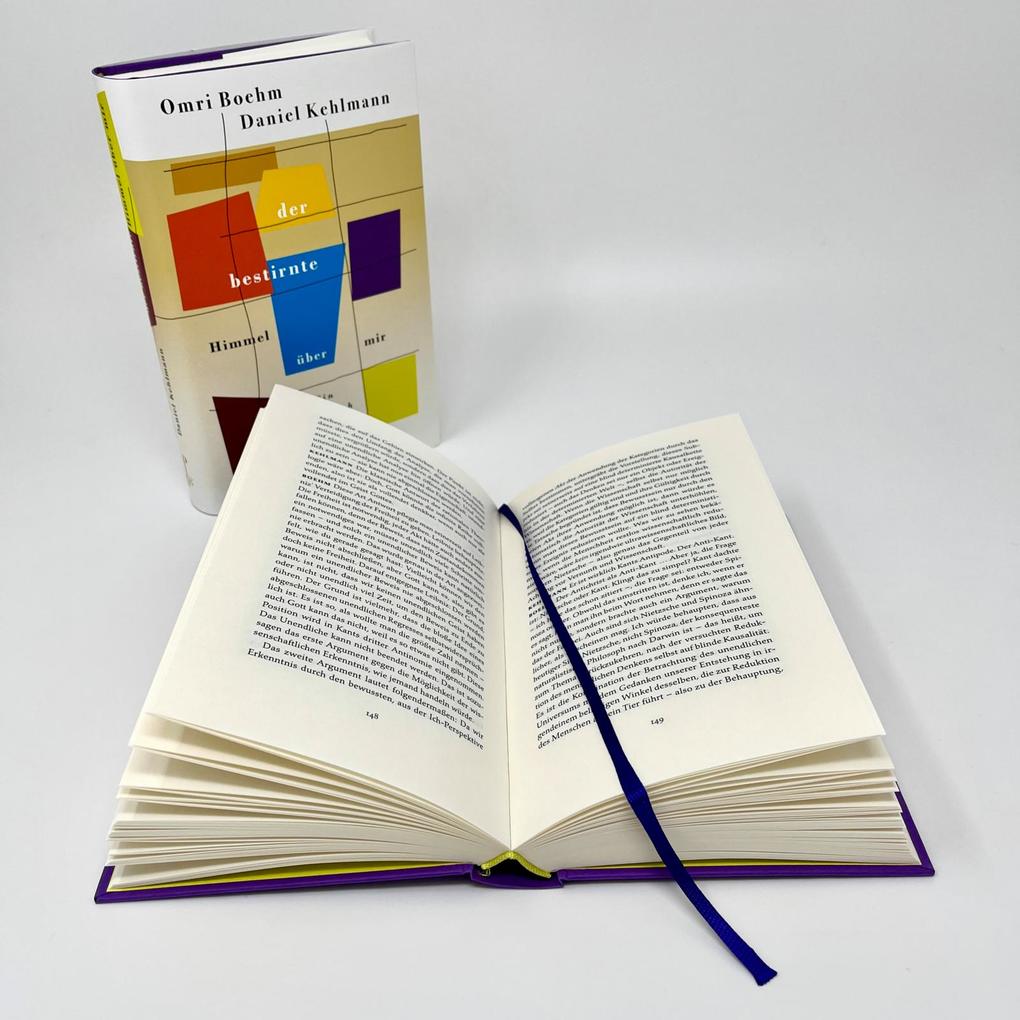Besprechung vom 03.02.2024
Besprechung vom 03.02.2024
Moralische Eindeutigkeit wäre fein
Hehr sind die Prinzipien, doch kompliziert ist die Welt: Omri Boehm und Daniel Kehlmann sind sich über Kant ziemlich einig.
Von Platons Dialogen wissen wir, dass Philosophieren nicht Monologisieren bedeutet. Leider hat sich das nicht durchgesetzt, gesiegt hat in der Philosophie der trockene Traktat. Umso erfreulicher ist es, wenn nun Kants kniffliger Begriffsapparat in einem Gespräch verlebendigt wird. Wer allerdings einen leicht verdaulichen Ideenaustausch erwartet, sieht sich getäuscht: Wir haben es mit einer veritablen Seminardiskussion zu tun. Die Rolle des Dozenten übernimmt Omri Boehm, während Daniel Kehlmann für die größeren Bögen und griffigeren Formulierungen sorgt und auch mal dazwischenfunkt: "Lass uns etwas weniger abstrakt werden."
Boehm ist mit seinem Plädoyer für einen "radikalen Universalismus" in öffentlichen Debatten präsent, Kehlmann hat seine Dissertation über Kant abgebrochen, als er vom Schreiben leben konnte. In seinem jüngsten Roman "Lichtspiel" geht es um die Frage, wie man in schlimmen Zeiten noch guten Gewissens seiner Arbeit nachgehen kann. Womit man auch gleich bei Kant wäre, dessen kategorischer Imperativ besagt, dass wir unabhängig von Zeit und Umständen kompromisslos auf den ehernen Kompass unseres inneren Sittengesetzes hören müssen. Dass dies leichter gesagt ist als getan, zeigt in aller Eindrücklichkeit Kehlmanns Roman. Im Gespräch mit Boehm scheint er jedoch dessen Überzeugung zu teilen, dass der kategorische Imperativ stets als oberster Leitfaden dienen muss. Als Schriftsteller schärft er den Blick für die Komplexität der Wirklichkeit, als Kantianer wünscht er sich moralische Eindeutigkeit.
Um es gleich vorwegzusagen: Im ersten Drittel besteht die Krux darin, dass zwei Kantianer sich in Konsens üben, auch wenn Kehlmann bisweilen den Part des Skeptikers übernimmt. Doch beide küren Spinoza zu Kants Antipoden und stecken ihn wie zu Jacobis Zeiten in die Schublade des Determinismus, Fatalismus und Nihilismus. Kants Abspaltung des Geistes von unseren natürlichen und kulturellen Bedingtheiten und sein darauf aufbauender Freiheits- und Moralbegriff werden nie grundsätzlich infrage gestellt. Zwar gestehen beide ein, dass es nicht leicht ist, Kants moralischen Maximalismus in die Tat umzusetzen, der Gedanke aber, dass an ihm prinzipiell etwas problematisch sein könnte, kommt für sie nicht in Betracht.
Dabei ließe sich gerade an Spinoza zeigen, wie man menschliche Freiheit auch anders denken kann als Kant. Während Kant sie nämlich als etwas radikal Unabhängiges imaginiert, koppelt Spinoza sie nie von unseren Interessen, Bedürfnissen und Begierden ab. Mit purem Determinismus hat das wenig zu tun, sondern eher mit der Einsicht, dass wir nie im luftleeren Raum agieren. Darin gründet auch Hegels Kritik an Kants moralischen Autonomievorstellungen. Denn wer den Geist von allem Körperlichen, Geschichtlichen und Gesellschaftlichen abkappt und das Gewissen zur völlig autarken Instanz überhöht, gerät im praktischen Leben in unlösbare Widersprüche. Wie sehr der kategorische Imperativ nur ein absolutes Ja oder Nein kennt, zeigt sich daran, dass in Kants Universum nicht einmal Notlügen erlaubt sind, selbst wenn sie Leben retten könnten. Doch Boehm rechtfertigt sogar diese Maxime mit dem Argument: Wer für eine gute Sache lügt, nimmt es mit der Wahrheit vermutlich auch sonst nicht so genau.
Auch darf für ihn als rigiden Kantianer der Wille, gut zu handeln, niemals mit dem Gedanken an einen Nutzen befleckt sein. Boehm ist ein Meister begrifflicher Ziselierung, was aber die praktische Seite seines Moralismus betrifft, begibt er sich nur ungern in die Niederungen alltäglicher Dilemmata. Gegen Ende gibt Kehlmann zu bedenken, dass wir immer aus mehrerlei Motiven heraus handeln, meist ohne uns ihrer bewusst zu werden. Boehm jedoch würde der Menschheit am liebsten einen Grundkurs in Kant verordnen, auf dass sie sich nur von höchsten Prinzipien leiten lasse.
Wie vehement Boehm für eine puristische Moral eintritt, zeigt auch seine Abscheu gegen Kants "Anthropologie in pragmatischer Hinsicht": Sie stellt für ihn einen Verrat an dessen eigener, platonisch-reiner Idee der Menschheit dar. Dabei besitzt sie, könnte man einwenden, ziemlich viel Witz, auch wenn man nicht immer weiß, ob er beabsichtigt ist. Überdies verknüpft Kant dort wie nie zuvor das Sittliche, Sinnliche und Soziale miteinander. Zwar enthält sie eine Menge zeitbedingten Unsinn, vor allem in der grotesken Charakterisierung der Völker; was aber den neuerdings beliebten Rassismus-Vorwurf gegen Kant angeht, sind beide sich einig, dass damit wenig gewonnen ist, zumal Kants Universalismus allem Ausgrenzenden diametral entgegensteht. Einig sind sie sich auch darin, dass die grassierende Identitätspolitik von links wie rechts einen Rückfall in partikularistisches Denken bedeutet.
Deutlich lebhafter wird das Gespräch, wenn es um Kants Erkenntnistheorie geht. In "Die Vermessung der Welt" kommt es leider nicht mehr zu dem von Gauß gewünschten Gespräch mit Kant, in dem er ihm erklären will, dass die synthetischen Urteile a priori durch seine Entdeckung einer nicht euklidischen Geometrie hinfällig sind. Die beiden sehen sich zwar, doch Kant ist dement. Auf Boehms Einwurf, warum man solche Dinge in Romanen eigentlich ins Lächerliche ziehen müsse, antwortet Kehlmann, dass Literatur vom Unkontrollierbaren unseres Lebens handle. So willig der Geist auch sein mag, so machtvoll funkt ihm alles, was nicht Geist ist, dazwischen. Und genau daran entzündet sich Kehlmanns Phantasie, nicht zuletzt in seinem Stück "Geister in Princeton", das von der fortschreitenden Paranoia des genialen Gödel handelt. Kehlmanns gesamtes Werk ist bevölkert von brillanten Kippfiguren, denen früher oder später alles entgleitet. Nicht minder handelt es von der Relativität aller Wissenschaft: Gauß erschütterte die Gewissheiten der Geometrie, Gödel die der Arithmetik.
Dass auch die Wissenschaft nur mit Theorien hantiert und keine ewigen Wahrheiten produziert, hat sich inzwischen herumgesprochen. Angesichts des heutigen Strudels aus populistischer Wissenschaftsverachtung und einer nach wie vor großen Wissenschaftsgläubigkeit bemerkt Kehlmann: "Unsere modernen Diskurse sind voll von metaphysisch unüberprüften Annahmen, die sich für Wissenschaft halten. Ein Großteil der Wissenschaftler, die sich mit Aplomb in den Medien und in Büchern äußern, merken gar nicht, dass sie Metaphysik betreiben." Während heute ein regelrechter Tanz um die Wissensgesellschaft veranstaltet wird, erinnert Boehm daran, dass Wissen und Denken zwei verschiedene Dinge sind und es vor allem bei Letzterem hapert.
Über eine bloße Einführung in Kant geht dieses Gespräch weit hinaus. An analytischer Schärfe mangelt es ihm in keiner Weise, es fehlt nur hin und wieder die hegelsche Gegenstimme. KARL-HEINZ OTT
Omri Boehm und Daniel Kehlmann: "Der bestirnte Himmel über mir". Ein Gespräch über Kant.
Propyläen Verlag, Berlin 2023. 352 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.