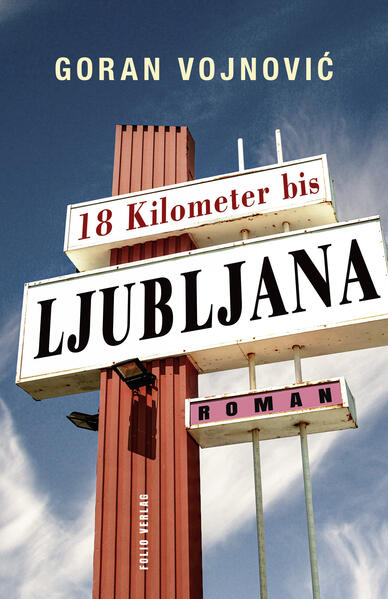
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Ein wahrhaft großes Stück europäischer Literatur. Bayerischer Rundfunk, Mirko Schwanitz
 Besprechung vom 26.10.2023
Besprechung vom 26.10.2023
Unter der Motorhaube
Welche Wunden haben die Jugoslawienkriege den Kindern von einst zugefügt? Goran Vojnovic schickt einen jungen Bosnier durch Ljubljana.
Da ist er wieder: Marko Dordic, vor zehn Jahren vom eigenen Vater aus Sorge um seine Sicherheit zur Verwandtschaft nach Bosnien geschickt, inzwischen zurück im Migrantenvorort Fuzine in Ljubljana, dort, so sagt er selbst, inzwischen ein Außerirdischer. Ein Idiot. Ein Tschefur: So werden im Slowenischen verächtlich die Zugewanderten aus den südlichen Republiken des ehemaligen Jugoslawiens bezeichnet. Für Marko und seine Freunde ist es ein Ehrentitel. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2017, die slowenische Basketball-Nationalmannschaft macht ihren Weg durch die Europameisterschaft in Istanbul, um schließlich auf die serbische zu treffen, und Marko weiß nicht, wie es weitergehen soll. Warum er mit seinen 28 Jahren überhaupt zurückgekehrt ist, darüber gibt es in "18 Kilometer bis Ljubljana", dem neuen Roman von Goran Vojnovic, mehrere Geschichten.
Die eine: Radovan, Markos Vater, ist krank. Nur darf das niemand sagen, das Wort Krebs darf man schon gar nicht in den Mund nehmen. Der Alte wird fast wahnsinnig vor Angst, im verzweifelten Bestreben, die Diagnose zu ignorieren, den anstehenden Krankenhausaufenthalt und den Umstand, dort nicht mit den üblichen Kontakten seine Sonderbehandlung zu bekommen. "Wenn ich zu der Operation gehe, sollte jemand hier sein, bei Mama": Es ist ein langer Weg, bis Radovan das über die Lippen geht. Der zweite Grund: Marko hat sich auf einer Hochzeitsfeier in Bijeljina unten in Bosnien mit der aufgetakelten Begleitung eines örtlichen Kriminellen vergnügt. Ein Cousin, der bei der Polizei ist, hat Marko kurz danach einen guten Rat gegeben: Es wäre wohl ganz gut, mal für eine Weile von der Bildfläche zu verschwinden.
Und was ist mit Alma? Alma mit den "mörderischen Augen", die ihn damals gleich beim Kennenlernen angegrinst hat "wie ein Knirps, der einem anderen Knirps die Hosen heruntergezogen hat". Die erste Frau, die ihm ins Gesicht sagte, er sei süß. Deren Vater, inzwischen tot, allerdings zu den drei muslimischen Männern gehörte, von denen einer damals die Kirche in Visoko angezündet hat. So wie die Serben das Dorf niedergebrannt haben, in dem Almas Mutter lebte. Alle, Almas Familie und Markos, waren gegen diese Verbindung. Er wollte weg, sie musste weg, sie ging nach Singapur, sie hätte ihn mitgenommen. Und er hat gekniffen. "Alma", behauptet Marko jetzt in der für ihn typischen Mischung aus gespielter Gleichgültigkeit und emotionaler Wachheit, "habe ich längst vergessen, ich träume nur noch von ihr."
Als Radovan Marko mit ans Grab des Großvaters nimmt, in einer Rückblende der an Rückblenden ebenso wie an Auslassungen reichen Erzählung, will er darüber sprechen und kann zugleich nicht darüber sprechen, warum der Sohn die Finger von Alma lassen soll. "Ihr Alten habt euch gegenseitig abgeschlachtet", ereifert sich Marko schließlich, "und ich soll jetzt eure Scheiße fressen, was? Was habe ich mit all dem zu tun?"
Was Marko mit alledem zu tun hat und all das mit ihm: Darum geht es in "18 Kilometer bis Ljubljana", darum ging es auch schon in "Tschefuren raus!" von Goran Vojnovic, dem Anfang der Geschichte, vor zwei Jahren in deutscher Übersetzung erschienen. Und um Adi und Dejan und Aco, die Freunde von einst. Auf der Handlungsebene ist auch der neue Roman eine turbulente, oft brüllend komische Geschichte mit großen Plänen und verpatzten Aktionen, mit Eskalationen und Entgleisungen, mit Schlägern, Großmäulern und Feiglingen. Wer sich von diesen Gestalten nicht kirre machen lässt, wer die - von Klaus Detlef Olof mitreißend übersetzten - Ausfälligkeiten, Zoten, Anstand und Ehrgefühl in vielfältiger Weise störenden Kraftausdrücke nicht scheut, entdeckt darunter Persönlichkeiten, die mit den gesellschaftlichen Zuschreibungen, die sie beschränken, wenigstens ihren Spaß haben wollen. Die füreinander einstehen, umeinander wissen und in ihrem Mitgefühl allein dadurch gestoppt werden, dass sie eine solche Emotionalität einander nie verzeihen würden.
Auf der Figurenebene arbeitet Goran Vojnovic heraus, welche Spuren der Krieg in Jugoslawien bei denen hinterlassen hat, die damals Kinder waren, wie Haltlosigkeit und Gewaltbereitschaft einander bedingen. Und auf der sprachlichen Ebene findet Vojnovic in der vulgären, immer wieder aber auch von unwillkürlich aufgebotenen Bildungsfetzen durchsetzten Sprache seines Erzählers Marko Bilder von einiger Kraft und Frische. "Das Festnetz", heißt es an einer Stelle, "ist bei den Tschefuren ein Familienmitglied, wie Hunde und Katzen bei den Slowenen": Hier mischen sich die Kriegserinnerungen - auch bei Stromausfall war auf das Telefon Verlass - der einen mit ihrem Spott über den Lebensstil der anderen. Vater Radovan ist für Marko wie ein Golf 2 im Krankenhaus: "Der Arzt weiß nichts, bevor er nicht die Haube öffnet." Und über Adi, inzwischen den Drogen so verfallen, dass sich sein neuerdings streng muslimisch auftretender Bruder Sanel, der seine Frau "wie ein Ninja" gekleidet durch Ljubljana schickt, eigens Aufträge für ihn ausdenkt, damit Adi wenigstens gelegentlich von seinen Trips runterkommt: Bei dem wusste man nie, "ob er der größte Zar ist oder ob du ihm in den Arsch treten sollst wie einem Köter".
In "18 Kilometer bis Ljubljana" treffen Verzweiflung und Perspektivlosigkeit auf Situationskomik und Posertum. Ehe er sich's versieht, ist dem Leser dieser Marko Dordic schon wieder etwas näher ans Herz gewachsen. Und mit ihm seinesgleichen. FRIDTJOF KÜCHEMANN
Goran Vojnovic: "18 Kilometer bis Ljubljana". Roman.
Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Folio Verlag, Wien/Bozen 2023. 319 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








