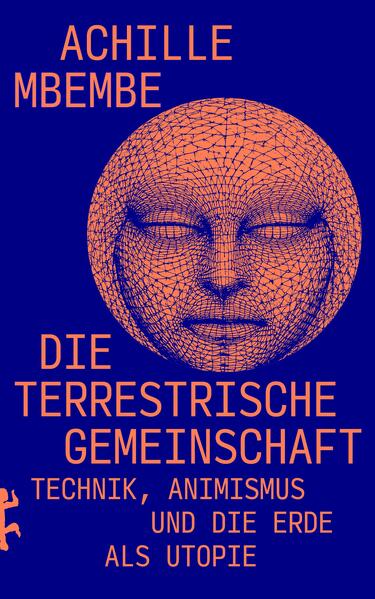Besprechung vom 02.09.2025
Besprechung vom 02.09.2025
Der planetarische Körper ist jetzt fällig
An Afrika genesen: Achille Mbembe erleidet einen schweren Rückfall in indigenistische Weisheiten
Die Kontroverse um Achille Mbembe, die in Deutschland 2020 hochkochte, kreiste um die Frage, ob ihm antisemitische Positionen anzulasten seien. Dabei geriet in den Hintergrund, dass er mit einigen seiner Bücher kluge, weltweit beachtete Beiträge zur Debatte um den Postkolonialismus geleistet hat - eine Denkschule, der sich Mbembe erklärtermaßen gar nicht zugehörig fühlte. Seine Klugheit zeigte sich unter anderem daran, dass er Klischees weitgehend mied. Sein Kollege Arjun Appadurai lobte ihn dafür, auf plumpe Gegenüberstellungen "zwischen Kolonisten und Kolonisierten" zu verzichten und eine "integrative, nachhaltige und gleichberechtigte Vision der Vernunft und der Menschheit" zu entwickeln. Entsprechend wandte sich Mbembe 2010 gegen die Forderung, Afrika solle dem Westen ein Weltbild aus ureigensten Quellen entgegenhalten: "Die Indigenisten vergessen, dass die Bräuche und Traditionen, auf die sie sich berufen, in ihrer stereotypischen Form häufig nicht auf die Indigenen selbst zurückgehen, sondern faktisch von Missionaren und Kolonisten erfunden wurden."
Neuerdings scheint Mbembe selbst an Vergesslichkeit zu leiden, denn er kümmert sich nicht um seine Botschaft von gestern und präsentiert sich als Indigenist. In seinem neuen Buch "Die terrestrische Gemeinschaft" wirft er das "afrikanische Wissen", die "alte afrikanische Metaphysik", die "vorkolonialen, afrikanischen Denksysteme", die "animistischen Dispositive" als Rettungsanker aus, an den sich die Menschheit zu klammern hat, um der von "Europa" angezettelten Polykrise zu entkommen. Unterdrückung! Naturzerstörung! Klimakatastrophe! Gentechnik! Künstliche Intelligenz! Gewalt! Krieg! "Wir stehen mit beiden Beinen mitten im Zeitalter der Verbrennung der Welt."
Mbembe hat sich viel vorgenommen. Er will die Diagnose der Apokalypse schärfen und eine Therapie entwickeln, mit der die "Reparatur der Welt" gelingen soll. Zwischen diesen zwei Vorhaben wechselt das Buch wie ein großes Pendel hin und her, was zur Folge hat, dass der Tonfall ständig wechselt, die beiden Themen aber im regelmäßigen Wechsel wiederkehren. So kommt es häufig zu Wiederholungen. Dass Menschen auf der Erde "Durchreisende" sind, erfährt man viele Male. Den Ideen von der "zweiten Erde", der "zweiten Schöpfung" und dem künstlichen Menschen begegnet man so oft wie der Feuerwehr auf dem Kinderkarussell. Dass der "ewige Friede" ein "Hirngespinst" oder ein "Trugbild" sei, erfährt man mehrfach. (Im französischen Original handelt es sich dabei so oder so um "le mirage".)
Einerseits tritt Mbembe wie ein Wissenschafts- und Technikexperte auf, der emsig seine Kompetenz unter Beweis stellen will. Er schreibt: "Um den Aluminiumanteil in Karosserien, Felgen und Getrieben für Elektrofahrzeuge zu erhöhen, muss man Bauxit mit Natriumkarbonat lösen." Er weiß Bescheid über das bei der Siliziumgewinnung eingesetzte Verfahren der Epitaxie, die "toxische Wirkung" von Molke und die ökologische Bilanz der größten Fischereiunternehmen der Welt. Mbembes Technikkritik ist allerdings von vorgestern. Kurios ist die Behauptung, bis heute sei "die technologische Entwicklung stets im Rahmen einer Geschichte der unaufhörlichen Verbesserungen gedeutet" worden.
Andererseits agiert Mbembe wie ein Wunderheiler, der die Menschheit auf die Rückwendung zur "Erde" einschwören will. So verweist er darauf, dass die "Lebenskraft" in den "Schlüsselbeinen" sitzt und das Lebendige "baumartige Form" hat, oder er behauptet, dass "die Umwandlung von Menschen in Tiere, von Tieren in Pflanzen und von Pflanzen in Menschen und von Menschen in Mikroben in der Ordnung der Dinge liegt". Und doch soll "das der Erde Eigene" darin bestehen, "allen Bewohnenden Platz zu machen" und die Menschen dazu einzuladen, der "terrestrischen Gemeinschaft" und der in ihr herrschenden "Demokratie des Lebendigen" anzugehören. Wenn Mbembe sich dabei auf "afrikanische Denksysteme" bezieht, so tut er dies allerdings ähnlich oberflächlich wie bei der Diskussion moderner Technologien. Gelegentlich lässt er "die alten Dogon" auftreten, aber es bleibt bei ein paar Anekdoten.
Eigentlich also besteht dieses Buch aus Entwürfen zu zwei sehr unterschiedlichen Büchern, die einerseits mit Wissenschaftskritik, andererseits mit Weisheit befasst sind. Mbembe meint eine Brücke zwischen diesen Themen schlagen zu können - und zwar unter der Überschrift des "Animismus". Dadurch nämlich, dass Virtualisierung und Digitalisierung künstliche Welten schaffen, machen sich nach Mbembe mitten in der modernen Welt Geister breit: "Die gegenwärtigen technologischen Religionen sind in dieser Hinsicht Ausdrucksformen des Animismus." Dann muss nur noch der Umzug aus dieser falschen Geisterwelt in die Welt des sogenannten "anzestralen Animismus" gelingen, um die Vergeistigung der Natur und die Erdung des Menschen zu vollziehen: "Wir schulden der technologischen Revolution das allmähliche Entstehen eines planetarischen Körpers, der die Möglichkeit eröffnet, die Erde neu zu denken."
Dies erinnert an Martin Heideggers Idee, dass sich die Selbstherrlichkeit des Subjekts durch die Übermacht der Technik erledigt und dadurch ein neuer Zugang zum Sein eröffnet werde. Tatsächlich könnten manche Mbembe-Sätze genauso gut von Heidegger stammen: "Das Projekt der Moderne hat seinem Wesen nach darin bestanden, bevorzugt auf dem Weg des Rechnens und vermittels technischer Dispositive, das Seiende in seiner Gesamtheit verfügbar zu machen." - "Das Kommende ist . . . der Name für das reine Ereignis, von dem wir weder Stunde, Form noch Ort kennen."
Die Lektüre dieses Buches ist - man muss dies so deutlich sagen - ein Leidensweg. Man leidet, weil man den Eindruck hat, dass Mbembe weit unter seinem Niveau schreibt. Man leidet angesichts der Banalitäten und Kuriositäten, die teils angestaubt, teils aufgehübscht daherkommen. Der Lesegenuss wird auch durch die Übersetzung getrübt. Die folgenden Sätze sind schon im Französischen grenzwertig, aber im Deutschen abstrus: "Die Zähmung als bioökonomisches Kapital war von der ersten Stufe eines quasi-ontologischen Fangens der Natur abhängig." ("L'apprivoisement en tant que capital bioéconomique dépendait d'un premier niveau de capture de nature quasi ontologique.") Oder: "Damit sich das Durchlaufen der Erfahrung vollzieht, muss etwas im Vorhinein kommen können." ("Mais pour que s'effectue la traversée, quelque chose doit pouvoir advenir au préalable.")
Was auch immer man von Mbembes Wechsel ins Lager der Indigenisten halten mag, anfreunden kann man sich mit seiner Kritik am Eurozentrismus, mit der das Buch eröffnet wird. Gleich zu Beginn zitiert er Souleymane Bachir Diagne, der Europa vorgeworfen habe, die eigenen Vorurteile unter dem Deckmantel eines "überwölbenden Universalismus" als Wahrheiten der gesamten Menschheit aufgezwungen zu haben. Wenn man bei Diagne nachliest, dann stellt man allerdings fest, dass die Kritik am "überwölbenden Universalismus" ("universalisme de surplomb") gar nicht von ihm stammt, sondern er sich auf einen Text des französischen Philosophen Maurice Merleau-Ponty von 1960 beruft. Dass die Kritik am Eurozentrismus aus Europa kommt, will Mbembe nicht wahrhaben. DIETER THOMÄ
Achille Mbembe: "Die terrestrische Gemeinschaft". Technik, Animismus und die Erde als Utopie.
Aus dem Französischen von Jörg Theis. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025. 238 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.