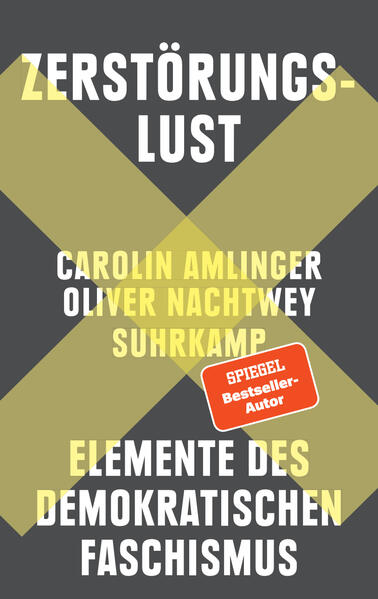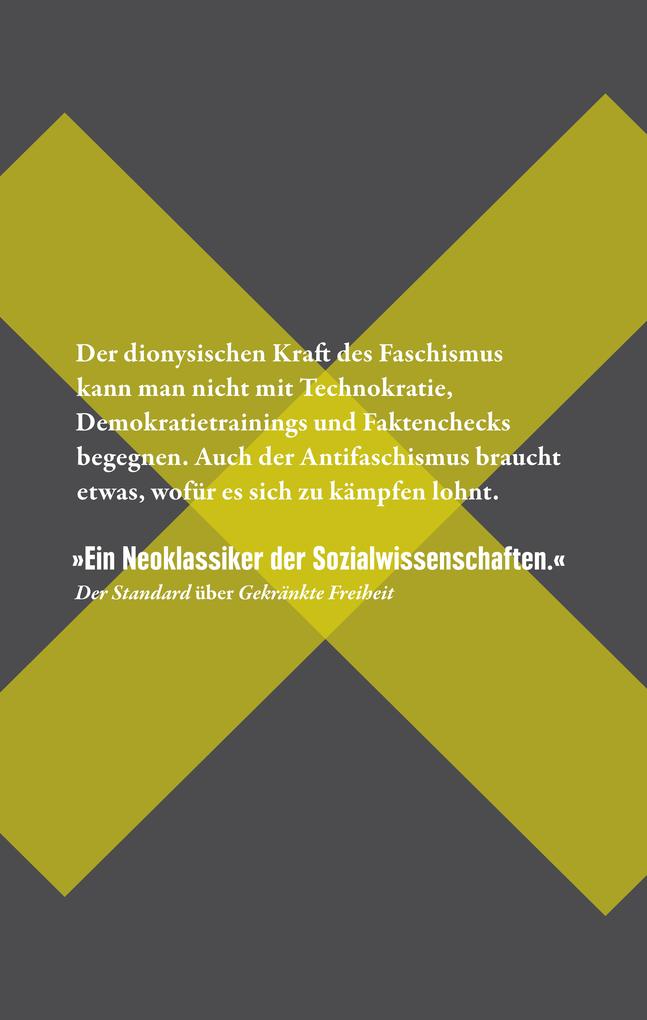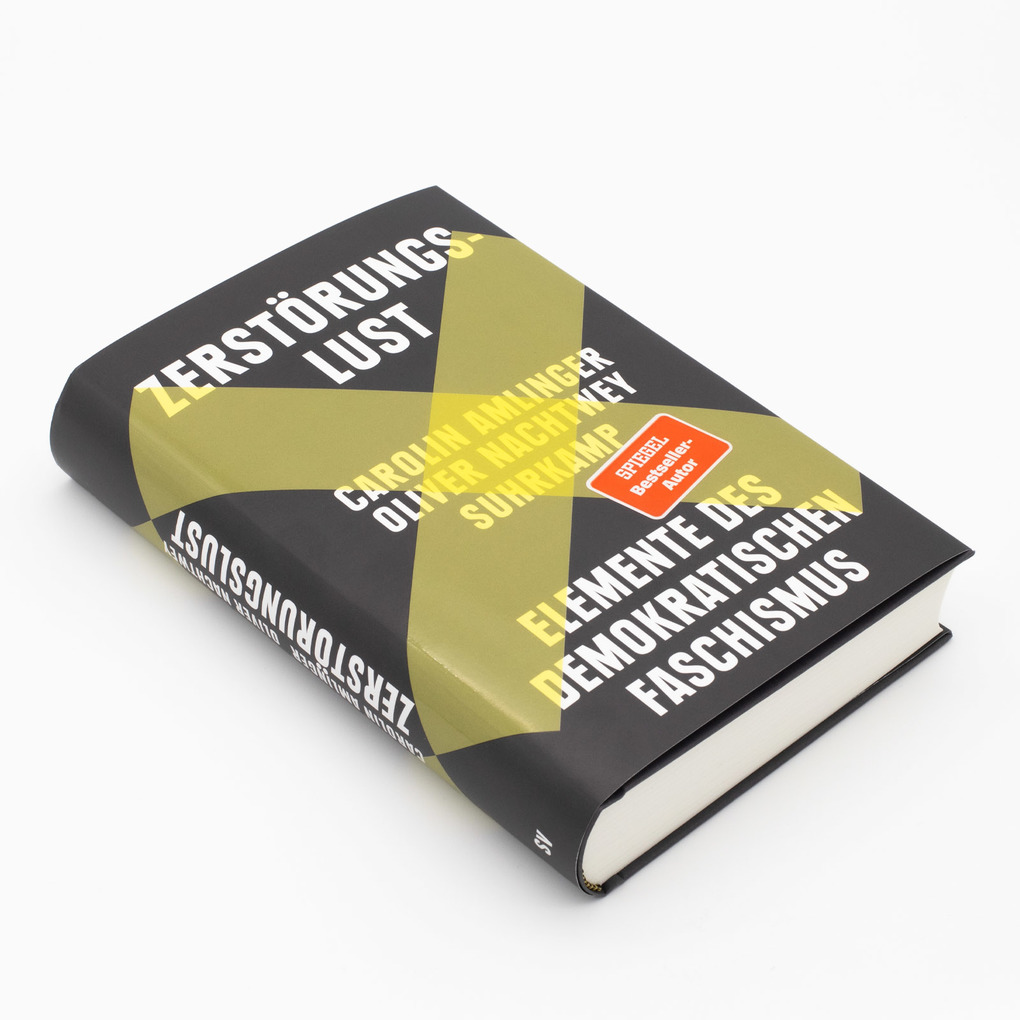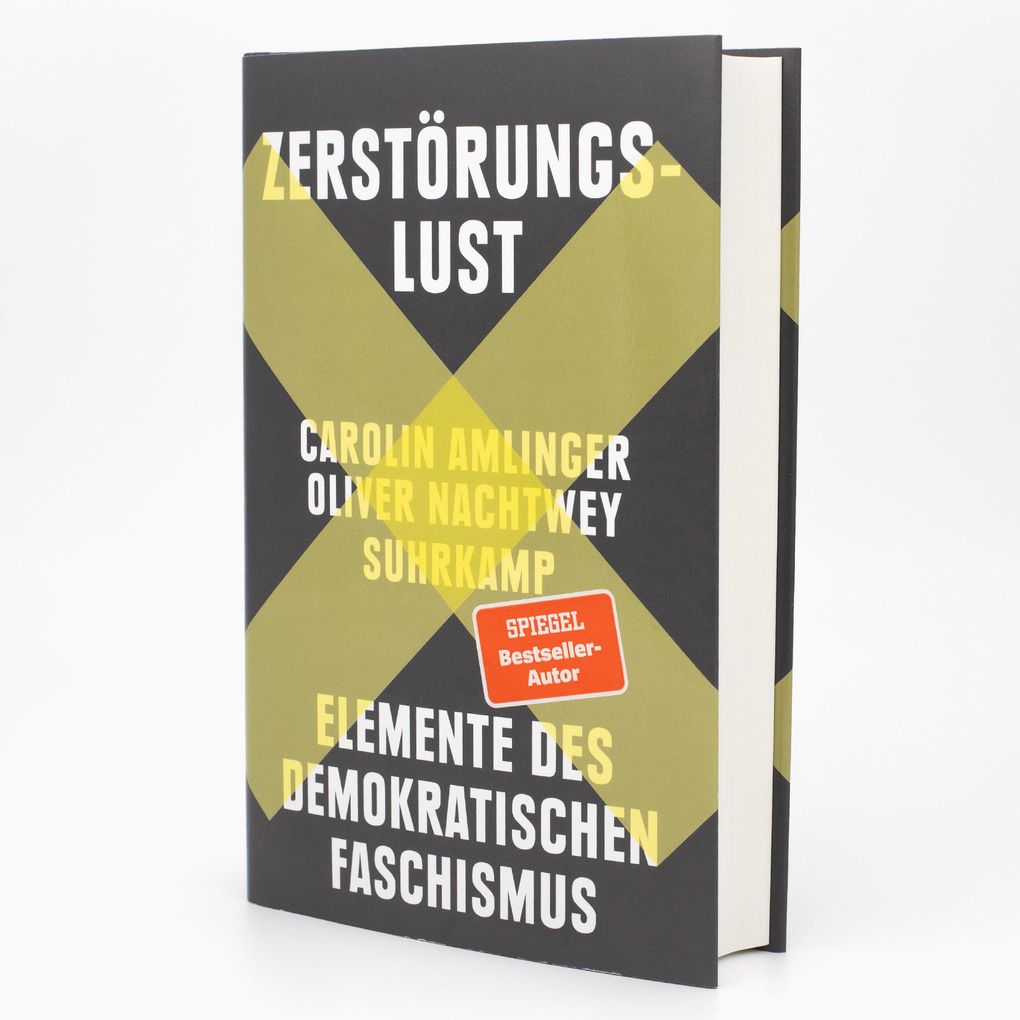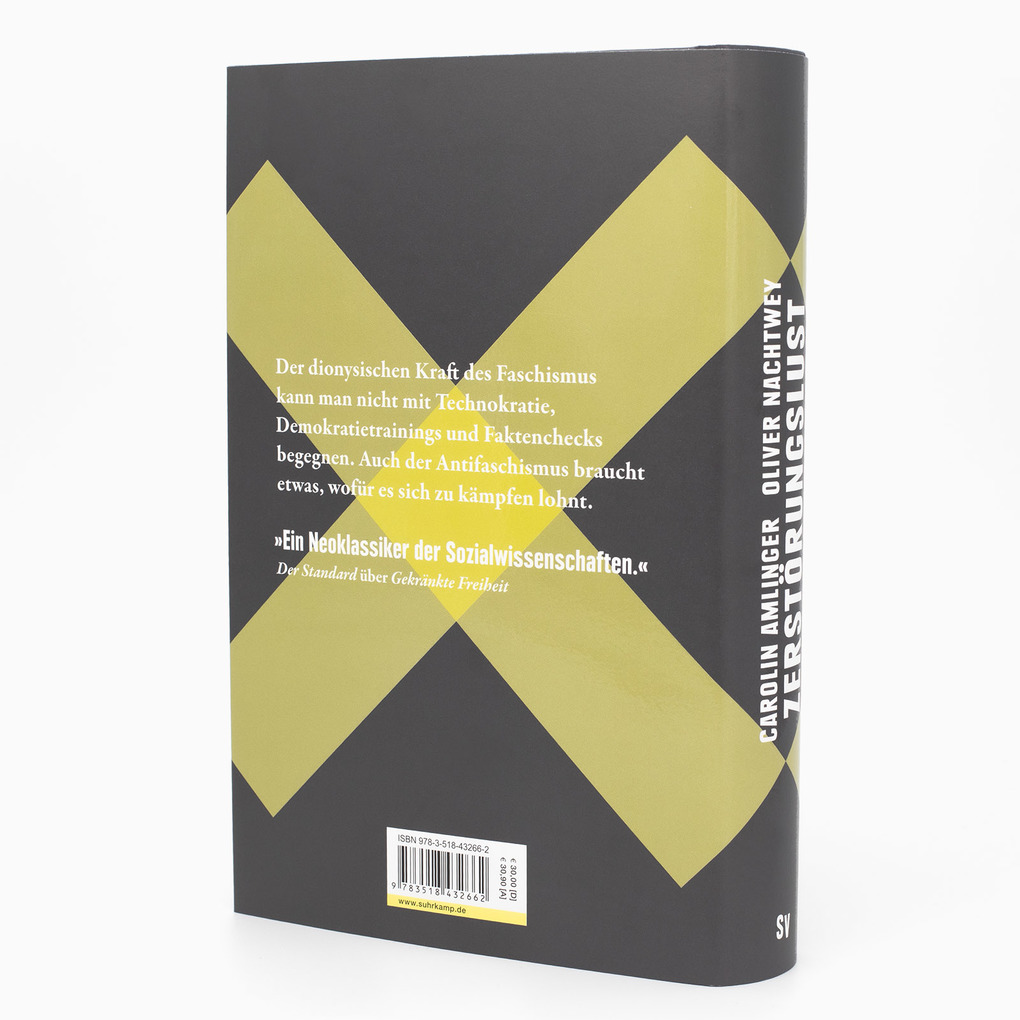Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Die Bürger wollen die Welt brennen sehen
Destruktivität ist das Motto der Gegenwart, so Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem Buch. Woher kommt die Emotion?
Von Oliver Weber
Von Oliver Weber
Die Kettensäge ist beinahe zu einem Dingsymbol der politischen Gegenwart aufgestiegen. Während des Wahlkampfes des argentinischen Präsidenten Javier Milei stand sie für ein Programm, das der angeblichen staatlichen Gängelung und vor allem Besteuerung ein Ende machen soll. Anfang des Jahres überreichte er seine Kettensäge dem damals noch als Trump-Berater auftretenden Elon Musk, der in den Vereinigten Staaten ein ähnliches, inzwischen bereits gescheitertes Programm durchsetzen wollte.
Man verbindet mit der Kettensäge eine libertäre Weltanschauung, die einem ungezügelten Kapitalismus zum Durchbruch verhelfen will. Zu den anderen Segmenten der MAGA-Bewegung dagegen, die katholisch und kommunitaristisch geprägt sind oder den allein gelassenen Regionen des mittleren Westens entstammen, schien diese Programmatik nie recht zu passen. Müssten diese Trump-Anhänger nicht einen starken Staat wollen, um sich vor den Imperativen der Globalisierung zu schützen?
Die beiden Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben jetzt eine Studie vorgelegt, die die in der Kettensäge symbolisierte "Zerstörungslust" als Gemeinsamkeit der rechten Bewegungen der Gegenwart betrachtet. Zwar seien sich Kommunitaristen und Libertäre keineswegs einig, wie das exakte politische Programm lautet, das man nach einem erhofften und erkämpften Sieg umsetzen will, doch beide seien durchdrungen von einer "affektiven Negation des inklusiven Liberalismus". Eine Lust an "Destruktivität" fungiere als Klammer und Motor der politischen Mobilisierung, so die These der beiden Autoren, deren Beschreibung des "Querdenker"-Milieus während der Corona-Pandemie als Sammlungsbewegung eines "libertären Autoritarismus" ein breites Publikum erreicht hatte.
Was soll das also sein: "Destruktivität"? Amlinger und Nachtwey meinen damit unter Rückgriff auf die sozialpsychologischen Arbeiten Erich Fromms einen vielseitigen, jedoch sozial bedingten Affekt. Es handle sich bei der "genussvollen Hinwendung zum Negativen" um eine "Gefühlsstruktur", die aus der Zerstörung und Zerschlagung bestimmter Institutionen, aber auch der Zurechtweisung und Abweisung bestimmter sozialer Gruppen Lust gewinnt - Lust, die politisch genutzt werden kann. Man denke etwa an die Videoclips, die digital herumgereicht werden, wenn Polizisten mittels Schmerzgriff Klimaaktivisten von der Straße zerren; oder an die Glorifizierung jener ICE-Beamten, die im Auftrag der Trump-Regierung Einwanderer ohne Pass auf der Straße ergreifen und in Abschiebegefängnisse stecken. Die Bestrafungsphantasien, die Trump-Anhänger antrieb, als sie am 6. Januar 2020 das Kapitol stürmten, gehören in dieselbe Kategorie politischer Gefühlsaufwallung.
Doch woher kommt diese "Zerstörungslust"? Es gehört zu den besseren Aspekten dieses Buches, es sich in dieser Frage nicht einfach zu machen. Statt sich darauf zu beschränken, die affektive Negativität rechter Bewegungen zu beschreiben (und damit abzuwerten), geben die beiden Soziologen dem Warum, das ja immer ein nachvollziehendes, empathisches Verstehen voraussetzt, ausgesprochen viel Raum. Sie führen den beschriebenen destruktiven Charakter schließlich auf die sozioökonomischen Strukturveränderungen der vergangenen Jahrzehnte zurück.
Das chronische Sinken der Wachstumsraten und Produktivitätssteigerungen habe in einen Zustand geführt, der ein Nullsummendenken nahelege. Für einige Schichten seien Lohn- und Wohlstandssteigerungen kaum mehr in Aussicht, bei vielen dominiere stattdessen die Angst vor Abstieg und Statusverlust. Aus diesem "Gefühl des blockierten Lebens erwächst eine hyperindividualistische Weltwahrnehmung, in der Fortschritt nur noch auf Kosten anderer möglich ist."
Das verändere schließlich auch den Charakter der politisch-sozialen Konflikte: "In Gesellschaften stagnierenden oder gar rückläufigen Wachstums richten sich die Angriffe nun zunehmend gegen andere: Man möchte anderen schaden, um selbst keinen Schaden zu erleiden. In einer nachmodernen Ordnung, in der wenige die großen Gewinne unter sich aufteilen und in politische Macht konvertieren, wird der Kampf um die Reste umso verbissener", so die These des Buches.
Die Wut richte sich in erster Linie gegen den Staat und die politischen Eliten, die den Bürger nicht nur Aufstiegsmöglichkeiten vorenthalten würden, sondern mittels Steuern und Vorschriften auch noch Steine in den Weg legten. Man verdient kaum noch was - und dann verkündet der Klimaschutzminister, man müsse sich eine neue Heizung anschaffen.
Doch auch Mitbürger würden zum Objekt der Destruktion. Die "Professional-Managerial Class", also jene Gruppe akademisch ausgebildeter Beamter, leitender Angestellter, Lehrer, Erzieher und Journalisten, die für die Durchsetzung von Normen, Sprachcodes und Diversity-Programmen zuständig ist, gerate ebenso ins Visier rechter Bewegungen wie die angeblich wachsende Zahl der "Mitesser" - Arbeitslose, Migranten, Faulenzer -, die sich am nicht mehr wachsenden Kuchen bedient, ohne selbst etwas beizutragen.
Man wünscht sich, dass Amlinger und Nachtwey etwas mehr auf die wirtschaftsgeschichtlichen Determinanten eingegangen wären, die hinter dieser von ihnen geschilderten sozialökonomischen Situation stehen, statt gleich soziologentypisch eine "Nachmoderne" zu verkünden, die passenderweise mit Erscheinen des Buches hereinbricht. Doch auch so ist das vorgetragene Theorem überzeugend genug. Die veränderte politische Lage von einem veränderten Wachstumsregime her zu erschließen, ist eine gelungene Ergänzung zu den vielen Populismuserklärbüchern, die in den vergangenen Jahren erschienen sind.
Überzeugend sind die beiden Autoren außerdem immer dort, wo sie sich ihrem Material zuwenden: einigen Dutzend Gesprächen mit Personen, die libertäre, rechtspopulistische oder destruktive Haltungen pflegen. Sie zeigen, wie das Erleben biographischer Brüche, wie die Erfahrung "blockierten Lebens" dazu führen kann, der Politik hauptsächlich im Modus der Negation zu begegnen. Um aus dem Weg zu räumen, was einem selbst im Wege steht.
"Erst schließt das Krankenhaus", so fassen Amlinger und Nachtwey das rhetorische Schema ihrer Interviewpartner zusammen, "und dann wird es in eine Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Die Straßen sind voller Löcher, und dann lungern Geflüchtete auf öffentlichen Plätzen herum. Marihuana wird legalisiert, und dann wartet man Monate auf einen Facharzttermin." Dieses "Und dann" verknüpft kausal, was sachlich nicht unbedingt zusammengehört. Doch genau so sieht die Welt der Zerstörungslustigen von innen aus: Bedrohte Freiheiten und materielle Ansprüche, die erst verweigert und dann anderen zugesprochen werden.
Alles andere, so muss man leider sagen, ist an diesem Buch konfus. Über viele Seiten hinweg hat man den Eindruck, eine aus vielen Zeitdiagnosen zusammengestoppelte Meta-Zeitdiagnose zu lesen; eine Theorie-Collage, die die Autoren aus ihren Theoriehelden arrangiert haben. Man purzelt von A wie Adorno über B wie Bataille bis Z wie Zizek. Und man glaube nicht, die Buchstaben dazwischen wären ausgelassen worden: Deleuze und Guatarri, Elias und Foucault, Fraser und Freud, Graeber und Gramsci, Habermas und Hall, Jaeggi und Jäger, Lacan und Landa, Löwenthal und Lukács, Marx und Marcuse, Polanyi und Przeworski, Reckwitz und Rosa, Shklar und Sloterdijk geben sich nur so die Klinke in die Hand.
Die von diesen Autoren geborgten Begriffe sind oft nur Versatzstücke, manchmal sogar nur Metaphern - zur Klärung oder gar Argumentation tragen sie sehr selten etwas bei. Man hätte sich gewünscht, Amlinger und Nachtwey hätten sich mehr Zeit für ihren Stoff genommen und ihre Gedanken in ein funktionierendes System gebracht, statt sich hemmungslos im großen Suhrkamp-Abc zu bedienen. Der Eindruck entsteht, die vielen Verweise füllen, was nur angedacht, aber eigentlich nicht durchdrungen ist. So bleibt von den versprochenen "Elementen des demokratischen Faschismus" nur ein Anfang übrig. Aber immerhin dieser ist gelungen.
Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey: "Zerstörungslust". Elemente des demokratischen Faschismus.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 453 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.