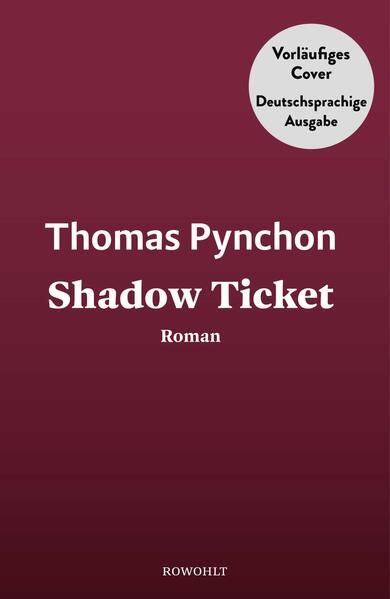Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Nicht mehr seine Staaten
Pünktlich zur Buchmesse erscheint "Schattennummer" - nach elf Jahren endlich wieder ein neuer Roman von Thomas Pynchon. Niemand hat unser Leselebensgefühl so geprägt wie er.
Von Andreas Platthaus
Von Andreas Platthaus
Es gab eine Zeit, da brauchten die Bücher von Thomas Pynchon Jahre, ehe sie auf Deutsch erschienen. Sein Debüt, "V" aus dem Jahr 1963, wurde 1968 beim Karl Rauch Verlag veröffentlicht, nahezu unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit, bis es 1976 ins Taschenbuchprogramm von Rowohlt aufgenommen wurde, begleitet von einem Nachwort der damals gerade erst als Schriftstellerin bekannt gewordenen Elfriede Jelinek. Die spätere Literaturnobelpreisträgerin begann es mit Blick auf die Tatsache, dass der amerikanische Autor schon damals konsequent im Verborgenen lebte, so: "Thomas Pynchon kann man zwangsläufig nur durch das, was er schreibt, kennenlernen."
Wer Pynchon liest, lernt jedoch viel mehr kennen - vor allem sich selbst. Diese Literatur erfordert Zeit, nicht nur zum Übersetzen. Und nicht nur, weil die drei ambitioniertesten Romane, "Gravity's Rainbow" (1973, auf Deutsch 1981 "Die Enden der Parabel"), "Mason & Dixon" (1997, deutsch 1999) und "Against the Day" (2006, deutsch 2008 als "Gegen den Tag") jeweils mehr als tausend Seiten Umfang haben. Pynchons Literatur fordert vor allem heraus, weil sie unter der Maske von meist in der Vergangenheit angesiedelten Grotesken dezidierte Gesellschaftskritik betreibt. Diese Farcen forcieren unsere Aufmerksamkeit für die Gegenwart.
Deshalb betrachte ich als Beginn meines literarischen Lebens die Lektüre von "Die Enden der Parabel" im Februar 1988. Es war mein erster Kontakt mit Pynchons Schaffen, der seitdem nicht mehr abgerissen ist, indem zunächst nachgeholt wurde, was vorher herausgekommen war (neben "V" waren das allerdings nur "Die Versteigerung von No. 49", Pynchons mit weniger als 200 Seiten schmalster Roman, der trotzdem nach der Publikation sieben Jahre gebraucht hatte, bis er ins Deutsche übersetzt war, und eine Handvoll zuvor publizierter Kurzgeschichten, die 1985 im Sammelband "Spätzünder" veröffentlicht wurden), und dann darauf gewartet, was neu erschien. Acht Romane waren das bis 2013; nicht viel für einen damals schon sechsundsiebzigjährigen Autor, dem dank seiner Anonymität ungestörtes Schreiben gestattet ist. Zu wenig jedenfalls für mich.
Immerhin erlaubten die jahrelangen Pausen zwischen Original und Übersetzung jeweils doppelte Lektüren bei den beiden späteren dicken Romanen und bei jenen, die wie "V" um die 500 Seiten hatten: "Vineland" (1990 und 1993), "Inherent Vice" (2009 und 2010 als "Natürliche Mängel") sowie "Bleeding Edge" (2013 und 2014). Die Abstände - man sieht es - wurden kürzer. Denn der Ruhm Pynchons wuchs, gerade auch, weil er sich weiterhin als Person jeder Öffentlichkeit verweigert. Sein literarischer Einfluss kann gar nicht überschätzt werden. Um dazu nur ein paar Namen zu nennen: ohne ihn keine Elfriede Jelinek und kein T. C. Boyle. Unter Jüngeren vergöttern ihn etwa Clemens J. Setz oder Jonas Lüscher. Aber seit mehr als einem Jahrzehnt gab es keinen neuen Roman, und auch wenn zwischen "Gravity's Rainbow" und "Vineland" siebzehn Jahre gelegen hatten, machte das Sorgen bei einem Mann, der im Mai achtundachtzig geworden ist.
Nun aber ist in den Vereinigten Staaten ein neuer Roman von Pynchon erschienen, am vergangenen Dienstag: "Shadow Ticket". Und die deutsche Übersetzung folgt nicht etwa in einem Jahr, sondern binnen einer Woche, als "Schattennummer". Dieses Tempos wegen haben sich dafür abermals Nikolaus Stingl (sein erster Solo-Pynchon als Übersetzer war "Mason & Dixon") und Dirk van Gunsteren (dessen erster war "Vineland") zusammengetan, wie sie es mengen- statt zeitbedingt schon für die 1600 Seiten von "Against the Day" getan hatten. Beider langjähriger Vertrautheit mit dem Autor (und miteinander) verdankt sich, dass der unnachahmlich ironische Pynchon-Sound auch im Deutschen trotz höchster Übersetzungseile zuverlässige seine Fortsetzung findet. Was nicht selbstverständlich ist bei einem Autor, der mit der Sprache und den Namen seiner Protagonisten ebenso lustvoll zu spielen pflegt wie mit den Fixpunkten der Weltgeschichte. Daran hat sich auch im neuen Buch nichts geändert.
Diesmal führt Pynchon uns ins Jahr 1932, mitten in die Weltwirtschaftskrise und ins letzte Jahr der Prohibition in den Vereinigten Staaten. Handlungsort der ersten Hälfte des Romans ist Milwaukee, Wisconsin, die amerikanische Bier-Hauptstadt, der das Alkoholverbot schon Jahre vor dem Schwarzen Freitag ein ökonomisches Desaster beschert hat. Dafür blüht der Schwarzhandel: Über den Lake Michigan laufen die Schmuggelrouten von Kanada, und der Dauereinsatz von lokalen und Bundesbehörden ändert nichts am steten Zustrom der Getränke für die Flüsterkneipen. Auf dem See und in den Speakeasies und überhaupt nahe allen Abgründen der Stadt bewegt sich Hicks McTaggart, Angestellter der Detektei "Unamalgamated Ops" (was man als "Unvermischte Ermittlungen" übersetzen könnte, aber Pynchons sprechende oder skurrile Namen sind für die Übersetzer immer schon sakrosankt gewesen).
Das Leitmotiv der Dynamit-Attentate aus "Against the Day" eröffnet auch das neue Buch, als mitten in Milwaukee ein vom Kleinkriminellen und Polizeischnüffler Stuffy Keegan zum Alkoholtransport genutzter REO Speed Wagon in die Luft geht. Doch Stuffy entkommt dem Attentat und taucht unter. Wie auch Daphne, die Tochter von Bruno Airmont, dem "Al Capone des Käses" (Milcherzeugung ist das zweite ökonomische Standbein in Wisconsin). Die bildhübsche junge Dame ist ihrem reichen Verlobten mit einem Klarinettisten ausgebüxt. Da Hicks einige Jahre zuvor Daphne durch beherzten Einsatz vor der Zwangseinlieferung in eine Klapsmühle bewahrt hat, vertraut man ihm die Suche nach der Verschwundenen an, doch alsbald ist der ebenso ledige wie lebensfrohe Detektiv dermaßen verstrickt in die Wirren nicht nur dieser Affäre, sondern auch der um den Sprengstoffanschlag - so sehr, dass sein Arbeitgeber beschließt, ihn nach Europa zu entsenden, um ihn aus der Schusslinie zu bringen. Dort ist die Jazzband des Klarinettisten auf Tour. Und dass Stuffy Keegan sich mit einem seit dem Ersten Weltkrieg unentdeckt die Weltmeere (und auch den Lake Michigan) durchstreifenden österreichisch-ungarischen U-Boot abgesetzt haben soll, rechtfertigt die Entsendung von Hicks zusätzlich.
Nur ist in Europa, dem Schauplatz der zweiten Hälfte des Romans, noch mehr der Teufel los als in den wirtschaftskrisengeschüttelten USA: Ein Mann namens Hitler war zwar schon Hauptgesprächsthema an den Tischen der vielen deutschstämmigen Einwohner von Wisconsin, und Mussolini hat in Italien, dem Herkunftsland so mancher im amerikanischen Alkoholschmuggel engagierten Organisation, schon vor zehn Jahren eine Form von Politik etabliert, die im Großen so funktioniert wie das Bandengebahren in Milwaukee im Kleinen, doch was Hicks und die ihm auf seiner Reise zahlreich begegnenden Kollegen aus aller Herren Länder und aller dieser Länder Geheimdienste sowie seine amerikanischen Landsleute - nicht nur Stuffy und Daphne, sondern auch Bruno, der in der Schweiz, wo das Fondue gerade zum Nationalgericht erklärt worden ist, einen schwunghaften Käseschwindel beginnt ("es war wie während der Probition, nur anders") - in Europa erleben, das spottet jeder Beschreibung. Weshalb sie hier auch abbricht. Einen Pynchon-Roman kann man nicht nacherzählen, nur miterleben.
Der vertrauten Motivketten aus dem Kosmos dieser Bücher sind viele: das durch die Zeiten flottierende Kriegsgerät etwa und die (in dieser Rezension nur angedeuteten) amourösen Verwicklungen. Oder eine Tischlampe, "die unter Lampensammlern als das Kronjuwel geschmackloser Lampen gilt, ja als eine so verblüffend geschmacklose Lampe, dass sie die Kategorie der geschmacklosen Lampe selbst ad absurdum führt. So entsetzlich geschmacklos, dass sie niemals fotografiert worden ist" - schreibt der Mann, der sich nie fotografieren lässt und mit seinen verblüffenden Grotesken die Kategorie der grotesken Literatur ad absurdum geführt hat. Etwa durch die legendäre Glühlampe aus "Gravity's Rainbow", die nie durchbrennt und deshalb von einer um ihre Umsätze besorgten Glühlampenindustrie gejagt wird. Dass Pynchon in seinen Romanen so konsequent aufs Lampenmotiv setzt, darf betrachtet werden als sardonische Ironisierung von enlightenment - Aufklärung. Die aber in den Romanen eben doch ständig Thema ist: in detektivischem wie gesellschaftlichem Sinne. Denn unterfüttert ist die delirierende Handlung von "Schattennummer" wie schon bei allen ihren Romanvorläufern durch die politischen Realien ihrer Zeit.
Pynchons politischster Roman bleibt dabei zweifellos der vorletzte, "Bleeding Edge": sehr nahe an der Gegenwart angesiedelt, im New York des März 2001, also kurz vor dem 11. September - einem Einschnitt, der eines allerdings unverändert ließ: das, was uns die Techbranche eingebrockt hat. Pynchon brachte das in seinem Buch auf den Punkt. Solch einen apokalyptischen Anspruch hat die lustvolle Vaudevillehandlung von "Schattennummer" auf den ersten Blick nicht zu bieten, doch im Schatten auch dieser Prosa lauert ein Dämon.
Denn das Ende, ein Buchschluss im besten Pynchon-Pathos, sieht einen Teil der Milwaukee-Entourage Anfang 1933 aus Budapest über den Atlantik zurückkehren in die USA: "Irgendwo weit jenseits des westlichen Randes der Alten Welt, heißt es, steht ein Wunder unserer Zeit, die etliche hundert Meter hohe Statue einer maskierten Frau in nicht so sehr zeremonieller als vielmehr gefechtsmäßiger militärischer Montur." Nicht Lady Liberty also, Lady Lockdown könnten wir sie nennen. "Die U-13 fährt, aufgetaucht, langsam vorbei, und alle sind an Deck, um sich die Staue anzuschauen. Sie ist kilometerweit zu sehen, bis unermesslich gewaltige Nacht um sie herabsinkt. 'Die Freiheitsstatue', vermutet Bruno. 'Nein', erwidert Stuffy. 'Es gibt keine Freiheitsstatue, Bruno, nichts dergleichen, jedenfalls nicht da, wo du hingehst. Es sind die Vereinigten Staaten, aber nicht die, die du verlassen hast." In denen ist auch im Roman realgeschichtsgetreu Franklin D. Roosevelt zum Präsidenten gewählt, doch dann nur anderthalb Minuten nach seiner Amtseinführung durch einen Staatsstreich gestürzt worden - der sich etablierende Totalitarismus lässt Europa einmal mehr alt aussehen.
Thomas Pynchon spricht also immer weiter von den Gefahren unserer Gegenwart. Was für ein Gedanke, dass er das bald wohl nicht mehr tun wird, dass wir nicht mehr neue Romane von ihm erwarten dürfen, die unsere Zeit in furiose Farcen fassen. Es wird ein anderes literarisches Leben sein. Nicht mehr das meine.
Thomas Pynchon: "Schattennummer". Roman.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren. Rowohlt Verlag,
Hamburg 2025.
398 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.