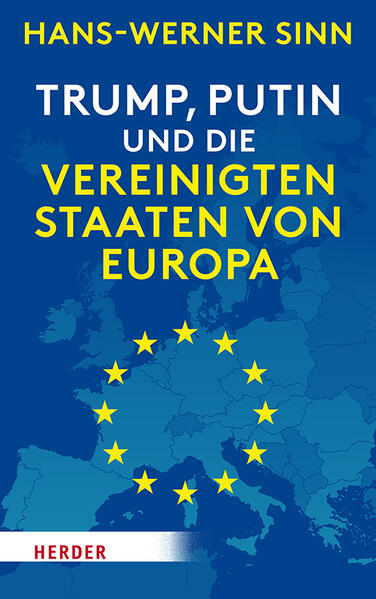Besprechung vom 14.10.2025
Besprechung vom 14.10.2025
Sachbücher für Ökonomen
Am Mittwoch startet die Frankfurter Buchmesse. Mit welchen Themen befassen sich die Wirtschaftstitel in diesem Jahr? Eine kleine Auswahl.
Der Junge aus Seattle
Wer etwas über Bill Gates lesen möchte, muss nicht lange suchen. Geschrieben wird und wurde schließlich reichlich über ihn. Mit dem Aufstieg von Microsoft wurde der Junge aus Seattle eine der prägendsten Unternehmerfiguren der Welt, für die einen das gute "Tech-Genie", für andere der Prototyp eines gerissenen Kapitalisten. Unabhängig davon, wie man die Person Gates bewerten mag: Der Mann hat der Welt seinen Stempel aufgedrückt und ein Vermächtnis geschaffen, das schwerlich zu ignorieren ist. Das allein ist Grund genug, um sich mit dieser Person näher zu beschäftigen.
Mit "Source Code" steht dafür nun ein Buch zur Verfügung, das nicht über Gates, sondern - zumindest offiziell - von ihm persönlich geschrieben wurde. Es ist der erste Teil seiner Autobiografie, weitere wurden angekündigt. Auf knapp 400 Seiten führt Erzähler und Autor "Bill" darin durch die Kindheit und Jugend des Mannes, der einmal zu einem der mächtigsten der Welt werden soll. Vom Leistungsgedanken der Eltern, die ihren Sohn von Beginn an auf Wettkampf und Erfolg geeicht haben, zu einem Teenager, der bis zur Besinnungslosigkeit programmierte - und beim Mathestudium in Harvard das Scheitern lernte. Garniert wird die Geschichte mit Bildern aus dem Familienalbum. "Source Code" dürfte nicht nur bei Microsoft-Enthusiasten auf Interesse stoßen. nkur.
Bill Gates: Source Code - Meine Anfänge. Piper, München 2025, 384 Seiten, 24 Euro
Wirtschaftshistorie im Schnelldurchlauf
Der Australier Andrew Leigh spannt in seinem Buch "Die kürzeste Geschichte der Wirtschaft" auf knapp 260 Seiten einen sehr weiten Bogen durch die Geschichte der Menschheit von der neolithischen Revolution vor rund 12.000 Jahren über das Zeitalter der Segelschiffe bis zur Industrialisierung und der modernen Globalisierung heute.
Dem früheren Wirtschaftsprofessor und heutigen Politiker - dessen politische Haltung auf dem Klappentext als "sozialliberal" beschrieben wird - ist dabei ein kurzweiliges und lesenswertes Buch gelungen. Er kann anschaulich und interessant erzählen. Sein Ziel ist, herauszuarbeiten, welche grundlegenden ökonomischen Kräfte die Weltgeschichte geprägt haben. Dazu gehören etwa die Vorteile der Arbeitsteilung und des Handels, Erfindungen wie die des Geldes und des Rades, aber auch die richtigen Anreize und die richtigen Institutionen. Leigh webt dabei immer wieder schmückende Anekdoten ein. Im Buch geht es nicht nur um Wirtschaftsgeschichte, sondern auch um die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften und einiger ihrer Schlüsselfiguren wie Adam Smith, David Ricardo oder Alfred Marshall. Zudem finden sich quer durch das Buch gestreut kleine, lesenswerte Kästen mit Exkursen, in denen Erkenntnisse aus Spezialdisziplinen der Ökonomie erläutert werden: etwa über die Ökonomie des Sports, der Schönheit und der Religion. tine.
Andrew Leigh: Die kürzeste Geschichte
der Wirtschaft. Piper Verlag, München 2025, 256 Seiten, 22 Euro.
Sam Altman, der die KI zu den Menschen brachte
Wer ist Sam Altman? Der Mitgründer und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Open AI ist für viele so etwas wie das menschliche Gesicht der Künstlichen Intelligenz. Sein Team hat durch das Dialogsystem ChatGPT diese Technologie erstmals einem Milliarden-Publikum rund um die Welt zugänglich gemacht. Seither haben nicht nur Fachleute eine konkretere Vorstellung davon, was KI kann und können könnte. Doch wieso ausgerechnet Altman? Und wer ist der in diesem Jahr 40 Jahre alt gewordene Ausnahme-Unternehmer eigentlich? Die amerikanische Journalistin Keach Hagey erzählt seine Geschichte. Für ihre umfangreiche Biographie hat sie mit ihm und vielen Freunden, Verwandten und Wegbegleitern gesprochen. Sie beschreibt die Gründungsphase von Open AI und die Turbulenzen, als Altman vorübergehend rausflog. Sie geht aber auch ausführlich auf Altmans berufliches und privates Leben vor Open AI ein, etwa an der Spitze der kalifornischen Start-up-Schmiede Y Combinator, oder darauf, wie ihm das Internet in jungen Jahren dabei half, seine Homosexualität besser zu verstehen. Wer Altman kennenlernen und die Vision erfassen möchte, die ihn und seine Mitstreiter antreibt, der wird in diesem Band fündig. Altman ist anders als Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs oder Bill Gates. Aber am Ende vermutlich nicht weniger erfolgreich. ala.
Keach Hagey: Sam Altman - OpenAI,
Künstliche Intelligenz und der Wettlauf um unsere Zukunft. Quadriga Verlag, Köln 2025, 480 Seiten, 28 Euro
Die Zukunft Eurasiens entscheidet über die Macht in der Welt
Die Frage, ob die Vereinigten Staaten unter Donald Trump weiterhin ein zuverlässiger NATO-Partner bleiben, wird in Europa kontrovers und häufig ängstlich diskutiert. Die Antwort auf die Frage hängt davon ab, wie Trump die amerikanischen Sicherheitsinteressen definiert. Der Politikwissenschaftler Hal Brands liefert in einer faktengesättigten Analyse Argumente, warum sich die amerikanischen Interessen weniger ändern könnten als befürchtet. Auf der Basis älterer geopolitischer Arbeiten entwickelt Brands die These, dass sich die US-Außenpolitik weniger ändern könnte als oft angenommen. Er sieht seit dem Ersten Weltkrieg eine Kontinuität, in der die USA mit meist demokratischen Verbündeten bestrebt sind, wichtige Randgebiete des eurasischen Doppelkontinents vor der Kontrolle durch autokratische Mächte zu bewahren. Denn wer die Landmasse Eurasien beherrscht, dürfte als führende Weltmacht unangefochten sein. Die Kontrolle setzt aber die Herrschaft über die wirtschaftlich wichtigen Randgebiete voraus. Daher engagierten sich die Amerikaner nach 1945 in Europa ebenso wie in Ostasien, um den Vormarsch von Moskau und Peking aufzuhalten. Brands sieht diese Frontstellung auch heute wieder gegeben, nur ist China heute viel stärker als Russland. Daher richten die Amerikaner ihr Interesse stärker auf den pazifischen Raum, während sie von den Europäern größere Eigenanstrengungen für den Schutz des westlichen Randgebiets erwarten. gb.
Hal Brands: The Eurasian Century
Hot Wars, Cold Wars, and the Making of the Modern World. Norton, 320 Seiten, 29 Euro.
Die Geschichte der Wirtschaftskriege
Der Kalte Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion war nicht schön, aber er etablierte eine klare Weltordnung mit zwei berechenbaren Hauptakteuren. Nach dessen Ende hat sich ein globaler Wettlauf unterschiedlicher Mächte entwickelt, in dem viele Länder glauben, sie verlieren, wenn ein anderes Land gewinnt. Die Handelskonflikte sind damit unübersichtlicher geworden und haben sich teils deutlich verschärft, vor allem zwischen den Vereinigten Staaten und China, aber auch zwischen dem Westen und Russland und zwischen Europa und Amerika mit Donald Trumps Zollpolitik. Zudem bietet der Nahe Osten ein völlig zerrissenes Bild, in Südasien lässt die wachsende Rolle von Indien und Indonesien neue Konflikte erahnen.
Der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe schreibt in seinem lesenswerten Buch, dass es gerade die friedlichen Zeiten seien, in denen die rasche wirtschaftliche Entwicklung den Keim für neue Konflikte lege. Er blickt zurück auf Wirtschaftskriege der Vergangenheit, angefangen bei der Rivalität zwischen Spanien und Portugal im 15. Jahrhundert um die Neue Welt, über die Napoleonische Kontinentalsperre gegen Großbritannien bis hin zur Rückkehr heftiger wirtschaftlicher Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren. "Es gibt keinen roten Faden, mit dem sich Wirtschaftskriege aneinanderreihen lassen", schreibt Plumpe, "aber die Ereignisse greifen dennoch ineinander." F.A.Z.
Werner Plumpe: Gefährliche Rivalitäten. Wirtschaftskriege - von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Deal-Politik. Rowohlt, Berlin 2025, 320 Seiten, 25 Euro.
Die Schattenseiten der Tech-Imperien
In ihrem Buch "Digitaler Kolonialismus" gehen der Tech-Journalist Ingo Dachwitz und der Globalisierungsfachmann Sven Hilbig der Frage nach, welche Folgen der Aufstieg der großen Techkonzerne für den globalen Süden hat. Es sind oft keine guten. In den Erfolgsgeschichten des Silicon Valley würden die Schattenseiten nur allzu gerne ausgeblendet. Zum Beispiel das Milliardengeschäft mit der "Content Moderation", für das meist junge, gut ausgebildete Menschen im globalen Süden in outgesourcten Unternehmen für US-Techgiganten zum Billiglohn die Inhalte sozialer Medien "moderieren" oder toxische Daten aus den Trainingsdaten für große KI-Modelle filtern, also unter hoher psychischer Belastung von Inhalten mit Pornographie, Gewalt, Folter, Hass und Kindesmissbrauch säubern. Auch die menschenunwürdigen Bedingungen kommen zur Sprache, unter denen Rohstoffe wie Kupfer, Silizium, Gold, Kobalt und Lithium abgebaut werden, die zum Beispiel für wiederaufladbare Batterien, Smartphones und Notebooks gebraucht werden. Zudem machten sich viele soziale Medien auch zu Handlangern von autoritären Regimen, die stark digital aufrüsten - etwa mit Überwachungstechnologien und Cyberwaffen. Das Buch war nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2025. F.A.Z.
Ingo Dachwitz und Sven Hilbig: Digitaler Kolonialismus: Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. C.H.Beck, München 2025, 351 Seiten, 28 Euro.
Der Dollar als Machtmittel
Der aggressive Aktionismus des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat ein Machtmittel wieder einmal in den Fokus gerückt, das eher unscheinbar daherkommt: den Dollar. Er ist nach wie vor die wichtigste Währung der Welt, ein beträchtlicher Teil des internationalen Handels zumal von Rohstoffen wird darin abgewickelt. Und dies auch dann, wenn Käufer und Verkäufer beide gar nicht in den Vereinigten Staaten beheimatet sind.
Immer wieder suchen einzelne Länder oder Ländergruppen nach Wegen aus dieser "Dollar-Dominanz". Doch warum ist der Dollar eigentlich so bedeutend? Und wie wurde er es? Der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff beantwortet diese Fragen in einem Buch, dessen Titel einem Bonmot des früheren amerikanischen Finanzministers John Connally entlehnt ist, der zu Beginn der Siebzigerjahre den Europäern sagte: Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Rogoff zählt zu den führenden Fachleuten für internationale Wirtschaftsfragen. Er war Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und ist damit auch mit der währungspolitischen Praxis bestens vertraut. In seinem Buch schildert er die theoretischen und historischen Hintergründe des Dollar-Aufstiegs. Und bringt Anekdoten ein wie etwa sein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Zhu Rongji. ala.
Kenneth Rogoff: Our Dollar, Your Problem. Aufstieg und Fall des Dollars und was seine Instabilität für uns und die globalen Finanzmärkte bedeutet. Finanzbuch Verlag, München 2025, 384 Seiten, 25 Euro.
Der Aufstieg von Nvidia
Nvidia hält die Welt in Atem. Liefert der amerikanische Halbleiterkonzern doch jene elektronischen Bausteine, die im Zentrum der digitalen Revolution stehen: KI-Chips. Das Unternehmen hat sich dank einer jahrzehntelangen Entwicklungsarbeit und einer hochriskanten, aber bis heute geglückten Geschäftsstrategie quasi ein Monopol erarbeitet. Und das zahlt sich aus. Es gibt den Takt der technischen Entwicklungen vor, bewegt die Märkte und Börsen, ganze Industrien und Wirtschaftszweige. Stephen Witt stellt in seinem Buch ein Unternehmen vor, das sich aus kleinsten Anfängen zum wertvollsten Konzern der Welt hochgearbeitet hat. Er nähert sich seinem Thema mit viel Respekt und Kritik, mit Faszination und Verve. Witt hatte Nvidia 25 Jahre fest im Blick. Erst als Analyst, dann als Journalist. Er hatte Zugang zu erstklassigen Quellen: zu den Gründern, zu zahlreichen Mitarbeitern und wichtigen Geldgebern. Seine Recherchen verknüpft er zu einer flott erzählten Geschichte, die zwei Handlungsstränge verfolgt: einerseits den Aufstieg des als Kind von Taiwan nach Amerika gekommenen Jensen Huang, der sein Englisch in einem Heim für Schwererziehbare in Kentucky gelernt und mit 30 Jahren dann Nvidia gegründet hatte. Mit seinem zweiten Erzählfaden nimmt Witt den Aufstieg des Chipherstellers an die Weltspitze auf. Er verhalf der KI zum Durchbruch und trat eine technische Revolution los. fib.
Stephen Witt: The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Campus Verlag, Frankfurt/New York 2025, 320 Seiten, 32 Euro.
Amerikas Linksliberale debattieren Versäumnisse
In Amerika ist das Buch unter dem Originaltitel "Abundance" (Überfluss) ein Bestseller unter den Sachbüchern. Der "New York Times"-Meinungskolumnist Ezra Klein und sein Kollege Derek Thompson vom Magazin "The Atlantic" gehen dabei der Frage nach, wie eine bessere Zukunft in Amerika aussehen könnte. Sie bezeichnen sich selbst als linksliberal, wollen in dem Buch aber gerade die Versäumnisse "der breiteren Linken" in den Blick nehmen. Das Pochen vieler Linker auf Wachstumsverzicht sei kontraproduktiv. Leider gäben viele von den Demokraten regierte US-Bundesstaaten keine gute Figur ab. Viele gut gemeinte Regulierungen würden den Fortschritt ausbremsen. Kalifornien dient ihnen als prominentes Negativbeispiel: Dort würde seit Jahrzehnten ein Hochgeschwindigkeitszug zwischen Los Angeles und San Francisco geplant, aber nicht gebaut, weil sich die Umsetzung im Klein-Klein verliert. Anders als früher könnten dort vor lauter Regularien auch kaum noch günstige Wohnungen gebaut werden: Die Folge sei eine hohe Obdachlosigkeit gerade in demokratisch regierten Städten. Laut den beiden Autoren haben sich viele amerikanische Linksliberale in den vergangenen Jahrzehnten zu sehr auf die Nachfrageseite der Wirtschaft konzentriert und dabei die Angebotsseite vernachlässigt. Der frühere US-Präsident Barack Obama bezeichnete das Buch als "Pflichtlektüre für Progressive". tine.
Ezra Klein und Derek Thompson: Der neue Wohlstand. Was wir für eine bessere Zukunft tun müssen. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2025, 368 Seiten, 28 Euro.
Die Vereinigten Staaten von Europa
Hans-Werner Sinn hat die wirtschaftspolitische Debatte der Bundesrepublik seit der Jahrtausendwende geprägt wie wenige andere Ökonomen. Der ehemalige Präsident des Ifo-Instituts in München brachte sich zu nahezu allen bedeutenden Themenkomplexen ein: zur Energiewende, zu der Eurokrise, der Exportorientierung und zur Staatsverschuldung. Nun hat er ein Buch verfasst, das weit über eine ökonomische Analyse hinausreicht, Sinns bislang politischster und vielleicht engagiertester Band: Er schreibt über die Bedrohung Europas und schlägt vor, wie der Kontinent sich verhalten soll, um zu bestehen. Sinn thematisiert einerseits den russischen Angriff auf die Ukraine und die Folgen für uns. Andererseits befasst er sich ausführlich mit dem Gebaren der amerikanischen Regierung unter Donald Trump, und damit, wie sich die Vereinigten Staaten entwickeln - auch in diesem Fall blickt er zurück und versucht, das nicht nur ihn erschreckende Geschehen historisch herzuleiten. Er leitet aus alldem ab, dass Europa nun enger zusammenrücken muss, ein "Europäischer Bund" entsteht, der etwa über eine echte und schlagkräftige europäische Armee verfügt. Sinn verneint ganz und gar nicht die strukturellen Probleme der EU wie der Währungsunion. Und ist gleichwohl zuversichtlich, dass nun der Zeitpunkt für einen solchen Schritt gekommen ist - weil die Not groß ist. ala.
Hans-Werner Sinn: Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa. Herder Verlag, Freiburg 2025, 352 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.