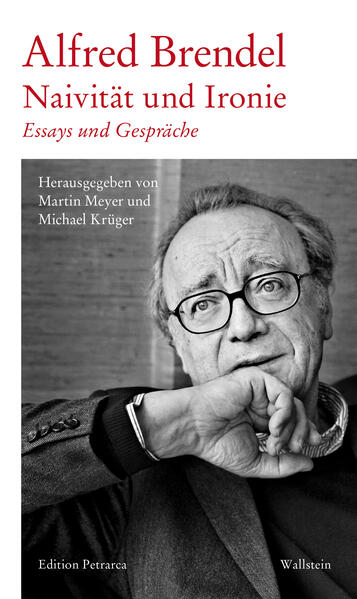Besprechung vom 21.06.2025
Besprechung vom 21.06.2025
Produktiv beunruhigt
Alfred Brendel über Musik, Literatur und das Alter
Alfred Brendel war als Pianist und Musiker auch deswegen eine singuläre Erscheinung, weil er, beginnend mit seinem 1976 erschienenen Band "Nachdenken über Musik", seiner Konzerttätigkeit eine ganze Fülle von Texten gegenübergestellt hat, die jedoch nicht etwa autobiographische oder didaktische Erläuterungen sein wollten, sondern der Form des Essays genügen. Dabei hat er die Grenzen dieser Form immer wieder elegant überschritten, und zwar in zwei Richtungen: die des absichtsvoll rhapsodischen Gesprächs als inszenierter Form des "Nachdenkens" und die der Lyrik, bei Brendel oft eine surreale Verdichtung dessen, was in "geordneter" Prosa nicht mehr darstellbar ist.
Sein Band über "Sinn, Unsinn und Musik" von 2018 beginnt mit der Feststellung, dass man gerne gleich von Unsinn rede, "wenn der Boden der Vernunft unter den Füßen wankt". Doch die voreilige "Gewöhnung an den Sinn" habe nur den Blick für das Ungewöhnliche verengt. Kurzum: Alfred Brendel war ein Autor, der gerade von diesem Ungewöhnlichen fasziniert war und ihm nachspüren wollte.
So hellsichtig musikalische Interpretation bei ihm sein konnte, seine Texte verstanden sich eben nicht als erläuternde Ergänzung, sondern als komplementäre Erscheinung, als Wille zur Reflexion und Verdichtung gleichermaßen. Virtuos ist beides, Brendels Tastenspiel und Brendels Buchstabenspiel, aber dies nie als Selbstzweck, sondern stets als Versuch, der so rätselhaften Erscheinung der Musik auf eine andere Weise näher zu kommen. So provozierte jede gesuchte neue Nähe bei ihm stets auch eine neue, eine unerreichbare Ferne.
Der nun letzte zu seinen Lebzeiten erschienene Band mit Essays und Gesprächen ist wiederum ein solcher Glücksfall der produktiven Beunruhigung. In ihm werden Texte vereint, die teilweise an entlegenen Stellen publiziert wurden, ergänzt um drei Gespräche, deren letztes dem Altern gilt. So prägte eine gewisse Geste des Abschieds diesen Band, aber ohne Sentimentalität. Wer in diesem Lebensalter als Ideal einer gelungenen Mozart-Interpretation die "Fusion von Frische und Verfeinerung" benennt, der ist gegen alle Rührseligkeit gefeit.
Herzstück des Buchs ist der eröffnende Text über "Goethes musikalische Bedürfnisse", die Brendel unter der Signatur von "Naivität und Ironie" fasst. In einem ebenso konzisen Plädoyer sortiert er Goethes immer wieder diskutiertes Verhältnis zur Musik neu. An Haydns "Schöpfung" bemerkte der Dichter eine Synthese von Naivität und Ironie, die den wahren Komponisten auszeichne. Die Musik sei also in der Lage, diese beiden für unversöhnlich gehaltenen Eigenschaften mühelos miteinander zu verbinden. Die Bewunderung für diese synthetische Kraft zeichne Goethes Verhältnis zur Musik aus. Ein Text zum entsprechend schwierigen Verhältnis zwischen Goethe und Beethoven steht am Schluss des ersten Teils der Sammlung, dazwischen finden sich feinsinnige Beobachtungen zu Haydn, Mozart und Beethoven.
Drei Gespräche beschließen den Band, eines über Busoni (mit Peter Paul Kainrath), ein wunderbar autobiographisches über den Roman (mit Paul Holdengräber) - und ebenjenes "über das Altern", das mit den beiden Herausgebern geführt wurde. Es ist ein eindrucksvoller Rückblick nicht auf eine musikalische Weltkarriere, sondern auf die Bedeutung, welche die Musik für den Menschen haben kann. Brendels "Wörterbuch der Vorurteile in der Musik" war nur ein Plan, doch hier ist erkennbar, worauf er zielte: das voreilig Gewusste sofort infrage zu stellen, jede musikalische Entscheidung umgehend zu überdenken. Für Brendel ist daher auch das Klavier ein "Ort der Verwandlung", es gehe um "transzendentale Zauberei".
Dies komme dem Sinn der Musik nahe - in einer Welt, die derzeit nur davon besessen sei, sich allzu schnell verändern zu wollen. Und da gerät der Boden auf einmal wieder anregend ins Wanken, in der angestrebten Synthese von Naivität und Ironie. So steht auch dieses Buch der Musik nicht gegenüber, denn beide bedingen sich gegenseitig. Vielleicht wäre Brendel selbst damit nicht einverstanden gewesen, genau dies als ein wahres Glück für den Leser zu bezeichnen. Es ist aber eines. LAURENZ LÜTTEKEN
Alfred Brendel: "Naivität und Ironie". Essays und Gespräche.
Hrsg. von Martin Meyer und Michael Krüger. Wallstein Verlag, Göttingen 2025. 139 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.