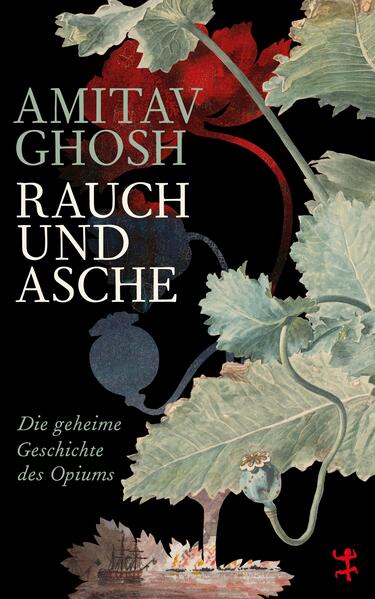
Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal.
Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
432
Autor/Autorin
Amitav Ghosh
Übersetzung
Heide Lutosch
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
596 g
Größe (L/B/H)
218/144/34 mm
ISBN
9783751820561
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 13.05.2025
Besprechung vom 13.05.2025
Sucht muss man zu erzeugen wissen
Unter dem Eindruck der Opioid-Krise und verknüpft mit der eigenen Familiengeschichte: Amitav Ghosh erzählt die Geschichte des Opiums.
Viele Pflanzen verdanken ihre globale Verbreitung Kolonisationsprozessen. Das gilt auch für den Schlafmohn, aus dem Opium gewonnen wird. Die Grundzüge der Geschichte sind gut bekannt. Seit Menschengedenken wird die Pflanze, von der es keine wilde Form zu geben scheint, als Arznei kultiviert, aber auch als psychoaktiver Stoff genutzt. Das geschah lange in geringem Umfang vor allem bei Angehörigen von Eliten. Opium wurde zunächst getrunken, seit dem siebzehnten Jahrhundert aber auch geraucht, was (noch) stärker abhängig machte.
Im Verlauf des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts gewann Schlafmohn zunächst für das niederländische, dann für das britische Imperium zentrale Bedeutung. Dem rasant ansteigenden Bedarf an Gewürzen und Tee stand wenig Nachfrage nach europäischen Produkten gegenüber. Die in China begehrten Pelze aus Nordamerika waren nicht in hinreichenden Mengen verfügbar, um die Handelsbilanz auszugleichen. Silber floss somit rascher ab, als es gefördert werden konnte. In dieser Situation kam die britische Kolonialverwaltung auf die Idee, die niederländische Praxis in Südostasien zu kopieren, den Anbau von Opium zu forcieren und in China für Nachfrage zu sorgen.
Das chinesische Einfuhrverbot wurde zunächst durch Schmuggel unterlaufen. Als der chinesischen Regierung die Unterdrückung des Imports Ende der Dreißigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts fast gelang, wurde der Markt durch den Opiumkrieg mit Gewalt geöffnet. Der Export stieg rasch an: von 200 Kisten 1729 auf 30.000 Kisten 1830 und rund 106.000 Kisten im Spitzenjahr 1880. Entsprechend stark wuchs die Zahl der Süchtigen; in Europa und Nordamerika unterlag Opium als Gift dagegen medizinischer Kontrolle. Das führte zu wachsender Kritik und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zur Einschränkung des grenzüberschreitenden Opiumhandels.
Eine Folge dieses Kurswechsels war die Verdrängung der Geschichte dieses Handels aus dem Gedächtnis der beteiligten Regionen, Familien und Firmen. Amitav Ghosh hat diesem Thema bereits in der fulminanten Trilogie seiner Ibis-Romane nachgespürt. "Rauch und Asche" ist eine Art Sachbuch zu dieser Trilogie. Es behandelt Recherchen und Reisen des Autors, tritt in Dialog mit den Ergebnissen historischer Forschung, die teilweise durch Ghoshs Romane angestoßen wurde, und diskutiert Implikationen für die Gegenwart, die eine analoge Opioid-Krise durchlebe.
Ghosh beginnt mit den zwei Modellen des Umgangs mit Opium in Indien. Im Osten regierte die Opiumbehörde der East India Company. Sie zwang Bauern dazu, in Bihar die weiße Varianten des Schlafmohns anzubauen und zu niedrigen Preisen abzugeben. Die Monokultur beförderte Hungersnöte, Abhängigkeit, Verarmung und Auswanderung. Die Verarbeitung erfolgte in zwei hochmodernen Fabriken, von denen die in Ghazipur seit 1789 ununterbrochen Opiumprodukte herstellt, die heute den ungebrochenen medizinischen Bedarf decken. Die Produktion wurde von der East India Company versteigert und aus Kalkutta exportiert. Ein Großteil der Ware ging in die Nähe der ausländischen Niederlassungen vor Guangzhou, von wo aus sie ihre Käufer bis 1842 über kriminelle Schmugglernetzwerke erreichte.
Im Westen Indiens war bunter Schlafmohn ein lukrativer Nebenerwerb. Er wuchs am Rand von Feldern, wurde von Händlernetzwerken aufgekauft, verarbeitet und über Bombay nach China gebracht. Der Gewinn floss unter anderem in die Gründung prominenter indischer Industriekonzerne. Amerikanische Kaufleute aus Boston bildeten ein drittes Netzwerk. Sie trugen vor allem technische Innovationen bei und hatten als Erste die Idee, schwimmende Opiumlager vor der chinesischen Küste anzulegen.
Ghoshs Panorama stützt sich auf Forschungsliteratur, archivalische Quellen und subtil interpretierte Bilder. Es zeichnet ein bedrückendes Bild von Gier, Menschenverachtung und Rassismus; er schreibt selbst, dass er oft versucht war aufzugeben. Das Buch erweist sich aber gerade wegen der Ambivalenzen und verborgenen Verbindungen, die es zutage fördert, als überaus lesenswert. Ghosh erzählt von der eigenen Familiengeschichte, einige Vorfahren waren im Dienst der Opiumbürokratie nach Chhapra gekommen. Sie waren damit entfernte Kollegen von Richard W. Blair, der 1903, als sein Sohn Eric Blair (George Orwell) in Nordindien zur Welt kam, für dieselbe Institution arbeitete. Man erfährt, dass der Opiumhandel hinter dem Export des "englischen" Gartens von China nach Europa stand, dass in Guangzhou nicht nur Handel getrieben, sondern massenhaft Porträts für europäische und amerikanische Landsitze gemalt wurden oder dass die kollektive Einlagensicherung von Banken von China nach New York kam.
Ghoshs Blick auf China ist weniger intensiv als der auf Indien, die Kolonialmächte oder die USA. Die Erfahrungen der Opioid-Krise in den USA, die er eindringlich schildert, legen für Ghosh aber Fragen nahe, die vielleicht weitere Forschungen anregen. Er sieht in Entwicklungen wie dem Rückgang des Vertrauens in die medizinischen Professionen, in die moralische Integrität von Eliten und in die Fähigkeiten der staatlichen Verwaltung deutliche Analogien zwischen der East India Company im neunzehnten und Purdue Pharma im 21. Jahrhundert. Ob das etwa auch für die Raten der Abhängigkeit, den Schwerpunkt der Sucht bei schwer körperlich Arbeitenden oder der Beteiligung von Ärzten und Apothekern bei der Bewerbung und Vermarktung gilt, das sind zu klärende Fragen, die Ghoshs Buch indirekt aufwirft.
In Ghoshs Erzählung nimmt die Pflanze selbst eine zentrale Stellung ein. Kolonialherren, Soldaten, Händler: Alle "dienen in Wirklichkeit den Zwecken eines Wesens, dessen Vitalität und Macht sie nicht anzuerkennen vermögen", einer Pflanze, die Menschen dazu verführt, sie zu vermehren, und die es möglicherweise darauf anlegt, "dass der Homo sapiens als das unglaublich gefährliche Tier, das er ist, auf Dauer nicht überlebt". Ghosh sieht in Opium ein von anderen psychoaktiven Substanzen kategorial verschiedenes Suchtmittel. Andere Stoffe ließen sich vielleicht mit viel gesellschaftlicher Übung beherrschen, Opium aber nie. Daher sei auch die Suche nach Wirkstoffen, die vermeintlich nur die positiven Aspekte beinhalten, sinnlos, wie die vielen gescheiterten Experimente von Bayers Hustenmittel "Heroin" bis zu Purdue Pharmas Oxycontin belegen. Der Schlafmohn schaffe sich immer seine Nachfrage; das einzige Mittel gegen ihn sei die - um 1900 für kurze Zeit erfolgreich durchgesetzte - Begrenzung des Angebots. ANDREAS FAHRMEIR
Amitav Ghosh: "Rauch und Asche". Die geheime Geschichte des Opiums.
Aus dem Englischen von Heide Lutosch. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025.
432 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








