Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
15% Rabatt11 auf ausgewählte eReader & tolino Zubehör mit dem Code TOLINO15
Jetzt entdecken
mehr erfahren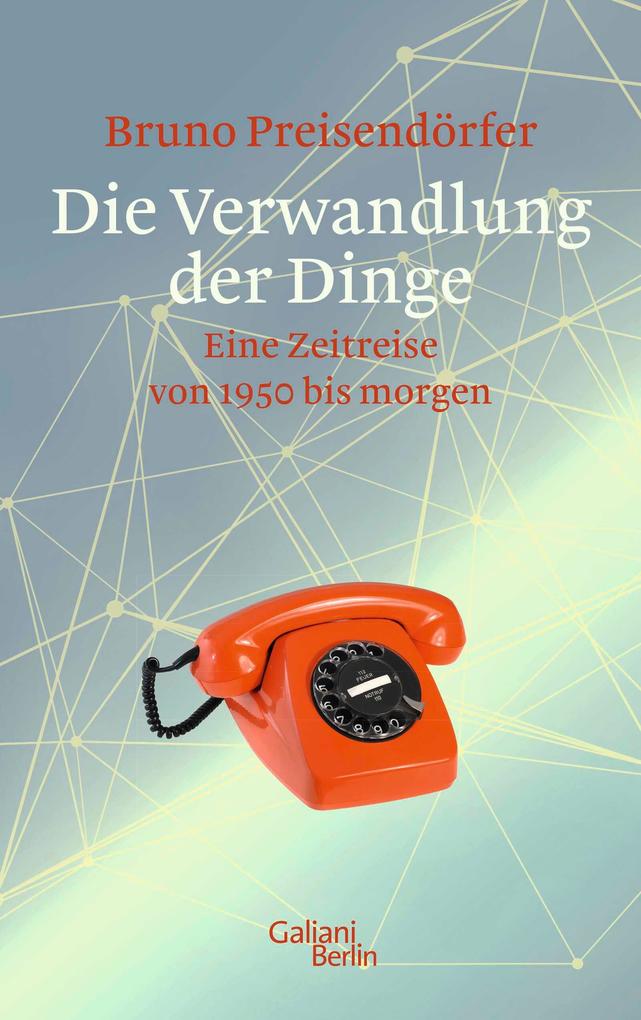
Zustellung: Sa, 23.08. - Di, 26.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Verwandlung der Dinge - eine nostalgische Zeitreise durch die rasante technische Entwicklung des Alltags
Fasziniert begibt sich Bruno Preisendörfer auf die Spur der Philosophie der Alltagsgegenstände - und dessen, was diese mit den Menschen, die sie bedienten, mach(t)en.
1963, als der Erstklässler Bruno Preisendörfer aufgeregt seinen ersten Schulweg antrat, da hing an seinem Schulranzen noch ein Wischläppchen für seine Schiefertafel, gerechnet wurde mit Stift und Rechenschieber, Musik hörte man im Radio oder auf Schallplatte. Nur 14 Prozent der bundesrepublikanischen Bevölkerung hatten ein Telefon - die Preisendörfers gehörten nicht dazu; einen Fernseher gab es bei ihnen daheim auch nicht und auch keine Schreibmaschine, mit der man z. B. das Manuskript zu diesem Buch hätte schreiben können.
Heute hat fast jedes über zwölfjährige Mitglied einer Durchschnittsfamilie ein eigenes Smartphone oder Tablet, mit dem man telefonieren, fotografieren, schreiben, googeln, chatten, streamen und mailen kann.
Mit einer Mischung aus Irritation, Faszination und verschmitztem Staunen lässt Preisendörfer in Die Verwandlung der Dinge die rasante technologische Entwicklung Revue passieren, die seinem persönlichen Alltag im Laufe weniger Jahrzehnte widerfuhr. Manchmal mit ein wenig Nostalgie, immer aber mit Neugier und dem Bewusstsein, dass auch jede Zukunft nur allzu bald ihre Vergangenheit hat. Mit wachem Blick und stilistischer Raffinesse beleuchtet er, was die jeweiligen Kulturtechniken mit ihren Benutzern machten und wie sie sich auf das jeweilige Sozialgefüge auswirken - vom gemeinsamen Fernsehgucken bis zum erbitterten Kampf um das einzige Telefon.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
08. März 2018
Sprache
deutsch
Untertitel
Eine Zeitreise von 1950 bis morgen.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
272
Autor/Autorin
Bruno Preisendörfer
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
440 g
Größe (L/B/H)
218/145/27 mm
ISBN
9783869711669
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Keine Frage, dieses Buch ist höchst unterhaltsam und doch weit mehr als bloß unterhaltsam. Marcel Proust musste ein Gebäck auf der Zunge zergehen lassen, um seine Kindheit wiederzufinden. Wir haben Bruno Preisendörfer. Historiker rekonstruieren eine Geschichte, die so niemand erlebt hat. Preisendörfer erinnert an Dinge, die wir alle mal gekannt hatten, die aber der Fortschritt nach und nach durch neue Dinge ersetzt hat und die dann nach einiger Zeit auch wieder verschwanden. Walter van Rossum, Deutschlandfunk
Ein ideales Strandbuch, ein Weißt-du-noch-Buch, aber auch ein Das-glaubst-du-nicht-Buch. Tobias Becker, Der Spiegel LiteraturSpiegel
Ein Buch voller konkreter Medientechniken, die unser Leben in Schrift, Ton und Bewegtbild geprägt haben und die wir rückblickend oft erstaunlich präzise datieren können. Wahrscheinlich könnte jeder von uns seine ganz persönliche Biografie der großen und kleinen Lebensabschnittsgeräte schreiben. Preisendörfer hat es mit einer Akribie und assoziativen Detailliebe getan, die staunen macht. Marc Reichwein, Die Welt
Faktenreich, sehr amüsant und ein bisschen nostalgisch. Steffen Radlmaier, Nürnberger Nachrichten
Der Autor vermittelt auch anhand persönlicher Erfahrungen ein spannend erzähltes Stück Kulturgeschichte seit 1950. (. . .) Er erzählt das alles ohne allzuviel Nostalgie `der Alten mit viel Neugier und Skepsis für Kommendes, mit einer angenehmen Portion Ironie und Gelassenheit. Hamburger Abendblatt
Im Verlauf der Lektüre setzt sich dieses heitere Sammelsurium zum kleinen Panorama einer Zeit zusammen, in der die Gegenstände zwar immer weniger Platz einnehmen, aber nur desto präsenter werden im menschlichen Leben. . . . `Die Erinnerung geht an Krücken, und die Krücken sind aus Dingen gemacht , stellt Preisendörfer fest. Man braucht keine Kulturpessimistin zu sein, um sich zusammen mit dem luziden Autor ganz nüchtern zu fragen, was die Menschheit an Menschlichem verliert, wenn die Dinge aus ihrer Welt verschwinden. Claudia Mäder, NZZ
Was Preisendörfer erzählt, ist wahnsinnig komisch. (. . .) Die unbekümmerte Weise, die Welt der schwindenden Dinge in Anbetracht unaufhaltsamen technischen Fortschritts zu beleuchten, verfängt. (. . .) Preisendörfer hinterfragt und analysiert und wundert sich. Janek Wiechers, NDRkultur
Es ist ein Buch für alle, die schon eine Weile auf der Welt sind und sich ob des Tempos der technologischen Entwicklung ihrer selbst vergewissern wollen, und es ist ein Buch für die Jungen, zum Beispiel für den Elfjährigen, der seinen Opa fragt: 'Wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab?' Katja Oskamp, MDR Kultur
Ein ideales Strandbuch, ein Weißt-du-noch-Buch, aber auch ein Das-glaubst-du-nicht-Buch. Tobias Becker, Der Spiegel LiteraturSpiegel
Ein Buch voller konkreter Medientechniken, die unser Leben in Schrift, Ton und Bewegtbild geprägt haben und die wir rückblickend oft erstaunlich präzise datieren können. Wahrscheinlich könnte jeder von uns seine ganz persönliche Biografie der großen und kleinen Lebensabschnittsgeräte schreiben. Preisendörfer hat es mit einer Akribie und assoziativen Detailliebe getan, die staunen macht. Marc Reichwein, Die Welt
Faktenreich, sehr amüsant und ein bisschen nostalgisch. Steffen Radlmaier, Nürnberger Nachrichten
Der Autor vermittelt auch anhand persönlicher Erfahrungen ein spannend erzähltes Stück Kulturgeschichte seit 1950. (. . .) Er erzählt das alles ohne allzuviel Nostalgie `der Alten mit viel Neugier und Skepsis für Kommendes, mit einer angenehmen Portion Ironie und Gelassenheit. Hamburger Abendblatt
Im Verlauf der Lektüre setzt sich dieses heitere Sammelsurium zum kleinen Panorama einer Zeit zusammen, in der die Gegenstände zwar immer weniger Platz einnehmen, aber nur desto präsenter werden im menschlichen Leben. . . . `Die Erinnerung geht an Krücken, und die Krücken sind aus Dingen gemacht , stellt Preisendörfer fest. Man braucht keine Kulturpessimistin zu sein, um sich zusammen mit dem luziden Autor ganz nüchtern zu fragen, was die Menschheit an Menschlichem verliert, wenn die Dinge aus ihrer Welt verschwinden. Claudia Mäder, NZZ
Was Preisendörfer erzählt, ist wahnsinnig komisch. (. . .) Die unbekümmerte Weise, die Welt der schwindenden Dinge in Anbetracht unaufhaltsamen technischen Fortschritts zu beleuchten, verfängt. (. . .) Preisendörfer hinterfragt und analysiert und wundert sich. Janek Wiechers, NDRkultur
Es ist ein Buch für alle, die schon eine Weile auf der Welt sind und sich ob des Tempos der technologischen Entwicklung ihrer selbst vergewissern wollen, und es ist ein Buch für die Jungen, zum Beispiel für den Elfjährigen, der seinen Opa fragt: 'Wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab?' Katja Oskamp, MDR Kultur
Bewertungen
am 14.03.2018
Selten habe ich so gelacht beim Lesen eines Sachbuches!
Man fühlt sich wie beim Anschauen alter Fotos:
Weißt du noch? (Z. Bsp.: Die Abstimmung über die Gewinner in der Spielshow Wünsch dir was per Klospülung! Kein Witz!)
Für unter 20-Jährige eine Abenteuerreise in die Steinzeit ihrer Eltern und Großeltern.
Wie konnte man soooo existieren?









