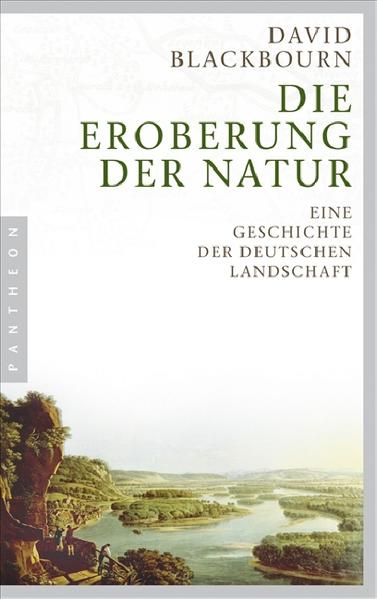
Zustellung: Do, 10.07. - Sa, 12.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Eine höchst aktuelle Umweltgeschichte Deutschlands: Die tiefgreifende Umgestaltung der Landschaft seit dem 18. Jahrhundert
David Blackbourn schildert die Geburt des modernen Deutschland aus dem Geist der Natureroberung. In den letzten 250 Jahren wurde gravierend in die Umwelt eingegriffen. Man rodete Wälder, begradigte Flüsse, legte Moore trocken und baute Staudämme, um die Naturgewalten zu zähmen und dem Menschen dienstbar zu machen. Die Umgestaltung der deutschen Landschaft ging einher mit der Mythisierung von Natur und Nation. Die deutsche Landschaft wurde seit dem 18. Jahrhundert grundlegend und planvoll umgestaltet. David Blackbourn erzählt, wie die Deutschen sich aufmachten zu einem Feldzug gegen ihre Umwelt und wie sie Tier- und Pflanzenwelt, Flüsse und Marschland Schritt für Schritt bezwangen: Von Friedrich dem Großen, der die Trockenlegung von Sumpfland als »Eroberungen von der Barbarei« betrachtete, über den »Bezähmer« des Rheins Johann Gottfried Tulla und den Dammbauer Otto Intze bis zu den Nationalsozialisten, die im Osten »Lebensraum« zu erobern suchten. Landgewinnung und »Rassenpolitik« gingen hier Hand in Hand. Blackbourn beschreibt das Werden der deutschen Landschaft und erklärt gleichzeitig, wie sich Deutschland zu einem modernen Staat entwickelte. Er eröffnet dem Leser einen einzigartigen Blickwinkel, der hilft, die deutsche Geschichte besser zu begreifen. Dabei rührt er aber auch an Probleme, die heute aktueller sind als je: den Klimawandel und das Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten. - Deutschland aus natur- und kulturhistorischer Perspektive - ein etwas anderer Blick auf die deutsche Geschichte
- David Blackbourn ist einer der besten Kenner der deutschen Geschichte
Ausstattung: mit Abbildungen
David Blackbourn schildert die Geburt des modernen Deutschland aus dem Geist der Natureroberung. In den letzten 250 Jahren wurde gravierend in die Umwelt eingegriffen. Man rodete Wälder, begradigte Flüsse, legte Moore trocken und baute Staudämme, um die Naturgewalten zu zähmen und dem Menschen dienstbar zu machen. Die Umgestaltung der deutschen Landschaft ging einher mit der Mythisierung von Natur und Nation. Die deutsche Landschaft wurde seit dem 18. Jahrhundert grundlegend und planvoll umgestaltet. David Blackbourn erzählt, wie die Deutschen sich aufmachten zu einem Feldzug gegen ihre Umwelt und wie sie Tier- und Pflanzenwelt, Flüsse und Marschland Schritt für Schritt bezwangen: Von Friedrich dem Großen, der die Trockenlegung von Sumpfland als »Eroberungen von der Barbarei« betrachtete, über den »Bezähmer« des Rheins Johann Gottfried Tulla und den Dammbauer Otto Intze bis zu den Nationalsozialisten, die im Osten »Lebensraum« zu erobern suchten. Landgewinnung und »Rassenpolitik« gingen hier Hand in Hand. Blackbourn beschreibt das Werden der deutschen Landschaft und erklärt gleichzeitig, wie sich Deutschland zu einem modernen Staat entwickelte. Er eröffnet dem Leser einen einzigartigen Blickwinkel, der hilft, die deutsche Geschichte besser zu begreifen. Dabei rührt er aber auch an Probleme, die heute aktueller sind als je: den Klimawandel und das Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten. - Deutschland aus natur- und kulturhistorischer Perspektive - ein etwas anderer Blick auf die deutsche Geschichte
- David Blackbourn ist einer der besten Kenner der deutschen Geschichte
Ausstattung: mit Abbildungen
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Dezember 2008
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
592
Autor/Autorin
David Blackbourn
Übersetzung
Udo Rennert
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit Abbildungen
Gewicht
744 g
Größe (L/B/H)
219/141/48 mm
ISBN
9783570550632
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Brillant . . . Ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung." Ian Kershaw
"Das Buch ist glänzend geschrieben und reich an informativen Details." Ute Frevert, NZZ
"Das Buch ist glänzend geschrieben und reich an informativen Details." Ute Frevert, NZZ
 Besprechung vom 18.06.2025
Besprechung vom 18.06.2025
Romane als Freiheitskämpfe
Faszinierend, dabei nicht immer tatsachentreu: Todd Kontje sucht in der deutschen Literaturgeschichte nach dem Ursprung der Globalisierung.
Gemeinhin nimmt man an, der Globalismus sei eine moderne Erscheinung. Schifffahrt und Raumfahrt, Handel und Telekommunikationen haben eine neue, vernetzte Welt eingeführt. Doch lässt sich die Globalisierung weit in die Geschichte zurückverfolgen. Manche finden ihren Anfang um 1800 mit dem Aufstieg des Kapitalismus. Andere hingegen wollen mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus den Beginn setzen. Die amerikanische Sinologin Valerie Hansen findet den Ursprung in ihrem berückenden Buch "The Year 1000" (2020) vor zweitausend Jahren. Doch wird in der sich inzwischen als eigene Branche der Wissenschaft gestaltende Diskussion zum sogenannten Welt-System, wie sie vor allem von Andre Gunder Frank in "The World System" (1993) geführt wird, der Anfang globalen Handelns mit dem Ursprung der Zivilisation in Mesopotamien gleichgesetzt. Noch andere wollen das Phänomen bereits in der Vorzeit erkennen: So argumentiert Jeffrey D. Sachs in "The Ages of Globalization" (2020); schon vor 70.000 Jahren im Paläolithikum habe mit den ersten Migrationen die Globalisierung begonnen. Das ist der Kontext für das jüngste Buch zum Thema. Der amerikanische Historiker Todd Kontje hat mit einer tiefschürfenden Arbeit erstmals das Thema der Globalisierung in der deutschen Literatur um 1800 ins Auge gefasst.
Die Philosophie Kants, die Kontje merkwürdigerweise erst am Ende seiner Darlegung einführt, markiert den Ausgangspunkt einer globalen Theorie. In Anschluss an Voltaire entwirft Kant in seinem Essay "Zum ewigen Frieden" 1795 das Bild einer vernetzten Welt. Eine aufgeklärte kosmopolitische Ordnung soll sich über die ganze Erde verbreiten, um universellen Frieden zu bewerkstelligen. Dieses Denken gipfelte in Francis Fukuyamas "Das Ende der Geschichte" (1992). Heute erleben wir das krasse Gegenteil. Putin, den keiner verstehen will, handelt wie ein typischer orientalischer Despot. Diese Herrschaftsform hat man in der Aufklärung klar erkannt.
Ein Vorzug von Kontjes Ansatz liegt darin, dass er Werke, die singulär wirken, wie Chamissos "Peter Schlemihl" (1814), in einer übergreifenden Gesamtschau zu erfassen vermag. Dabei fokussiert er auf Themen wie den Austausch von Kapitalismus und moderner Naturwissenschaft, von Forschungsreisen und Geldwirtschaft, um die sich die Handlung der stets überraschenden Novelle dreht. Die deutsche Lesewut des neunzehnten Jahrhunderts kompensierte das Fehlen eines Reiches durch spannende Erzählungen im Geiste von Daniel Defoes Roman "Robinson Crusoe" (1719). Die Reiseliteratur hat die Erforschung der Übersee genährt. Man sammelte Steine, Pflanzen, Tiere, Sklaven und erwarb durch Handel und Eroberung fremder Territorien ungeheuren Reichtum. Es erfolgte nach der Entdeckung Amerikas was der Historiker Tzvetan Todorov "den ärgsten Genozid in der Geschichte der Menschheit" genannt hat: Das Licht der Aufklärung warf einen schwarzen Schatten. Diese Aporie, die Horkheimer und Adorno erstmals in "Die Dialektik der Aufklärung" aufdeckten - eines der wenigen Bücher zum Thema, die Kontje nicht erwähnt -, liefert auch für seine Ansichtsart den Schlüssel.
Goethe und Schiller, Novalis und Hölderlin finden gleichermaßen ihren Platz in Kontjes weit ausholender Erzählung. Ein Vorteil dieser Umorientierung liegt darin, dass sie die herkömmliche Debatte über Klassik und Romantik ausschließt, um einen weit näherliegenden Blickpunkt einzuführen. So vermag die Darstellung Dichter wie Kleist, Hoffmann und Eichendorff ohne Bezug auf Weimar-Jena zu würdigen. Kleists "Die Verlobung in San Domingo" (1811), eine Novelle, die man schon lange im Zeichen der Globalisierung gedeutet hat, kann nun endlich in einen größeren Kontext gestellt werden. Die Thematisierung des Sexus, die Kleist vornimmt, und die Abrechnung mit dem Kolonialismus vermag Kontje in einem großen Zusammenhang zu würdigen, die den literarischen Rahmen sprengt und durch eine neuartige revisionistische Anschauung ersetzt. Auch Eichendorffs Roman "Ahnung und Gegenwart" (1815) findet seinen Platz als Darstellung der Freiheitskämpfe. Schließlich krönt die Darstellung Alexander von Humboldts dieses faszinierende Buch: Humboldts "Kosmos" (1845 bis 1862) versucht im Gegenentwurf zu Newtons "Prinzipien der Welt" die gesamte Natur zu deuten.
Kontje ist stets up to date. Er greift auf die maßgebliche Studie von David Blackbourn, "The Conquest of Nature" (2006), zurück, die unser Verständnis der deutschen Geschichte um 1800 entscheidend geprägt hat. Was hier auf dem Spiel stehe, so Kontje, ist eine historische Umorientierung, die den in der maßgeblichen deutschen Historiographie dominanten Blick von der Schoa abwenden soll, um dadurch die teleologische Geschichtsschreibung, nach der alles im Holocaust endet, umzudrehen, um die Historie ohne Telos zu begreifen beziehungsweise sie mit der heutigen Problematik der Globalisierung zu verbinden. Dass hier ein gewisser Widerspruch vorliegt, muss man akzeptieren.
Insgesamt liefert Kontje eine postmoderne und postkoloniale Geschichte Deutschlands, die große Thesen, nicht akribische Analyse vorzieht. Für einen Historiker hat er aber erstaunlich wenig Respekt vor den Tatsachen. Er behauptet, Napoleons Reich habe sich von Moskau bis Madrid erstreckt, obgleich der französische Kaiser nur sechs Wochen im menschenleeren, ausgebrannten Moskau weilte; er lobt die Stabilität des Heiligen Römischen Reiches, als ob der Dreißigjährige Krieg nie stattgefunden hätte; und die finanzielle Krise, die er irgendwann im späteren achtzehnten Jahrhundert ortet, fand schon 1720 mit der Südsee-Blase statt. Auch werden sich eher wenige für die Ansicht erwärmen können, dass Adam Smiths epochales Werk zum beginnenden Kapitalismus, "Der Reichtum der Nationen" (1776), sich um die Semiotik des Geldes drehe. Die Ausblendung von Justus Mösers Schriften führt zu einer weiteren Entstellung: Möser gehörte laut Jerry Z. Muller in "The Mind and the Market" (2002) zu den ersten Kritikern der Globalisierung. Die meisten Leser werden jedoch solche Fragwürdigkeiten gern in Kauf nehmen, denn Kontje hat ein klares und mutiges, lebhaftes und provokantes Buch verfasst, das Deutschlands literarische Globalisierung um 1800 erstmals auf die Tagesordnung setzt. JEREMY ADLER
Todd Kontje: "Global
Germany Circa 1800".
A Revisionist Literary
History.
The Pennsylvania State University Press,
Philadelphia 2025.
268 S., geb., 59,95 $.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








