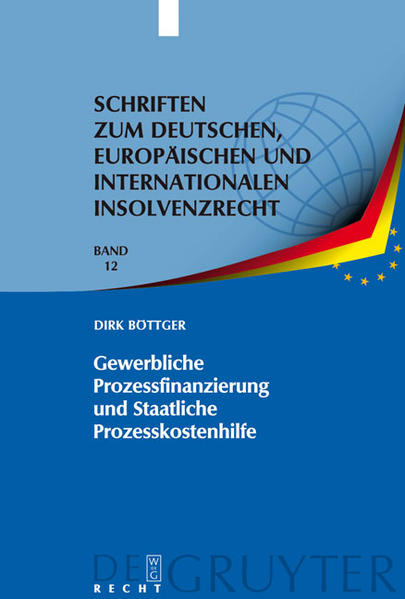
Zustellung: Mi, 16.07. - Sa, 19.07.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Insolvenzrecht gehört zu dem Kernbestand der Regelwerke, die das Vertrauen der Rechtsgenossen in eine Rechtsordnung sichern. Es regelt die Bedingungen allseitiger Haftung eines Schuldners und steckt damit zugleich den Rahmen ab, innerhalb dessen die Gläubiger erwarten können, dass ihre Rechte in einer und durch eine Reorganisation und Sanierung des schuldnerischen Unternehmens gewahrt werden. Die faktische Wirkung des Insolvenzrechts endet nicht an nationalstaatlichen Grenzen. Das Insolvenzverfahren ist nach seinem Anspruch auf universelle Geltung angelegt. In fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt heute als innerstaatliches Recht ein gemeinsames Recht grenzüberschreitender Insolvenzverfahren. Dieses gemeinsame europäische Recht strahlt auf die innerstaatlichen Reformbemühungen aus es hat Einfluss auf die Insolvenzgesetzgebung. Die innerstaatlichen Gesetzgebungen werden zudem von UNCITRAL-Modellgesetzgebungen beeinflusst. Die wissenschaftliche Diskussion geht zusehends auf die damit ausgelösten Konvergenzbewegungen ein; die Praxis bedarf rechtsdogmatischer Aufklärung über die komplexer werdenden Regelungen des Insolvenzrechts und der Unterrichtung über die Strukturen und Problemstellungen ausländischer europäischer und außereuropäischer Insolvenzrechte, auch und gerade in ihrer Wechselwirkung mit dem deutschen Recht. Die Schriftenreihe der DZWIR ist ein Forum dieser Diskussionen. Sie wird in loser Folge monographische Untersuchungen zu Grundsatzfragen des deutschen, europäischen und internationalen Insolvenzrechts veröffentlichen. Damit leistet diese Schriftenreihe einen Beitrag ebenso zur rechtsdogmatischen Klärung von Streitfragen wie nicht minder zur Unterstützung der europäischen Integration der nationalstaatlichen Insolvenzrechte.
Ein Ziel der Neuregelungen der Insolvenzordnung war es, die Anfechtungsmöglichkeiten auszuweiten. Zugunsten der Gläubiger sollten im Rahmen der neuen Ordnungsfunktion des Insolvenzrechts vermehrt Ansprüche zur Masse gezogen werden, die von den Insolvenzverwaltern gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Wegen unzulänglicher Massen sind die Insolvenzverwalter, wie auch bereits zu Zeiten der Konkursordnung, jedoch meist auf eine Fremdfinanzierung angewiesen: Entweder durch staatliche Prozesskostenhilfe oder mit Hilfe der Finanzierungsbereitschaft von Insolvenzgläubigern. Da beide Finanzierungsmöglichkeiten in der Praxis eher theoretischer Natur sind, blieb den Insolvenzverwaltern oftmals nur noch die Möglichkeit, das Klageverfahren auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu führen und damit in unzulässiger Weise privates Vermögen mit dem Insolvenzverfahren zu verbinden. Seit der Jahrtausendwende haben sich nun gewerbliche Prozessfinanzierer auf dem Markt etabliert und stellen für Insolvenzverwalter eine sinnvolle Finanzierungsalternative dar.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Problemen, die sich im Zusammenspiel des Insolvenzverwalters mit der gewerblichen Prozessfinanzierung und der staatlichen Prozesskostenhilfe ergeben. Sie soll all denjenigen Verfahrensbeteiligten eine sinnvolle Hilfe sein, die in der täglichen Praxis mit den aufgezeigten Problemen konfrontiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Teil A. Einleitung Teil B. Verhältnis zwischen gewerblicher Prozessfinanzierung und staatlicher ProzesskostenhilfeI. Gewerbliche ProzessfinanzierungII. Staatliches PKH-VerfahrenIII. Ergebnis Teil C. Vorrangige Inanspruchnahme gewerblicher Prozessfinanzierung zur Vermeidung von HaftungsrisikenI. Summarische Prüfung der Erfolgsaussichten eines PKH-Antrages unter Einbeziehung der MassegläubigerII. Beschluss Gläubigerversammlung § 160 InsOIII. Befragung der GroßgläubigerIV. Im Zweifel "engagementloser" PKH-AntragV. Prozessfinanzierung im vorläufigen VerfahrenVI. Haftungsrisiken des Insolvenzverwalters bei vorrangiger Inanspruchnahme von ProzessfinanzierungVII. Haftungsrisiken des Insolvenzverwalters bei unterlassener Inanspruchnahme von ProzessfinanzierungVIII. Praktischer Hinweis bei erfolgloser Finanzierungsanfrage und versagter ProzesskostenhilfeIX. Ergebnis Teil D. Rechtspositionen des Prozessfinanzierers und des Insolvenzverwalters nach VertragsschlussI. Vertraglich eingeräumte SicherungsrechteII. Eingeschränkte KostenübernahmeklauselnIII. Sonstige vertragliche VereinbarungenIV. Vertragliche Mitbestimmungs- und DruckklauselnV. Ergebnis Teil E. Zusammenfassung der gesamten Arbeit Anhang 1Dienstleistungen des gewerblichen Prozessfinanzierers für den Insolvenzverwalter - Vereinbarkeit mit dem neuen Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)I. ProblemstellungII. Rechtsberatungsgesetz (RBerG)III. Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG-E)IV. Ergebnis Anhang 2Der Prozessfinanzierungsvertrag unter Betrachtung der Vorschriften der §§ 305 bis 310 BGBI. ProblemstellungII. Anwendbarkeit der §§ 305 bis 310 BGBIII. Ergebnis Anhang 3Unveröffentlichte Gerichtsentscheidungen
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Februar 2008
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
240
Reihe
Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Insolvenzrecht
Autor/Autorin
Dirk Böttger
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
1 b/w tbl.
Gewicht
518 g
Größe (L/B/H)
236/160/18 mm
ISBN
9783899494693
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gewerbliche Prozessfinanzierung und Staatliche Prozesskostenhilfe" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









