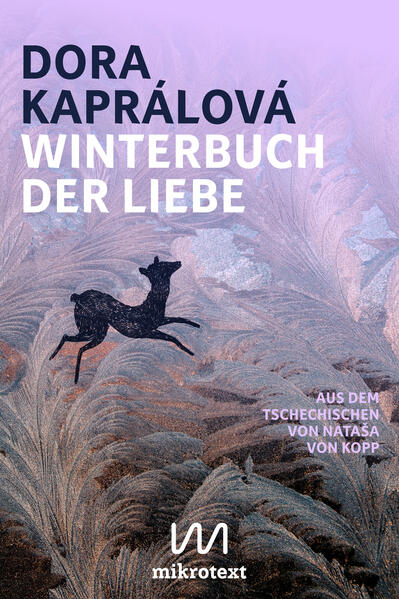
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Vorsicht! Diese als Fingerübungen getarnten Textminiaturen, die scheinbar immer aufs Neue ansetzen, entwickeln sogartig ein logisches Ganzes, das einiges mehr ist als eine merkwürdige Liebesgeschichte. Wir Leser werden mitgerissen von einer Erzählstimme, die das Surreale unserer Wirklichkeit aufdeckt und deren ehrliche Widersprüchlichkeit man nach der Lektüre nicht mehr vergisst. Martin Jankowski
Ich habe das Buch mit großem Vergnügen gelesen. Danke! Péter Esterházy
Das Vergnügen, das im Erzählen stattfindet, geschieht in der Sprache: Es rebelliert gegen Klischees, ruhiges Dahinleben und lauwarme Gefühle. Es lacht mitfühlend über Männer, die nicht rebellieren wollen, aber vor allem wahrscheinlich über das Genre des Liebesgeständnisses. Ivana Myšková
Dora Kaprálová ist eine außergewöhnliche Autorin. Radikale Zärtlichkeit, subtiler Feminismus, brutale Ehrlichkeit. Jáchym Topol
 Besprechung vom 09.01.2025
Besprechung vom 09.01.2025
Unter der hopplahopp zerknitterten Decke
Was bleibt von unseren Begegnungen? Dora Kaprálová hält sie im "Winterbuch der Liebe" fest
Es sollte ein Aufbruch sein, ein Neuanfang für ein Paar, das sich auf den Weg in die Provinz gemacht hat, um dort ein Haus zu beziehen. Dass sich in der Frau dann vor Ort ein Unbehagen ausbreitet, liegt nicht an ihren Gefühlen für den Mann - "ich liebe ihn", hält sie fest, "ich fahre hin, um mit ihm zu leben, und er zeigt mir unser Haus". Die Stimmung kippt dann mitten im Satz, der jenes Haus beschreibt, "eingerichtet von jemand anderem mit Zärtlichkeit, Sorgfalt und dem konsequenten Stumpfsinn von Ordnungsliebenden". Das ist kein guter Auftakt, und die beiden Liebenden beenden ihre Entdeckungsreise in der Provinz schließlich am Flussufer, bedeckt mit Schlamm - "und unser gemeinsamer Dreck löst das ganze heutige Problem, das ganze Leben, vielleicht die Leben aller Generationen vor und nach uns".
Mit ihrem "Winterbuch der Liebe", erschienen ursprünglich 2014, reagierte die tschechische Autorin Dora Kaprálová auf Péter Esterházys "Eine Frau", eine Sammlung von 97 Prosaminiaturen aus dem Jahr 1995, die jeweils mit den Worten "Es gibt eine Frau" beginnen und verschiedene Stadien und Situationen des Miteinanders beschreiben. Kaprálová nimmt die umgekehrte Perspektive ein, beginnt also ihre kurzen Texte, kaum zufällig 79 an der Zahl, gern mit den Worten "Es gibt einen Mann", bricht aus diesem Schema aber mitunter aus, indem sie statt "Mann" auch einen "Bund" oder eine Sprache in den Mittelpunkt der jeweiligen Miniatur stellt; eine weitere Variation besteht in kurzen Kapiteln in kursiver Schrift, in denen jeweils eine Tochter Péter Esterházys entworfen wird, die im selben Haus wie die Erzählerin wohnt, ein Kind versorgt und schließlich zur Adressatin der Texte dieses Buches wird. Diese entstehen, heißt es im Vorwort, als "schöne, ruhige Wintergewohnheit" und gar auf Empfehlung Esterházys.
Tatsächlich lehnen sich Kaprálovás Texte formal an die Vorlage an, erweitern deren ohnehin luftigen Rahmen aber in auffälliger Weise. Die Männer, von denen sie ausgeht, sind alt und ganz jung - der jüngste ist ein Kindergartenkind, das ihr unversehens ins Gesicht kräht, dass es sie überhaupt nicht leiden könne -, sie sind ihr sehr nah oder kaum bekannt, über Jahre verbunden oder für einen Moment begegnet. Manche - wie den Fernsehkoch Jamie Oliver - kennt sie nur über die Medien, andere erkundet sie körperlich und in lange fortgesetzten Gesprächen.
Oder die Texte schildern, wenn aus einer peripheren Begegnung etwas bleibt, vielleicht auch etwas verpasst wird, was sich nicht nachholen lässt: So erinnert sich Kaprálovás Erzählerin an eine Begegnung während einer Reise durch die Vereinigten Staaten. Sie ist zwanzig Jahre alt, der picklige, unsichere Junge, der neben ihr auf dem Stromkasten sitzt, ist vierzehn. Beide warten darauf, dass ein verliebtes Paar - der Vater des Jungen, die Freundin der Erzählerin - aus seinem Versteck wieder zu ihnen zurückkehrt. Zwischen den Wartenden aber ist eine Anspannung, die auch viele Jahre später keine rechten Konturen erhält, als die Erzählerin sich an diese Begegnung erinnert.
Dass es dabei nicht bleibt, ermöglicht die offene Form der Sammlung ebenfalls. Denn so wie schon Esterházys Miniaturen aufeinander reagieren, so stellt auch Kaprálová Texte nebeneinander, die sich ergänzen oder den Faden fortspinnen. Hier kommt die Erzählerin auf das amerikanische Erlebnis zurück. Sie erfährt vom Tod des Jungen, der, so heißt es, kein glückliches Leben führte, und landet leider bei einer merksatzartigen Betrachtung über das Leben, die dem Band sonst ganz fremd ist.
Von Liebe ist darin die Rede, vom Treffen und Verpassen, davon, wie es ist, für Minuten oder eine halbe Stunde einen Straßenmusiker, Hausmitbewohner, Metzger, Eisenbahnfahrgast oder Kostümbildner auf ungeahnt intensive Weise kennenzulernen und danach schreibend darüber nachzudenken. Die Unmöglichkeit, all das zu erfassen, teilt sich allerdings genauso mit. Kaprálovás Panorama der Begegnungen stellt seine Fehlstellen deutlich aus und spricht so fast mehr vom Verpassen, wobei sie sich selbst und andere in den Blick nimmt.
Von einem Mann erzählt sie, der alles "hopplahopp" macht: "Er liebt alles halb, seine Familie, Frau und Kinder; auch sich selbst liebt er nur halb, seine wahren Tage und Nächte versteckt er sorgfältig unter einer hopplahopp zerknitterten Decke, als ob er denken würde, glauben würde, hoffen würde, dass es nur eine Prüfung sei", bevor dann ein ganz anderes Leben käme, ein "wirkliches, verantwortungsbewusst geführtes". Das ist die traurigste Geschichte in einem mitunter leichten, oft abgründigen Buch, das sich kaum zufällig der Kontemplation des Winters verdankt. TILMAN SPRECKELSEN
Dora Kaprálová: "Winterbuch der Liebe".
Aus dem Tschechischen von Natasa von Kopp.
Mikrotext Verlag,
Berlin 2024.
120 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








