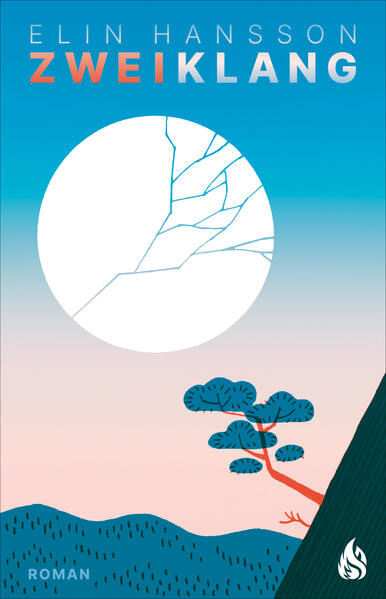
Zustellung: Mo, 30.06. - Mi, 02.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Seit dem Tod seiner Mutter lebt Torleif weit weg von seiner Familie in der Großstadt, wo er das Gefühl hat, endlich er selbst sein zu können. Doch als sein Großvater krank wird, muss Torleif zurückkehren - in sein Heimatdorf, wo seine Begeisterung für Musik als "unmännlich" belächelt wird und "schwul" noch als Schimpfwort gilt. Auch sein Vater und sein Bruder interessieren sich mehr für die Elchjagd als für Torleifs Leidenschaft, die Hardangerfiedel. Nur in der Geigenbauwerkstatt des Großvaters und in der örtlichen Musikschule findet er Zuflucht - bis er auf den japanischen Austauschstudenten Horimyo trifft und all die ungesagten Dinge drohen, an die Oberfläche zu treten.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Februar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage, Ungekürzte Ausgabe
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
320
Altersempfehlung
ab 14 Jahre
Autor/Autorin
Elin Hansson
Übersetzung
Meike Blatzheim, Sarah Onkels
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
norwegisch
Produktart
gebunden
Gewicht
444 g
Größe (L/B/H)
212/141/32 mm
ISBN
9783038800989
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Ein gelungener Roman mit vielen Jugendthemen, voller Musik und norwegischem Flair." Christopher Krieghoff, Der evangelische Buchberater
"Eine bewegende Geschichte, sehr einfühlsam übersetzt von Meike Blatzheim und Sarah Onkels, die viel über die Borniertheit von Menschen erzählt, von immer noch mangelnder Akzeptanz sexueller Vielfalt, von Ängsten, die es endlich zu überwinden gilt." Andrea Wanner, TITEL Kulturmagazin
"Ein sehr sensibel geschriebenes Buch mit viel Musik (die Playlist kann man herunterladen) und wundervollen Aussagen." Dagmar Mägdefrau, Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur e. V.
"Elin Hanssons 'Zweiklang' ist ein ruhiger, feinfühliger Roman, der mich sehr berührt hat [. . .]. Ein Buch, das bleibt." Altenburg Club der anoymen Bookoholiker, Landesstelle: Thüringen, AJuM - AG Jugendliteratur und Medien der GEW
"Berührend und ermutigend!" Die Zeit
"'Zweiklang' besticht durch seine Schauplätze, Charaktere und Begleitmelodien." Anna Nowaczyk, Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ Online
"Ein sensibel geschriebener Roman" Susanne Wyss, KJM - Verein Kinder- und Jugendmedien Bern-Freiburg
"Ein gelungener Roman mit vielen Jugendthemen, voller Musik und norwegischem Flair." Christopher Krieghoff, eliport - Evangelisches Literaturportal e. V.
"Mit 'Zweiklang' hat die norwegische Autorin Elin Hansson ein Buch geschrieben, das weniger durch seine Handlung als durch seine Schauplätze, Charaktere und Begleitmelodien besticht." Anna Nowaczyk, Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ
"Ein überzeugender Coming-of-Age-Roman, der einen von der ersten bis zur letzten Seite einfängt. Auch absolut unmusikalische Leserinnen und Leser können die Melodie der Worte spüren." Theresa Mürmann, Jugendbuch-Couch
"Dank bildlicher Beschreibungen kann der Leser mühelos in die traumhafte Fjordkulisse Norwegens eintauchen und Torleifs erste Liebe miterleben." Bianka Boyke, Eselsohr - Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien
"'Zweiklang' [kann] für alle Leserinnen und Leser egal welcher sexuellen Orientierung empfohlen werden." Gerd Klingeberg, Landesstelle: Rheinland-Pfalz, AJuM - AG Jugendliteratur und Medien der GEW
"Eine bewegende Geschichte, sehr einfühlsam übersetzt von Meike Blatzheim und Sarah Onkels, die viel über die Borniertheit von Menschen erzählt, von immer noch mangelnder Akzeptanz sexueller Vielfalt, von Ängsten, die es endlich zu überwinden gilt." Andrea Wanner, TITEL Kulturmagazin
"Ein sehr sensibel geschriebenes Buch mit viel Musik (die Playlist kann man herunterladen) und wundervollen Aussagen." Dagmar Mägdefrau, Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur e. V.
"Elin Hanssons 'Zweiklang' ist ein ruhiger, feinfühliger Roman, der mich sehr berührt hat [. . .]. Ein Buch, das bleibt." Altenburg Club der anoymen Bookoholiker, Landesstelle: Thüringen, AJuM - AG Jugendliteratur und Medien der GEW
"Berührend und ermutigend!" Die Zeit
"'Zweiklang' besticht durch seine Schauplätze, Charaktere und Begleitmelodien." Anna Nowaczyk, Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ Online
"Ein sensibel geschriebener Roman" Susanne Wyss, KJM - Verein Kinder- und Jugendmedien Bern-Freiburg
"Ein gelungener Roman mit vielen Jugendthemen, voller Musik und norwegischem Flair." Christopher Krieghoff, eliport - Evangelisches Literaturportal e. V.
"Mit 'Zweiklang' hat die norwegische Autorin Elin Hansson ein Buch geschrieben, das weniger durch seine Handlung als durch seine Schauplätze, Charaktere und Begleitmelodien besticht." Anna Nowaczyk, Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ
"Ein überzeugender Coming-of-Age-Roman, der einen von der ersten bis zur letzten Seite einfängt. Auch absolut unmusikalische Leserinnen und Leser können die Melodie der Worte spüren." Theresa Mürmann, Jugendbuch-Couch
"Dank bildlicher Beschreibungen kann der Leser mühelos in die traumhafte Fjordkulisse Norwegens eintauchen und Torleifs erste Liebe miterleben." Bianka Boyke, Eselsohr - Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien
"'Zweiklang' [kann] für alle Leserinnen und Leser egal welcher sexuellen Orientierung empfohlen werden." Gerd Klingeberg, Landesstelle: Rheinland-Pfalz, AJuM - AG Jugendliteratur und Medien der GEW
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Kein besseres Diagnosemittel als die Musik
Elin Hanssons Roman "Zweiklang" schildert die Rückkehr eines schwulen Musikers in das norwegische Dorf seiner Kindheit.
Von Anna Nowaczyk
Von Anna Nowaczyk
Die Hardangerfiedel ist ein vielschichtiges Instrument. Bis zu fünf Resonanzsaiten aus Metall schwingen mit, wenn der Bogen über die oben liegenden Melodiesaiten streicht, verändern ihren Klang, verleihen ihm Hall, fächern ihn auf. Torleif weiß das. Schließlich ist er ein erfahrener Hardangerfiedler. Seit zwei Jahren besucht er ein Musikinternat in der Stadt und übt täglich. Mit Resonanzen kennt er sich also bestens aus. Und so zögert er, als sein Vater ihn bittet, über die Herbstferien nach Hause zu kommen. Sein Opa habe einen Schlaganfall erlitten, jemand müsse sich um ihn kümmern. Eine Fahrt mit dem Expressbus, ein paar Tage in der Heimat - eigentlich nicht zu viel verlangt. Doch etwas schwingt mit: Die Erinnerung an den Tod seiner Mutter, das abgekühlte Verhältnis zu Bruder und Vater. Und nicht zuletzt die große Angst, dass irgendjemand in seinem Heimatdorf herausfinden könnte, dass er schwul ist.
Mit "Zweiklang" hat die norwegische Autorin Elin Hansson ein Buch geschrieben, das weniger durch seine Handlung als durch seine Schauplätze, Charaktere und Begleitmelodien besticht. Die sind schon abrufbar, bevor die Geschichte überhaupt beginnt: ein QR-Code verweist auf eine Spotify-Playlist, die von norwegischer Hardangerfiedelmusik bis zu Joni Mitchell reicht. Tatsächlich hilft sie, den Protagonisten zu verstehen. Denn Torleif denkt in Musik. Die Fiedel nutzt er als steten Referenzpunkt, um die Welt um sich herum zu erklären. Das Schweigen mit seinem Opa beschreibt er als "Samtbezug in einem Geigenkoffer", Gespräche mit seinem Bruder, der lieber (Jagd-)flinte statt Fiedel anlegt, hingegen als verstimmte Geige. Musik sei wie Strahlung, denkt er einmal, sie finde alle Tumore in ihm.
Es sind eigenwillige Sprachbilder, die Hansson ihrem Protagonisten zuschreibt. Doch sie passen zu Torleif. Er ist so kreativ wie sensibel und verwehrt sich gegen keines von beidem. Schon als der Bus das Ortseingangsschild passiert, will er am liebsten weinen, schluchzt hemmungslos, als er "Felefeber" hört; jenes Lied, das auf der Beerdigung seiner Mutter vor zwei Jahren gespielt wurde. Torleif hat für einen 16 Jahre alten Jungen einen bemerkenswert offenen Zugang zu seinen Gefühlen, wird oft von seiner Traurigkeit überwältigt, ohne dass man je Mitleid mit ihm haben müsste. Denn einsam ist er nicht.
Wann immer es ihm schlecht geht, ruft er seine Freunde aus der Stadt an. Zwischen ihnen und dem Alltag im Bergdorf klaffen Welten, die sich offenbaren, sobald Torleif zum Telefon greift. So sagen seine Freunde Sätze wie "No Stress, princess", befolgen 30-Tage-Yoga-Challenges und gendern, nehmen sich in den Arm und sagen sich, wie lieb sie sich haben. Auf der anderen Seite von Torleifs Realität liegt das ruhige Bergdorf, das nur für jene behaglich scheinen dürfte, die nicht als queerer Junge in ihm aufgewachsen sind. Erzählt man sich doch schon in der Fernfahrerkneipe am Ortseingang, dass in der Stadt nur "Schwuchtelkaffee" getrunken wird. Torleifs Angst - immer mehr aber auch Bedürfnis -, sich zu outen, überschattet seine Rückkehr und hängt wie ein Damoklesschwert über ihm.
Richtig wohl fühlt er sich da nur in der Hardangerfiedelwerkstatt, bei Goffa, wie er seinen Opa im lokalen norwegischen Dialekt nennt. Goffa ist gutmütig, lieb, ein einmaliger Geschichtenerzähler und noch besserer Geigenbauer. Hansson kommt mit wenigen Sätzen aus, um ihre Schauplätze zu beschreiben, doch sie reichen vollkommen, um ein Bild von der Werkstatt entstehen zu lassen. Von der Decke hängende Geigen, ein Geruch nach poliertem Holz: Es braucht nicht viel, um sich dort auch als Leser schnell wohlzufühlen. Das liegt auch an der Beziehung zwischen Großvater und Enkel, die ruhig, vertrauensvoll und warm ist.
So übernimmt Torleif auch gern die Aufgabe, Goffas frisch gefertigte Fiedel an einen japanischen Gastdozenten an der örtlichen Musikschule auszuliefern - und verliebt sich prompt. Recht aufgehen will die Liebesgeschichte jedoch nicht, vor allem weil Horimyo, der Gastdozent aus Japan, bis zuletzt ein blasser Charakter bleibt. Ein bisschen wirkt es, als diene er vor allem Torleifs Entwicklung, ihre Annäherungen und Konflikte zeichnen sich früh ab. Ganz große Überraschungen erwarten den Leser über gut 300 Seiten nicht, die Handlung nimmt gemächlich ihren Lauf. Mag das streckenweise ein wenig ermüdend sein, passt es gut zur Atmosphäre des kleinen Bergdorfes. Ihm gegenüber stellt sich zunehmend eine gewisse Wohligkeit ein, die nicht zuletzt dadurch befördert wird, dass Torleif beginnt, sich Raum zu nehmen - ohne Rücksicht auf Resonanzen.
Elin Hansson: "Zweiklang". Roman.
Aus dem Norwegischen von Meike Blatzheim und Sarah Onkels. Arctis Verlag, Zürich 2025. 320 S., geb., 19,- Euro. Ab 14 J.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 05.03.2025
Verwirrende Gefühle
Obwohl das Cover sehr japanisch anmutet, spielt die Geschichte in Norwegen, allerdings übernimmt ein japanischer Dozent eine wichtige Rolle ein.
Torleif bezeichnet sich selbst als queer und das in dem Internat in der Stadt macht es ihm auch gar keine Schwierigkeiten. Sein bester Kumpel Kim, der ebenfalls homosexuell ist unterstütz ich sehr, denn er ist bei seiner Mutter sehr frei aufgewachsen.
Torleif hingegen hatte in seinem Heimatdorf Problem den Vorurteilen der anderen Bewohner, deshalb hatte er seine sexuelle Ausrichtung auch immer verschwiegen. Seit dem Tod seiner Mutter hat er es auch vermieden nach Hause zu Vater und Bruder zu fahren, dessen großes Hobby die Jagd ist. Doch denn hat sein Großvater, den er Goffa nennt und der ein großer Geigenbauer ist, einen Schlaganfall und Torleif fährt zu seiner Unterstützung nach in das kleine Dorf in den Bergen. Schon bald trifft er auf seinen alten Freund, der sich außer, dass er dicker geworden ist, nicht verändert hat. Torleif spielt selbst sehr gut Geige und wird von Anne, seiner alten Dozentin, gebeten sie zu vertreten. So lernt er den japanischen Künstler Horimyo kennen, von dem er sich magisch angezogen fühlt.
Das Buch zeigt, wie schwer es ist sich zu outen und seiner Umgebung zu gestehen, dass man queer ist. Torleif ist ein junger Mann, der die Trauer um seine Mutter immer noch nicht verarbeitet hat und der von seinem Vater und seinem älteren Bruder keine Unterstützung erwartet. Ganz anders ist sein Verhältnis zu seinem Goffa, der alte Mann kann die Gefühle seinen Enkels gut erkennen und er gibt ihm immer wieder Mut, sich dem Leben zu stellen.
Toreif erzählt seine Geschichte in dem Buch selbst, so konnte ich seine Gefühle sehr gut mitempfinden und mit ihm leiden. Ein sehr sensibles geschriebenes Buch mit viel Musik (die Playlist kann man herunterladen) und wundervollen Aussagen. Zitat Goffa: Jeder muss so sein dürfen, wie er ist.
LovelyBooks-Bewertung am 05.03.2025
Ein queerer junger Geigenspieler muss ich seinen Gefühlen stellen









