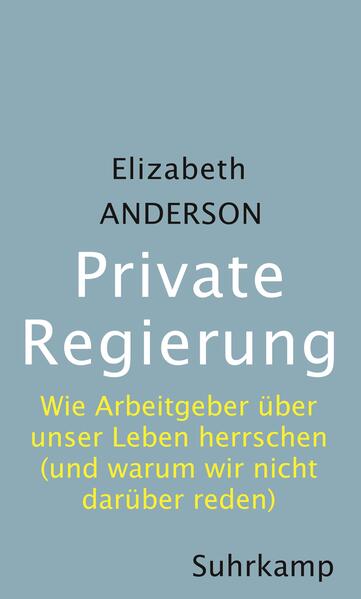
Zustellung: Di, 26.08. - Di, 02.09.
Versand in 6 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Als Adam Smith und andere die Theorie freier Märkte entwickelten, war das ein progressives Projekt: Die Freiheit der Märkte sollte auch zur Befreiung der Lohnabhängigen führen - von den Zwängen obrigkeitsstaatlicher Strukturen, vor allem aber von der Gängelung durch die Arbeitgeber. In ihrem furiosen Buch zeigt Elizabeth Anderson, was aus dieser schönen Idee geworden ist: reine Ideologie in den Händen mächtiger ökonomischer Akteure, die sich in Wahrheit wenig um die Freiheit und die Rechte von Arbeitnehmern scheren.
Bereits die Industrielle Revolution hat den vormals positiven Zusammenhang zwischen freiem Markt und freiem Arbeiter aufgelöst, wie Anderson im ideengeschichtlichen Teil ihrer Untersuchung darlegt. Im nächsten Schritt bestimmt sie die gegenwärtige Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu: als eine von Regierungen und Regierten, wobei diese »Regierungen« private sind und quasi autokratisch herrschen können. Das Nachsehen haben die Beherrschten, nämlich die Arbeitnehmer, wie Anderson anhand zahlreicher Beispiele belegt. In beeindruckender Gedankenführung und stilistisch brillant dekonstruiert sie einen Mythos des Marktdenkens. Ein Glanzstück der Ideologiekritik.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. Februar 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
259
Autor/Autorin
Elizabeth Anderson
Übersetzung
Karin Wördemann
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
348 g
Größe (L/B/H)
205/128/25 mm
ISBN
9783518587270
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Elizabeth Andersons kluge Reflexionen führen uns eindringlich vor Augen, warum wir die Rechte von Arbeitnehmenden nicht als nebensähclich abtun dürfen. « Michael Holmes, NZZ am Sonntag
»Auf Elizabeth Andersons Ausführungen folgen . . . vier kritische Kommentare von renommierten Kollegen verschiedener Fächer, auf die Anderson wiederum antwortet. So schärft das Buch bestens den Blick dafür, dass in einer Zeit, in der Gewerkschaften als unsexy gelten, die Arbeitsbedingungen keineswegs Privatsache der Privatwirtschaft sind, sondern eine öffentliche Angelegenheit. « Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung
»Anderson gelingt es in ihrem historischen Abriss sehr gut zu zeigen, wie der ursprüngliche Gleichheitsgedanke aus dem liberalen Denken nach der industriellen Revolution verschwindet und nur noch die Freiheit der Märkte zur Maxime des Liberalismus wird. « Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Andersons beherztes Plädoyer, dass die politische Philosophie die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt stärker ins Blickfeld rücken sollte, besticht. « Friedemann Bieber, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Der freie Markt war mal eine linke Idee: Elizabeth Anderson erklärt in ihrem scharfsinnigen Buch Private Regierung, warum die industrielle Revolution daraus ein Zwangsregime gemacht hat. « Ronald Düker, DIE ZEIT
»Wie es zu diesem Teufelskreis kam und wie der Ausbruch glücken kann, erklärt die Politologin packend und transparent. « ZDF
». . . ein spannendes Buch über Arbeitsbeziehungen. « Thomas Gesterkamp, neues deutschland
»Eine Diskussion in Buchform. « Alice Henkes, SRF
»Anderson benennt einen wunden Punkt in der jahrzehntelangen Symbiose von Demokratie und Kapitalismus. « Johannes Thumfart, iw Institut der deutschen Wirtschaft
»Auf Elizabeth Andersons Ausführungen folgen . . . vier kritische Kommentare von renommierten Kollegen verschiedener Fächer, auf die Anderson wiederum antwortet. So schärft das Buch bestens den Blick dafür, dass in einer Zeit, in der Gewerkschaften als unsexy gelten, die Arbeitsbedingungen keineswegs Privatsache der Privatwirtschaft sind, sondern eine öffentliche Angelegenheit. « Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung
»Anderson gelingt es in ihrem historischen Abriss sehr gut zu zeigen, wie der ursprüngliche Gleichheitsgedanke aus dem liberalen Denken nach der industriellen Revolution verschwindet und nur noch die Freiheit der Märkte zur Maxime des Liberalismus wird. « Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Andersons beherztes Plädoyer, dass die politische Philosophie die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt stärker ins Blickfeld rücken sollte, besticht. « Friedemann Bieber, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Der freie Markt war mal eine linke Idee: Elizabeth Anderson erklärt in ihrem scharfsinnigen Buch Private Regierung, warum die industrielle Revolution daraus ein Zwangsregime gemacht hat. « Ronald Düker, DIE ZEIT
»Wie es zu diesem Teufelskreis kam und wie der Ausbruch glücken kann, erklärt die Politologin packend und transparent. « ZDF
». . . ein spannendes Buch über Arbeitsbeziehungen. « Thomas Gesterkamp, neues deutschland
»Eine Diskussion in Buchform. « Alice Henkes, SRF
»Anderson benennt einen wunden Punkt in der jahrzehntelangen Symbiose von Demokratie und Kapitalismus. « Johannes Thumfart, iw Institut der deutschen Wirtschaft
 Besprechung vom 12.03.2019
Besprechung vom 12.03.2019
Über den gewährten Respekt entscheidet der Marktwert
Amerikanische Verhältnisse: Elizabeth Anderson nimmt die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und in der Privatwirtschaft in den Blick
Die amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson beginnt ihren Frontalangriff auf den kapitalistischen Arbeitsmarkt mit einem Gedankenexperiment. Stellen wir uns ein Land vor, in dem jeder einen Vorgesetzten hat, dessen Befehle unbedingt zu befolgen sind. Die Vorgesetzten werden nicht gewählt, sondern von höherer Stelle ernannt. Ihre Befugnisse sind umfassend: Sie können Telefonate abhören und einen Kleidungsstil diktieren, sie können medizinische Tests anordnen und willkürliche Durchsuchungen. Die Menschen verbringen stets nur einen Teil ihrer Zeit in diesem Land, doch sie können auch für das bestraft werden, was sie außerhalb tun - für ihr politisches Engagement etwa, die Wahl ihres Lebenspartners, den Konsum von Freizeitdrogen. Die übliche Strafe: Herabstufung oder Exil. Zwar steht es jedem frei, auszuwandern, doch viele Menschen werden nur in Gegenden eine neue Heimat finden, in denen ganz ähnliche Verhältnisse herrschen.
"Ich gehe davon aus, dass die meisten Amerikaner das nicht glauben würden", schreibt Anderson. "Und doch arbeitet die Mehrheit von ihnen genau unter einer solchen Regierung: Es ist der moderne Arbeitsplatz, wie er in den Vereinigten Staaten für die meisten Unternehmen existiert." Und da an der Spitze vieler Unternehmen ein absoluter Befehlshaber stehe, das Anlagevermögen den Firmen und den Mitarbeitern nichts gehöre, handele es sich um kommunistische Organisatonsformen: "Die Mehrzahl der Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten wird im Arbeitsleben von kommunistischen Diktaturen regiert."
Dieses Bild freilich verfängt nicht nur nicht, es ist ein echtes Ärgernis. Dass Anderson, die zu den einflussreichsten politischen Denkerinnen der Gegenwart zählt, den Ausdruck "kommunistische Diktatur" als rein technischen Begriff verwendet, bezeugt eine verblüffende Gleichgültigkeit gegenüber seiner historischen Bürde.
Vor allem aber führt es in die Irre. Denn so eingeschränkt die Autonomie der Angestellten in einem Fastfood-Restaurant, so mühsam die Schichtarbeit, so groß die Schikane sein mag - niemand wird von dort in den GULag geschickt. Das Arbeitsrecht nennt Grenzen, die ein demokratisch verfasster Staat als höhere Instanz, unterstützt durch eine freie Öffentlichkeit, auch in den Vereinigten Staaten durchsetzt - und in der Regel mit Erfolg.
Es ist bedauernswert, dass Anderson sich durch ihre Wortwahl so leicht angreifbar macht, denn viele ihrer Überlegungen und Forderungen sind gut begründet. Die These etwa, dass Unternehmen mitunter auf eine kaum zu rechtfertigende Weise ins Leben ihrer Angestellten eingreifen, bedarf keines rhetorischen Bombasts, sondern bloß einiger Fakten. Letztlich, so Anderson, sei das Maß an Respekt und Autonomie, das den Angestellten zugestanden werde, stets "ungefähr proportional zu ihrem Marktwert."
Diese Diagnose bezieht sich zunächst auf die Vereinigten Staaten und lässt sich auf andere Industrienationen - zum Glück - nur eingeschränkt übertragen. In Deutschland etwa sind die Arbeitsschutzgesetze erheblich strenger. Anders als in vielen amerikanischen Bundesstaaten können Angestellte zudem nicht jederzeit ohne Grund und bei nur zweiwöchiger Lohnfortzahlung entlassen werden. Anderson selbst zitiert Deutschland wiederholt als Beleg dafür, dass auch ein sozialer gestalteter Arbeitsmarkt wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Doch auch hierzulande haben prekäre Arbeitsverhältnisse, etwa in der Leiharbeit, in den vergangenen Jahren zugenommen.
Die langjährige Blindheit der politischen Philosophie gegenüber der Macht der Arbeitgeber sieht Anderson in einem historischen Missverständnis des freien Marktes begründet. Im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert, als Adam Smith "The Wealth of Nations" schrieb, sei liberalen Denkern ein unkontrollierter Arbeitsmarkt als egalitäres Ideal erschienen - und das zu Recht, versprach er doch eine Befreiung aus den Fesseln feudalistischer Abhängigkeiten. Die Industrialisierung und fortschreitende Arbeitsteilung aber hätten vielen Menschen in der Folge die Alternative eines selbständigen Broterwerbs genommen. Das habe ihre Verhandlungsposition gegenüber den Arbeitgebern so sehr geschwächt, dass der Vertragsschluss in der Regel kaum noch frei zu nennen sei. Nur einige Hochqualifizierte, Universitätsprofessoren etwa oder Top-Manager, sind heute laut Anderson in der Lage, individuell über die Bedingungen ihrer Anstellung zu verhandeln. Geringqualifizierte dagegen hätten, zumindest ohne die Organisation in Gewerkschaften, kaum Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen und könnten daher in einem schwach regulierten Arbeitsmarkt eben gerade nicht als frei gelten.
Die Grundlage für Andersons Buch, das in einer gelungenen Übersetzung von Karin Wördemann erscheint, bilden die Tanner Lectures, die sie 2015 an der Universität Princeton gehalten hat. Ihre für die Publikation überarbeiteten Vortragsmanuskripte werden von vier Kommentaren flankiert, in denen die Historikerin Ann Hughes, der Literaturwissenschaftler David Bromwich, der Philosoph Niko Kolodny und der Ökonom Tyler Cowen einzelne Aspekte kritisch diskutieren.
Andersons beherztes Plädoyer, dass die politische Philosophie die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt stärker ins Blickfeld rücken sollte, besticht. Zeitgemäß aber erscheint es nicht zuletzt auf Grund einer Entwicklung, die Anderson ignoriert - dem Aufstieg der Gig-Economy. Jene, die zu Zehntausenden bei Uber oder auf Plattformen wie TaskRabbit ihre Dienste anbieten, unterliegen eben keiner privaten Regierung mehr. Niemand kann ihnen Arbeitszeiten vorschreiben oder eine Frisur verbieten. Sie arbeiten als Selbständige und im Auftrag von Privatpersonen. Andersons zentrale Frage aber stellt sich auch hier: Unter welchen Bedingungen können Menschen auf diesem Arbeitsmarkt als frei gelten?
FRIEDEMANN BIEBER
Elizabeth Anderson:
"Private Regierung". Wie Arbeitgeber über unser Leben herrschen (und warum wir nicht darüber reden). Aus dem Englischen von Karin Wördemann. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 259 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








