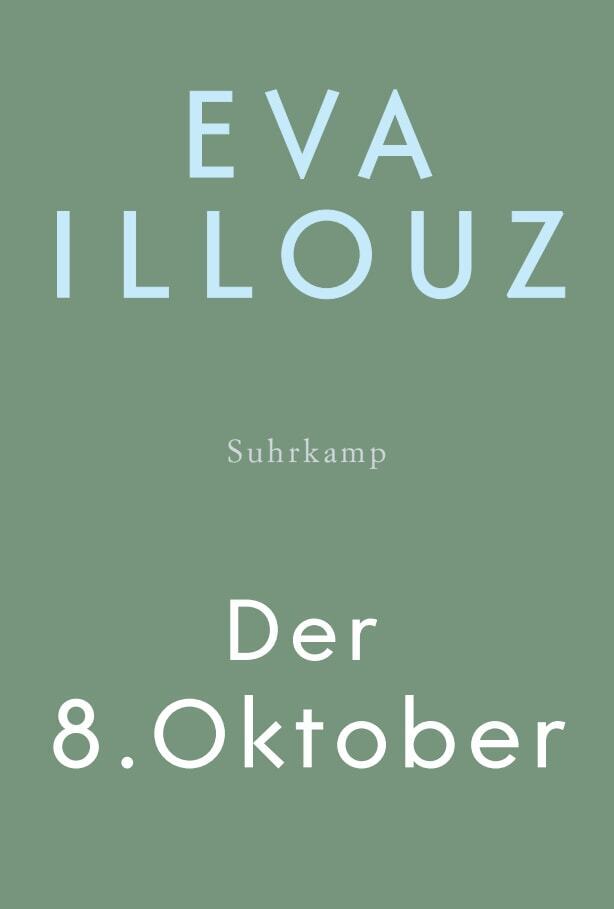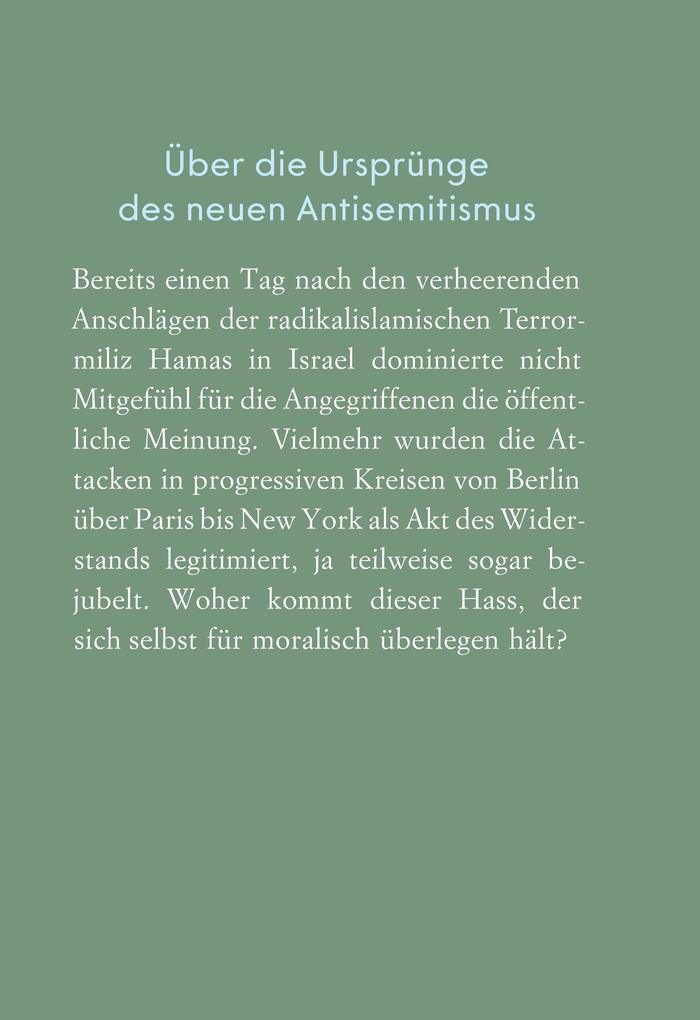Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Der tugendhafte Antisemitismus
Wann schlägt Antizionismus in Antisemitismus um? Eva Illouz hat in den letzten zwei Jahren unermüdlich die Narrative ihres eigenen akademischen Umfelds hinterfragt. In ihrem nun erschienenen Essay geht sie den tiefer liegenden Ursachen für das gegenwärtig vergiftete Diskursklima nach.
Von Tania Martini
Von Tania Martini
Ist Mitleid das zentrale Gefühl, in dem sich die Linke von der Rechten unterscheidet? Und ist unser sozialer und moralischer Fortschritt das Verdienst linker Politik? Laut der israelisch-französischen Soziologin Eva Illouz ist das so. Die Linke habe das Mitleid stets zu institutionalisieren versucht, wofür sie von Konservativen immer wieder belächelt worden sei. Warum aber reagierten dann so viele progressive Linke angesichts der grauenvollen Massaker des 7. Oktobers 2023, die doch unbedingt eine Reaktion des Mitleids hätten hervorrufen müssen, mit Schadenfreude und begrüßten die Hamasmorde gar als legitimen Widerstand?
Diese Frage lässt die Emotionstheoretikerin Illouz nicht los. Zumal sie selbst nie zurückhaltend war in ihrer Kritik an der israelischen Regierungspolitik. "Der 8. Oktober" ist der Titel ihres soeben auf Deutsch erschienenen Langessays, in dem sie beantworten möchte, wann und warum weite Teile ihres eigenen linksakademischen Milieus - das doch mit Recht dem Rassismus bis in die kleinsten diskursiven Verästelungen nachspürt - den Juden ihre Solidarität aufgekündigt haben. Gerade bei jenen, die doch ein besonderes Maß an Mitleid für sich beanspruchten, werde dessen Ausbleiben zu einem großen Rätsel.
Mitleid - so Illouz' Annahme, Schopenhauer folgend - ist das Fundament von Moral schlechthin. Mehr noch: Es sei universell, instinktiv und unwillkürlich. Nun könnte man mit Kant, Freud, Althusser oder ein paar anderen einwenden, Mitleid sei gerade nicht instinktiv, sondern kulturell geformt, konflikthaft oder ideologisch produziert. Doch Illouz interessieren hier eher Einwände aus der Sozialpsychologie: Die Fähigkeit zum Mitleid kann beeinträchtigt werden, wenn die Opfer als mächtig wahrgenommen werden oder eine gewisse Distanz zu ihnen besteht. Oder wenn das Leiden den Opfern selbst zur Last gelegt wird.
Das Rätsel des fehlenden Mitleids für die Opfer von Antisemitismus beschäftigt angesichts des maßlosen und scheinbar planlosen Krieges der Netanjahu-Regierung und des unermesslichen Leids der allermeisten Palästinenser nur noch wenige. Zugleich nehmen antisemitische Übergriffe weltweit dramatisch zu, und der Begriff Zionist ist längst zum Schimpfwort geworden. Dass die israelische Regierung, in der einige Minister ihre genozidalen Absichten nicht einmal verstecken, der Entsolidarisierung in die Hände spielt, sieht Eva Illouz. Auch die teils verhärtete und rechtsgerichtete jüdische Identitätspolitik, mit ihren schrillen Interventionen gegen den stumpfen Israelhass, hat daran ihren Anteil.
Aber wie man schon lange weiß: So wie der Antisemit keinen Juden braucht, um antisemitisch zu sein, kommt auch der Antizionismus ohne den Staat Israel aus. Schon gar nicht unterscheidet der Antisemit zwischen Juden und Israelis. Aber Illouz möchte Antisemitismus nicht mit Antisemitismus erklären. Das erschiene ihr tautologisch. Und auf gar keinen Fall ist jeder Antizionist auch ein Antisemit. Auch würde man bei denen, die sie vor Augen hat, die sogenannte progressive Linke, ja kaum klassischen Antisemitismus vermuten - selbst wenn das mehr als schwerfällt, wenn etwa der linke Humanökologe Andreas Malm angesichts der Hamas-Hölle des 7. Oktobers fabuliert: "Wie sollten wir da nicht vor Erstaunen und Freude aufschreien?"
Wie ist das also mit dem Mitleid, das angeblich so universell, instinktiv und unwillkürlich ist? Pathologisierungen helfen hier ebenso wenig weiter wie Stigmatisierungen. Das Mitleid ist auch nicht einfach verschwunden. Illouz hat einen anderen Verdacht und fragt: Kann es sein, "dass sich dieses mangelnde Mitleid wie eine moralische Übung gibt statt wie ein moralisches Versäumnis"? Bedenkt man den Selbststolz und den penetranten Gestus des Wahrsprechens jener Leute, lässt sich erahnen, was gemeint ist. "Dieser Antisemitismus erklärt sich nicht durch den Judenhass als solchen, sondern durch die Windungen, die er nimmt, damit der Hass auf die Israelis die Tugend selbst verkörpert", so Illouz. Er geht den paradoxen Weg einer Tugend.
Nun weiß man, dass das Jahr 1967 der Kipppunkt in der Haltung der Linken gegenüber Israel ist. Israel hatte im Sechstagekrieg innerhalb weniger Tage Gebiete von Ägypten, Jordanien und Syrien erobert. Es war auch die Geburtsstunde der aggressiven Siedlerbewegung. Die meisten aufgeklärten israelischen Beobachter sehen in der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens den größten Fehler in der Geschichte Israels.
Der russisch-französische Historiker und Pionier der Holocaustforschung Léon Poliakov hat bereits in den Achtzigerjahren eindrücklich die Stimmungswende analysiert, in der ein äußerst harscher Antizionismus sehr populär wurde. "Mit dem Sechstagekrieg änderte sich bekanntlich alles, sowohl auf der rechten Seite des ideologischen Spektrums - mit General de Gaulles 'kleiner Anmerkung' über das selbstbewusste und herrschsüchtige Volk - als auch auf der linken Seite - mit der Erhebung der Fedajin zu zentralen Figuren einer expandierenden Dritte-Welt-Ideologie", schrieb Poliakov.
Verschiedenste Widersprüche hätten fortan ein Symbol im jüdisch-arabischen Konflikt gefunden. Was unmittelbar einleuchtet, bedenkt man, dass einige der irrlichterndsten Stimmen der heutigen Palästinasolidarität gar Queerness, Klima und völlig disparate Fragen indigener Identitäten mit der Lösung jenes Konflikts in Verbindung bringen. Der Autor und Aktivist Steve Cohen nannte das sehr treffend einen "transzendentalen Antizionismus".
Der revolutionäre Geist der Sechzigerjahre erklärt Illouz zufolge jedoch nicht hinreichend den heutigen linken Antizionismus und Antisemitismus, der, wie sie findet, sich vor allem an den Universitäten ausgebreitet hat (hier hat sie in erster Linie die Geisteswissenschaften in den USA im Auge). Sie sucht vielmehr in den ideologischen Strukturen nach Antworten, genauer: in der sogenannten French Theory, die sie als eine Mischung aus Postmoderne, Dekonstruktion und Postkolonialismus vorstellt.
Illouz beabsichtigt keineswegs, diese Theorien pauschal zu diskreditieren, schließlich betreibt sie hier selbst Diskursanalyse. Wer ihr übriges Werk kennt, weiß, dass sie sich immer mal wieder auf Michel Foucault bezieht. Und doch stimmt sie ein in eine alte Klage, die leider immer wieder dieselben Diskussionen befeuert; es ist die reduktionistische Klage darüber, dass die postmodernen Denker maßgeblich von antidemokratischen Denkern wie Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger und Carl Schmitt beeinflusst sind. Deren irrationale Ablehnung von Vernunft, universalistischer Moral, Liberalismus und westlicher Welt im Allgemeinen habe einen spezifischen Denkstil hervorgebracht, so Illouz, für den sie im Buch insbesondere Jacques Derrida und Louis Althusser stellvertretend nennt. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die erkenntnistheoretischen Prämissen dieses Denkens, das sich kaum auf wissenschaftliche Verfahren, sondern moralische Autorität stütze. Sie interessiert sich nicht für den philosophischen Gehalt der Texte, sondern für den Denkstil - und insbesondere für dessen grob vereinfachte Vereinnahmungen.
Sehr verdichtet arbeitet sie Verfahrensweisen der postmodernen Theorie heraus und zeigt, was ihre Adepten daraus ableiten: Beobachtungen über Strukturen würden ständig von einem auf einen anderen Kontext übertragen und gegenüber der Geschichte privilegiert. Das führe im Konkreten etwa zu der Annahme, der Begriff des Siedlerkolonialismus sei gleichermaßen auf Israel wie auf die USA anwendbar, obwohl die historischen Kontexte grundlegend verschieden sind. Dabei werden die antikolonialen Aspekte der israelischen Staatsgründung ausgeblendet und die Besetzungen von 1967 rückprojiziert auf die Staatsgründung von 1948, wodurch Israel pauschal als Besatzungsmacht stigmatisiert wird.
Weiter unterstelle man in einer Art "Pantextualismus", alles sei gewissermaßen Text. Die Metapher werde auf das soziale Leben ausgedehnt, was wiederum suggeriere, die Wirklichkeit selbst sei beliebig interpretierbar. Schließlich der "pouvoirisme": eine übermäßige Orientierung an einem Machtbegriff, der eine abstrakte, akteurslose Macht setze, die sowohl textuelle Praktiken wie auch die soziale Sphäre umfasse, ohne dass es noch möglich wäre, zwischen legitimer und illegitimer Macht zu unterscheiden. Foucaultianer würden hier einwenden, dass doch gerade das relationale Verständnis von Macht eine differenzierte Analyse von Herrschaftsverhältnissen ermöglicht und das dichotomische Verhältnis Herrscher versus Beherrschte unterläuft.
Schwerer noch wiegt Illouz' Vorwurf, in der dekonstruktivistischen Methode ersetze die Gewissheit des Sprechers die Methoden der Wahrheitsfindung. Die Differenz zwischen Wissenschaft und Mythos werde dadurch zunehmend verwischt. So polemisch und verallgemeinernd das klingen mag, so deutlich lassen sich entsprechende Tendenzen in den Praktiken eines überschießenden Aktivismus im Wissenschaftsbetrieb beobachten - etwa dann, wenn diskursive Chiffren wie "globales Palästina" gesetzt oder affirmiert werden, die den konkreten, territorialen Konflikt übersteigen.
Illouz beobachtet die Herausbildung einer "autoritären Wissenschaft", in der "die erkenntnistheoretischen und sozialen Bedingungen so zusammenfallen, dass es schwierig, ja unmöglich wird, einen Typus von Erkenntnis infrage zu stellen, weil sie gleichzeitig nicht falsifizierbar sind und mit der Moral selbst gleichgesetzt werden". Und tatsächlich kann man diese Prozesse beobachten, wenn sowohl die Legitimität der Sprecherposition als auch der Wahrheitsgehalt einer Aussage aus der Herkunft abgeleitet und deshalb nicht mehr zur Disposition gestellt werden: "I'm a Palestinian scholar" oder "I'm a Jewish scholar" sind Sätze, mit denen die entsprechenden Akteure gerne mal ihre Ausführungen untermauern.
Vieles in Eva Illouz' Essay ist klug. Bereits in ihren letzten Artikeln und Interviews hat sie diese geradezu häretische Position gegenüber dem eigenen linksakademischen Umfeld eingenommen. So anregend und frei von falschen Loyalitätsreflexen ist ihre Kritik, dass man ihr gerne einige Schwächen verzeiht. Der vereinzelt geäußerte Vorwurf, sie würde hier gleich die gesamte postmoderne Theorie ablehnen, greift zu kurz, auch wenn sie in der Tat oftmals nicht genügend unterscheidet zwischen den Adepten und den Urhebern der sogenannten French Theory. Weshalb sie den theoretischen Ballast aus Schopenhauers metaphysischer Mitleidsethik mitschleppt, leuchtet auch nicht ein.
Dennoch ist "Der 8. Oktober" ein anregender, augenöffnender und unbedingt lesenswerter Essay. Lohnend sind auch Illouz' Hinweise auf einige zeitgeschichtliche Aspekte in Frankreich und den USA, wo neue Bündnisse zwischen der progressiven Linken, dem konservativen Islam und islamistischen Organisationen entstanden sind. Den ideologischen Kitt liefern die Narrative des Imperialismus und des Kolonialismus. Für diverse politische Organisationen kann Illouz nachweisen, wie im Sinne der dekolonialen Matrix die Juden als weiß und privilegiert markiert und bewusst aus dem Kreis der Minderheiten ausgeschlossen wurden. Dass es dabei nicht nur um verbalradikale Spielereien und spätjugendliche Vergemeinschaftungsprozesse geht, sondern um ganz konkrete politische Allianzen, zeigen die zahlreichen extremistischen Außenposten der Muslimbruderschaft an den amerikanischen Universitäten (die Donald Trump freilich zuträglich sind).
Dass die Grenzen zwischen obsessivem Antizionismus und Antisemitismus fließend sein können, ist nicht neu. Dass in den Demonstrationen der letzten Monate jedoch immer wieder rhetorisch die Grenze zum eliminatorischen Antisemitismus überschritten wurde, ist unbegreiflich.
Illouz versucht das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Vielleicht kann das per se nicht gänzlich gelingen. Und vielleicht gilt hier, was Jan Philipp Reemtsma in einem Text formulierte, als er vorschlug, statt der Frage nachzugehen, ob jemand antisemitisch ist oder ab wann die viel bemühte Israelkritik in Antisemitismus umschlägt, zu fragen, welche Affekte die politische Agitation stimuliert. Und dann kann man sich ja einfach noch mal fragen, wie die Freude am 7. Oktober 2023 frei von Antisemitismus gewesen sein kann.
Eva Illouz: "Der 8. Oktober".
Aus dem Französischen
von Michael Adrian.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2025, 102 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.