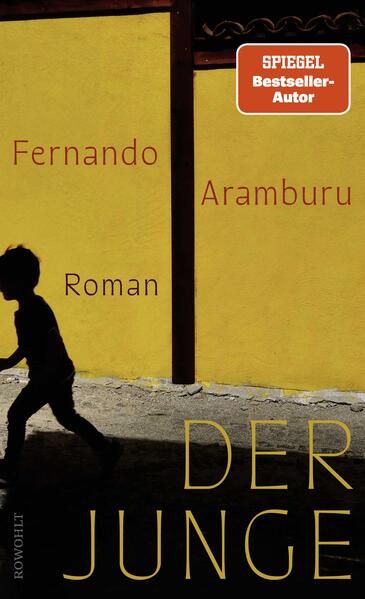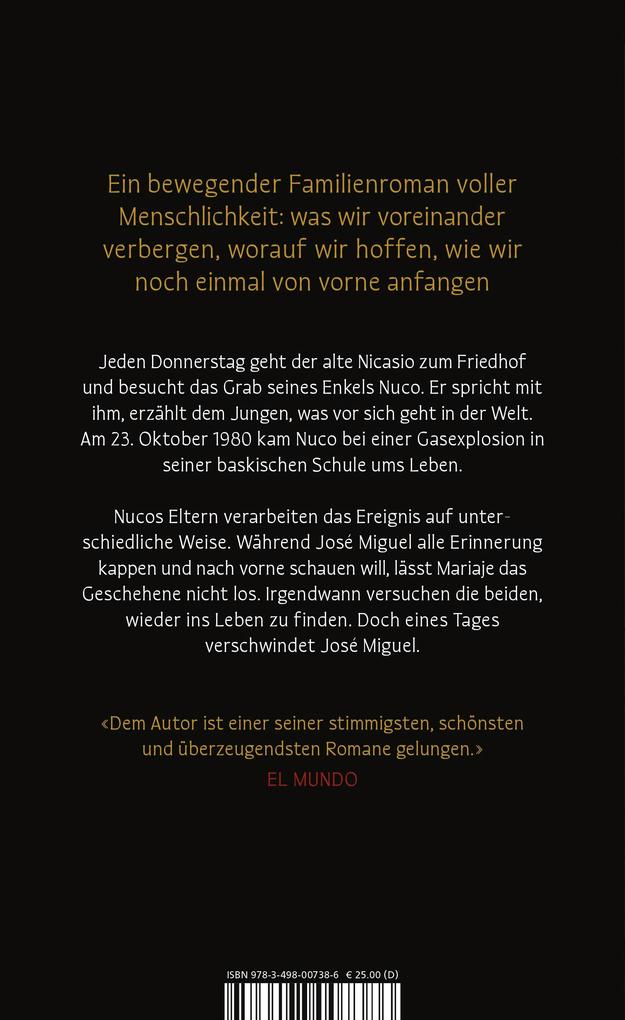Besprechung vom 17.04.2025
Besprechung vom 17.04.2025
Die Spur des Schweigens nach der Explosion
Nach dem Mammutwerk "Patria" beschäftigt Fernando Aramburu sich in seinem Roman "Der Junge" weiter mit dem Zusammenhang von kollektiver Tragödie und privaten Emotionen.
Die Ersten, die den ohrenbetäubenden Lärm hörten, vermuteten, es handle sich um ein Attentat der ETA. Als sich am 23. Oktober 1980 in dem baskischen Dorf Ortuella (in der Provinz Bizkaia, nahe Bilbao gelegen) eine gewaltige Detonation in der Grundschule Marcelino Ugalde ereignete, war dies jedoch verursacht durch Reparaturarbeiten eines Klempners, der dabei versehentlich eine unter dem Gebäude befindliche Propangasflasche zur Explosion brachte. 48 Kinder und drei Erwachsene wurden durch die Druckwelle getötet, ebenso viele wurden verletzt.
Der seit vielen Jahren in Hannover lebende spanische Schriftsteller Fernando Aramburu möchte in seinem Roman "Der Junge" an diese Tragödie seiner baskischen Heimat erinnern und gleichzeitig exemplarisch vorführen, wie die leidvolle Erfahrung des Verlustes eines Kindes sich auf die Mitglieder seiner Familie und deren Beziehungen untereinander auswirkt. Mit der Frage, wie Verlustschmerz von Familien erlebt wird, kennt Aramburu sich aus, denn genau dies war auch der erzählerische Motor seines in zahlreiche Sprachen übersetzten Bestsellers "Patria" (2016) - hier ging es in der Tat um die Terrorakte der ETA und die Möglichkeit der Versöhnung nach dem Ende der Gewalt. In diesem weit ausgreifenden Roman spricht die Witwe Bittori zum Grab ihres ermordeten Mannes Txato; im schmal gehaltenen Werk "Der Junge" ist es der psychisch derangierte Großvater Nicasio, der zum Grab seines bei dem Unfall in Ortuella gestorbenen, über alles geliebten sechsjährigen Neffen Nuco spricht. Hier enden die Gemeinsamkeiten zwischen den letztlich sehr unterschiedlichen Romanen - aber die Parallele zeigt, dass es dem Autor wiederholt um eine literarische Bearbeitung des Zusammenhangs von kollektiver Tragödie und privaten Emotionen zu tun ist.
Bezogen auf die historisch reale Tragödie von Ortuella, birgt dies die erzählerische Gefahr der melodramatischen Verbrämung von realem menschlichem Leid. Dieser Gefahr ist sich Aramburu überaus bewusst, denn er sucht sie zu bannen mit dem Einschub von zehn metanarrativen, typographisch abgesetzten Zwischenkapiteln, in denen nicht der Autor, sondern der personifizierte Text selbst direkt über die Herausforderungen der literarischen Umsetzung spricht: "Ich bin mir bewusst, dass ich als Erzählungsträger eines Unglücks fungiere, dessen Ausmaß beschreiben zu wollen immer vergeblich bleiben muss (. . .). Gewagte Vergleiche, glänzende Metaphern und Allegorien zuhauf wird man bei mir nicht finden; allerdings bin ich - jedenfalls glaube ich das - auch nicht das Ergebnis eines quälend trockenen Tatsachenberichts." Dass der derart über sich selbst sprechende Text dann wiederholt seinem Autor mehr oder weniger direkt den "richtigen Ton" attestiert oder über das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit reflektiert, ist unnötig kokett und gedanklich eher schlicht: "Der mich schreibt, ist dafür verantwortlich, dass ich diese und jene Dinge zum Ausdruck bringe und sie auf die eine oder andere Weise ausdrücke."
Eindringlicher ist da schon, wie der Roman vom Großvater erzählt, vom Vater José Miguel, von der Mutter Mariaje (hinter der sich offenbar eine reale Informantin verbirgt, deren Geschichte Aramburu hier verarbeitet). Nach der anfänglichen Schockstarre anlässlich des Verlustes von Nuco entwickelt der Roman allmählich ein Psychogramm der Figuren (wobei die Perspektive von Mariaje privilegiert wird), die Hintergründe der Familie aus einfachen Verhältnissen werden aufgerollt, Geheimnisse und Untiefen einer Ehe kommen ans Licht, eine weitere Tragödie geschieht. Das ist erzählerisch effektiv und selbstredend emotional anrührend gemacht. Leider verzichtet Aramburu dabei nicht auf durch den Erzähler verabreichte psychologische Gemeinplätze: So ist etwa für Mariaje mit den Erinnerungen zu leben "über all diese Jahre eine der größten Herausforderungen [. . .] gewesen".
Stark ist die Erzählung immer dann, wenn sie ganz konkret Verhaltensweisen beschreibt - zwischen den Polen der Verdrängung, der Selbsttäuschung und dem Versuch eines Neuanfangs: der Vater, der das Zimmer des Sohnes restlos ausräumt und umgestaltet - und sich ein neues Kind mit Mariaje wünscht; der Großvater, der dieses Zimmer in seiner eigenen Wohnung bis ins kleinste Detail wieder aufbaut; die Distanzierung Mariajes von ihrem gutmütigen, aber, wie sie nun findet, auch unsicheren und biederen Mann und ihre Reaktion auf das Gebaren des Großvaters, der so tut, als lebe Nuco noch, mit ihm spricht und ihn weiterhin zur Schule bringen will. Diese Autosuggestion seitens Nicasios ist eine Strategie der literarischen Überhöhung, wodurch der tote Junge für den Roman an Präsenz gewinnt, der selbst wiederum als Literatur eine Wiederbelebung des Vergangenen unternimmt. Allerdings umschiffen die rührseligen Szenen zwischen Nicasio und seinem imaginierten Enkel dann eben doch nicht immer die von dem Metakommentar ausgemachten Gefahren der "Sentimentalität" und des "Pathos".
Die kurzen Kapitel des Romans wechseln zwischen den Perspektiven der Familienmitglieder, zwischen den zeitlichen Ebenen und springen auch unvermittelt zwischen allwissendem Erzähler und direkter Figurenrede. Immer wieder wird auch der Leser, ein imaginärer Gesprächspartner oder auch explizit der Autor direkt adressiert. Aramburu schreibt in einem einfachen Stil mit kurzen Sätzen. Das liest sich auch in der deutschen Version recht flüssig, obwohl die Übersetzung Willi Zurbrüggens oft zu wörtlich vorgeht, was mal unnötig altmodisch ("Backfischalter", "mütterliche Bangnis"), mal seltsam gestelzt klingt ("dann gib der Frömmigkeit Saures"). Insgesamt ist der Roman Aramburus ein wohlmeinender Versuch, eine Sprache für etwas Beschwiegenes zu finden. So sagt Mariaje einmal dem Erzähler: "Draußen auf der Straße, auf den Plätzen, in den Bars oder Läden wurde die Explosion nie erwähnt. [. . .] Und trotzdem war das Leid allgegenwärtig. Man erkannte es an den Gesichtern, an den Blicken, an der Spur des Schweigens, die manche hinterließen." Aramburus Roman zeigt, wie Menschen sich im Leid verlieren oder sich wiederfinden. Trotz der einfachen Sprache macht er dabei manchmal zu viele Worte. JOBST WELGE
Fernando Aramburu:
"Der Junge". Roman.
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rowohlt Verlag, Hamburg 2025.
256 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.