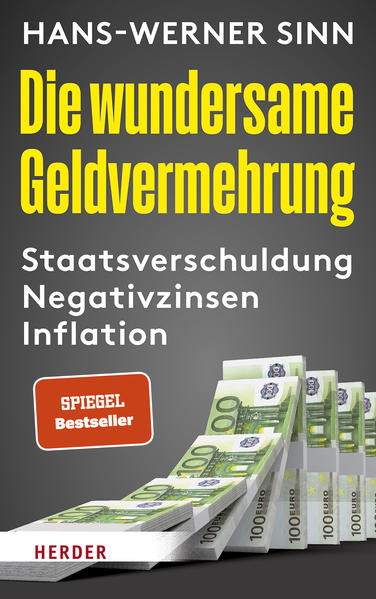Besprechung vom 26.08.2025
Besprechung vom 26.08.2025
Wozu führt Staatsverschuldung?
Die Ökonomen sind uneins. Nur dies haben sie gemeinsam: Politische Aspekte bleiben unterbelichtet. Fünf Bücher, die helfen, sich einen Überblick zu verschaffen.
Als am 18. März die Unionsfraktionen und die SPD mit Unterstützung der Grünen im Bundestag die Schuldenbremse im Grundgesetz lockerten, gelang Friedrich Merz schon vor seiner möglichen Wahl zum Bundeskanzler ein bemerkenswerter Coup. Bereits die Vorankündigung Anfang März ließ die Zinsen für Konsumenten-, Unternehmens- und Staatskredite um knapp einen Prozentpunkt steigen - eine Bewegung, die trotz zweier EZB-Zinssenkungen bis heute nicht vollständig korrigiert ist und dem Staatshaushalt und den Haushalten sowie Unternehmen künftig Milliarden an zusätzlichen Zinskosten auferlegt.
Sollte der neue Kurs beibehalten werden, dürfte Deutschlands Schuldenstand in den kommenden zehn Jahren in die Nähe der 100-Prozent-Marke des BIP klettern. Frankreich zeigt - mit rund 113 % des BIP - bereits heute, welche politischen Verwerfungen eine so hohe Verschuldung mit sich bringen kann: verhärtete Verteilungskämpfe und instabile Regierungen, die nicht selten an der Schuldenfrage scheitern. Auch die USA, deren Schuldenstand schon jetzt bei 117 Prozent des BIP liegt, steuern mit Donald Trumps fiskalpolitischen Plänen ("One Big Beautiful Bill") auf zusätzliche 3,7 Billionen US-Dollar Einnahmeverluste in den kommenden zehn Jahren zu. Ob die Wachstumsstrategie dieses Gesetzes tatsächlich die Schuldenquote reduzieren wird, ist mehr als fraglich. Nach den eher konservativen Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) steigt die Schuldenquote bis Ende 2034 auf etwa 124 Prozent des BIP.
Der Disput um die Schuldenbremse wird mit einer Vehemenz geführt, die auch die Fachliteratur in zwei Lager spaltet. Auf der einen Seite steht exemplarisch das jüngste Werk des Berkeley-Ökonomen Barry Eichengreen und seiner Ko-Autoren: "In Defence of Public Debt" (2021). Die Autoren rollen die Geschichte der Staatsschuld von Syrakus bis zur Corona-Krise auf und kommen zu einem wenig überraschenden Urteil: Gut gemanagte Schulden sind kein Sündenfall, sondern politisches Kapital. Der eigentliche Reiz des Buches liegt in seiner historischen Breite: Florentinische Kaufleute finanzierten im 14. Jahrhundert ihre Kriege mit den ersten handelbaren Anleihen ("monti"), das englische Parlament verlieh Gläubigern nach der Glorious Revolution Sitz und Stimme, und der daraus resultierende Liquiditätsschub befeuerte die industrielle Revolution.
Jede Epoche liefert eine Pointe: Die Athener bauten Tempel, die Venezianer ihre Flotte, die Briten ein Empire - stets auf Pump. Schulden werden so zu den "stillen Motoren der Modernisierung". Die Autoren hätten auch einen Blick auf die bayerischen Könige werfen können: Sowohl der "Kini" Ludwig II. als auch sein Großvater Ludwig I. errichteten Schlösser und Infrastruktur auf Kredit. Doch die Verfasser verschweigen die Schattenseiten der Verschuldung nicht. König Dionysios von Syrakus zwang seine Gläubiger beispielsweise dazu, ihre Münzen an den Staat abzuliefern - um sie anschließend kurzerhand zu halbieren.
Gewicht bekommt das Buch, weil es die Gegenwart nicht ausspart. Nach Finanzkrise und Pandemie stehen die Industriestaaten knietief in Schulden - und sind dennoch nicht kollabiert. Der Grund: historisch niedrige Zinskosten und der hohe gesellschaftliche Preis eines radikalen Sparkurses, der allerdings nur behauptet wird und nicht belegt wird. Darin liegt der eigentliche "Verteidigungsfall" der Autoren: Schulden dienen der Staatsraison, wenn sie - wie 2020 - Existenzen retten und damit das Vertrauen in die Republik sichern. Gleiches gilt für militärische Ausgaben, eines der ältesten Verschuldungsmotive staatlicher Politik. Gänzlich unkritisch ist das Werk dennoch nicht. Indirekt raten Eichengreen et al. Berlin, die Schuldenbremse nicht zum Fetisch werden zu lassen. Wichtiger als ein starrer Grenzwert ist ein glaubwürdiger Pfad zurück zur Konsolidierung - "erst, wenn es die Konjunktur zulässt".
Eine andere Sicht liefert Carmen Reinharts und Kenneth Rogoffs Klassiker "Dieses Mal ist alles anders: Acht Jahrhunderte Finanzkrisen" (2011, deutsche Ausgabe). Die Autoren identifizieren seit 1800 stolze 320 Staatsinsolvenzen, davon rund 250 wegen Auslands- und siebzig wegen Inlandsverschuldung. Berühmt-berüchtigt ist ihr Kipppunkt von neunzig Prozent Staatsschulden-zu-BIP, von dem an die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz signifikant ansteigt - trotz berechtigter methodischer Kritik ein bis heute viel beachteter Indikator.
Beiden Büchern gemeinsam ist die Diagnose der "drei K" als Haupttreiber steigender Verschuldung: Kriege, Krisen und Konjunktur. Auch in Deutschland lassen sich Niveau-Sprünge in der Schuldenstatistik regelmäßig auf externe Schocks zurückführen - von den beiden Ölpreiskrisen über die Deutsche Einheit bis zu Finanz-, Corona- und Ukraine-Krise. Zwischen den Schocks wird zwar konsolidiert, doch das Vorkrisenniveau wird selten wieder erreicht. Reinhart und Rogoff verweisen zudem auf die trügerische Logik eines Aufschwungs. In Hochphasen glauben viele Akteure, diesmal "sei alles anders" und man könne aus der Verschuldung "herauswachsen". Starkes Wachstum führt dann paradoxerweise zu höheren Ausgaben und noch mehr Schulden - weil alle "einen Schluck mehr aus der Pulle" wollen.
Eichengreen und Kollegen halten dagegen: Schulden seien produktiv, wenn sie Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Bildung oder Dekarbonisierung finanzieren. Nach Kriegen und Krisen müssten sie allerdings auch wieder konsequent abgebaut werden, um künftige Spielräume zu bewahren.
Die Dichotomie aus Schuldenbefürwortern und Schuldengegnern lässt sich auch in der deutschen Professorenzunft festmachen. Der Bremer Ökonom Rudolf Hickel setzt mit seiner Streitschrift "Schuldenbremse oder 'goldene Regel'?" (2024) andere Akzente. Sein keynesianisches Herz schlägt unverändert für Umverteilung, doch bringt er, im Gegensatz zu früher, noch die "sozial-ökologische Zeitenwende" in Stellung und fordert sowohl mehr soziale als auch mehr ökologische Investitionen. Hickel kritisiert, die Schuldenbremse habe die öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Gesundheitswesen gedrückt. Konkrete Zahlen liefert allerdings auch er kaum - ein Manko.
Eine einfache Auswertung der Investitionstätigkeit zeigt nämlich ein anderes Bild: Zwischen 2011 und 2023 lag die staatliche Investitionsquote in Deutschland im Schnitt bei 2,35 Prozent des BIP, gegenüber 2,17 Prozent in den zwölf Jahren vor Einführung der Schuldenbremse. Das entspricht einem relativen Plus von rund neun Prozent. Zudem sollte man die Daten auch vor dem Hintergrund der Deutschen Einheit einordnen, wo besonders hohe Investitionen getätigt wurden.
Von einer Investitionsbremse kann also keine Rede sein. Wie ist das zu erklären? Schuldenregeln, zumal wenn eingehalten, sind Signale an die Finanzmärkte für solide Staatsfinanzen. Diese honorieren dies mit tieferen Zinsen. Dadurch sinkt der Anteil der Zinsausgaben des Staates, und es bleibt mehr Geld für Investitionen übrig. Positiver Nebeneffekt solcher "Windfall Profits": Durch tiefere Zinsen können auch Unternehmen mehr investieren und Private mehr konsumieren. Schuldenregeln begrenzen den Handlungsspielraum von Regierungen - verringern aber auch die Defizitneigung, wie internationale Vergleiche zeigen. Auf der anderen Seite gewinnt der Staat wieder Handlungsspielraum.
Ein noch deutlicheres Bild zeigt die Schweiz, das Vorbild für die deutsche Schuldenbremse. Dort stieg die durchschnittliche Wachstumsrate der staatlichen Bruttoanlageinvestitionen nach Einführung der Schuldenbremse (2003) von durchschnittlich minus 0,8 Prozent (1996 bis 2002) auf plus 2,7 Prozent pro Jahr (2004 bis 2022), so die Daten des Bundesamtes für Statistik der Schweiz. Weitere Effekte durch die Schweizer Schuldenbremse waren eine deutliche Ausweitung der staatlichen Bautätigkeit, eine Haushaltskonsolidierung mit einer deutlichen Rückführung der Schuldenquote und schließlich sogar in jüngerer Zeit die Ausweitung einiger Sozialleistungen (13. AHV-Rente).
Hans-Werner Sinns Buch "Die wundersame Geldvermehrung" (2021) richtet den Fokus auf die europäische Ebene. Besonders pointiert ist seine Kritik an der dauerhaften Verletzung der Maastricht-Kriterien: Seit Einführung der Defizit- und Schuldenobergrenzen gab es (bis 2020) rund 195 Verstöße gegen die Drei-Prozent-Regel - ohne jemals verhängte Geldbußen. Beim Sechzig-Prozent-Schuldenstandskriterium ist die Bilanz noch schlechter. Für Sinn zerstört diese Straflosigkeit die Glaubwürdigkeit des Regelwerks und erhöht das Inflationsrisiko.
Zudem zeigt er, dass sich die Zentralbankgeldmenge im Euroraum von 2008 bis September 2021 von knapp einer auf rund sechs Billionen Euro fast versiebenfacht hat - Hand in Hand mit einem Anstieg der Schuldenquote von 73 auf 97 Prozent des BIP. Trifft dieses Geldüberangebot auf ein knappes Güterangebot, steigt die Inflation. Sinn liefert eine datenreiche Analyse des Zusammenhangs von Geldmenge, Staatsverschuldung und Inflation sowie der Nebenwirkungen der Negativzinsen. Seine Mahnung: Ohne glaubwürdige Regeln ist auch die europäische Integration gefährdet.
Leider sind bei diesen Analysen aus der ökonomischen Zunft die politischen und sozioökonomischen Variablen unterbelichtet. Der Blick auf Verschuldungsursachen bleibt weitgehend auf die drei "K" Kriege, Krisen, Konjunktur beschränkt. Auch Sinn startet mit dem Polykrisen-Argument. Gerade demographische Faktoren, insbesondere die Alterung der Gesellschaft, sind aber einer der Schlüssel zum Verständnis der Schuldenpolitik in modernen Demokratien, inklusive des politischen Mechanismus, der dahintersteckt. So besteht eine starke statistische Korrelation zwischen dem Anteil der Rentner und der Höhe der Schuldenquote. Sie ist einer der stärksten Verschuldungstreiber in den hoch entwickelten OECD-Ländern.
Blickt man etwa auf Deutschland und die jüngsten Zahlen der repräsentativen Wahlstatistik, wird auch deutlich, warum: Das Medianalter der SPD-Wähler lag bei der Bundestagswahl bei 63 Jahren (2013: 55,2 Jahre, 1972: 43,6 Jahre) und dasjenige der CDU-Wähler bei der Bundestagswahl bei 62 Jahren (2013: 56,1 Jahre, 1972: 48,1 Jahre). Das bedeutet, mehr als die Hälfte der Wähler der Großen Koalition ist über 62 Jahre alt, das heißt, sie sind in Rente oder haben diese in Sicht. Und die Politik handelt dementsprechend: Mütterrente für ältere Frauen eingeführt, Leistungen der Mütterrente verbessert, Rentenniveau stabilisiert bis 2031 und als Schmankerl die steuerfreie Aktivrente für Senioren.
Dies führt zum Konzept der impliziten Verschuldung, welches von Bernd Raffelhüschen in Deutschland populär vertreten wird. In der Festschrift zu seinem 65. Geburtstag (Christian Hagist und Tobias Kohlstruck (Hrsg): Fiskalische Nachhaltigkeit: Von der ökonomischen Theorie zum politischen Leitbild, 2022) werden die verschiedenen Aspekte der intergenerationalen Berechnung dieser impliziten Verschuldung behandelt. Die ungedeckten Schecks sind demnach viel größer als von vielen vermutet. Nach den Berechnungen von Raffelhüschen, im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft, liegt diese für 2024 bei 311 Prozent des BIP, zusätzlich zu den 64 Prozent der expliziten Verschuldung. Daher würde mehr Nachhaltigkeit Sinn ergeben, insbesondere bei den Staatsfinanzen. UWE WAGSCHAL
Barry Eichengreen, Asmaa El-Ganainy: In Defence of Public Debt.
Oxford University Press, Oxford 2021. 305 S., 21,99 Euro.
Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff: Dieses Mal ist alles anders: Acht Jahrhunderte Finanzkrisen.
Finanzbuch Verlag, München 2020. 528 S., 34,99 Euro.
Rodolf Hickel: Schuldenbremse oder "goldene Regel"? Verantwortungsvolle Finanzpolitik für die sozialökologische Zeitenwende.
VSA-Verlag, Hamburg 2024. 96 S., 12,- Euro.
Hans-Werner Sinn: Die wundersame Geldvermehrung: Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation.
Herder Verlag, Freiburg 2021. 432 S., 28,- Euro.
Christian Hagist, Tobias Kohlstruck (Hrsg.): Fiskalische Nachhaltigkeit: Von der ökonomischen Theorie zum politischen Leitbild.
Vahlen Verlag, München 2022. 320 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.