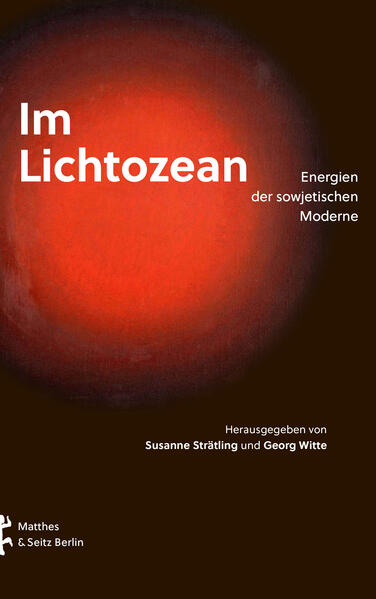Besprechung vom 15.10.2025
Besprechung vom 15.10.2025
Kommunismus unter Strom
Die unsichtbare Kraft: Eine stattliche Anthologie führt vor Augen, dass Lenins berühmte Formel, wonach Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes sei, eingebettet wurde in Visionen und Phantasien energetischer Selbstermächtigung.
Eine frühe Anerkennung für Lenins ambitionierten Plan, Sowjetrussland bis in den hintersten Winkel mit Strom zu versorgen, kam aus berufenem Mund. Der Sozialist und Science-Fiction-Autor H. G. Wells war 1920 nach Russland gereist, um sich selbst ein Bild von den revolutionären Umwälzungen zu machen. In einem Zeitungsartikel beschrieb er das "mutige Projekt" der Elektrifizierung mit einer Mischung aus Zweifel und Anerkennung: "Solche Projekte werden auch für Holland und England diskutiert, wo man sie sich als wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg vorstellen kann. Ich kann nichts davon im dunklen Kristall Russlands sehen, aber dieser kleine Mann im Kreml kann es."
In einer Parteirede vom Dezember 1920 goss Lenin seine energiepolitischen Ambitionen in die berühmte Formel: "Kommunismus - das ist Sowjetmacht plus die Elektrifizierung des ganzen Landes." Damit verband sich ein epochaler Anspruch: Die bürgerliche Aufklärung mit der dampfmaschinengetriebenen Industrialisierung sollte mit einer viel moderneren Produktion überboten werden, die auf einer unsichtbaren Kraft basierte. Die frühsowjetischen Energiephantasien beschränkten sich nicht auf die Technologie, sondern weiteten sich auch auf die menschliche Psychologie aus. Einige Autoren überschritten in ihren Visionen alle Grenzen von Zeit und Raum: Nur der Kosmos war groß genug für die menschlichen Phantasien der Selbstermächtigung, und auch der Tod markierte keine Grenze mehr für die Bewusstseinstätigkeit, die man in reine Gedankenenergie verwandeln wollte.
Susanne Strätling und Georg Witte vom Berliner Peter-Szondi-Institut haben wenig bekannte Texte aus dieser hochfliegenden Debatte in einer gewichtigen Anthologie gesammelt, sorgfältig kommentiert und mit einem luziden Nachwort versehen. Unter den Autoren finden sich prominente Namen aus Literatur, Kunst und Philosophie. Andrej Platonow baute seine berühmten Romane "Tschewengur" und "Die Baugrube" auf der Spannung zwischen Technikbegeisterung und Lebensphilosophie auf. Bereits zu Beginn der Zwanzigerjahre experimentierte der ausgebildete Elektrotechniker Platonow mit der Herstellung von Photovoltaikzellen. 1922 schrieb er den Aufsatz "Licht und Sozialismus", in dem er einem auf Kohle und Eisen fußenden Kapitalismus einen lichtbasierten Sozialismus gegenüberstellte.
Für die Umwandlung des Sonnenlichts in Strom träumte Platonow von einer Maschine, die er "photoelektromagnetischer Resonanztransformator" nannte. Platonow sagte eine "Lichtindustrie" voraus, der - in Übereinstimmung mit der marxistischen Überbaulehre - eine vollkommene kommunistische Gesellschaftsordnung folgen würde. Letztlich sollen sich die Menschen zu "einem einzigen physischen Wesen" vereinigen, das "voll von Erkenntnis, Wunder und Liebe" sei. In diesem Endzustand werde auch die traditionelle Kunst überflüssig. Die kommunistische Kunst sei "Weltraumskulptur" und "interplanetare Architektur". Die Elektrizität sei "der Schlüssel zur Erforschung des Universums und zum Sieg über dasselbe".
Auch Kasimir Malewitsch richtete sein Kunstverständnis nach dem revolutionären Fortschritt der Geschichte aus. In seiner Malerei durchlief er verschiedene Stadien - vom Impressionismus über den Kubismus bis hin zu dem, was er als Suprematismus bezeichnete. Ihm schwebte eine ultimative Kunst vor, die sich "über die Grenzen des Gegenstandsgewirrs hinaus zu einer rein energetischen Kraft der Bewegung" entwickeln sollte. In dieser Zukunftserwartung war Malewitsch nicht besonders zimperlich: 1919 schlug er ein neues Kunstmuseum vor, in dem die Asche der verbrannten klassischen Gemälde in kleinen Fläschchen wie in einer Apotheke ausgestellt werden sollte: "Die Besucher werden durch das Betrachten der Asche von Rubens-Bildern zu neuen Ideen angeregt, außerdem kann man eine Menge Platz sparen."
Natürlich hatten die Energiephantasien der frühen Sowjetzeit auch eine theologische Dimension. Die kommunistischen "Gotterbauer" hatten Feuerbachs Religionskritik ins Positive gewandt: Die Menschen würden im Arbeiter- und Bauernparadies zwar Gott nach ihrem Ebenbild schaffen, aber in einem nächsten Schritt auch wirklich an diesen künstlichen Gott glauben. Für Lenin, Atheist bis ins Knochenmark und überaus kritisch gegenüber bolschewistischen Ersatzreligionen, waren solche Konstruktionen Blendwerk, das sich von der herkömmlichen Religion so wenig unterschied wie ein blauer Teufel von einem gelben.
Zu den Trouvaillen in Strätlings und Wittes Band gehört ein Fragment des Wissenschaftsphilosophen Wassili Subow aus den frühen Zwanzigerjahren. Subow versucht in diesem spekulativen Text, die kommunistischen Energiekonzeptionen mit der orthodox-mystischen Theologie zu verbinden. Er geht von einem Gott aus, der als Energie und als Wesen existiert. Subow beeilt sich jedoch, die Einheit Gottes zu retten: "Die Energie ist nicht von Gott als zweite Gottheit oder Hypostase getrennt, aber sie ist auch nicht untrennbar vom Wesen. Sie ist - Gott selbst, wenn auch nicht Gottes Wesen. Sie ist das ungeschaffene Licht und der vorewigliche Name."
Die göttliche Doppelung von Immanenz und Transzendenz, Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit, Präsenz und Absenz bestimmt in Subows Deutung die Möglichkeit von Wissenschaft überhaupt. Ganz im Einklang mit Husserls antipsychologischer Stoßrichtung nimmt Subow die Einheit von Idee und Sein an und fordert konsequent eine Rehabilitierung des ontologischen Gottesbeweises: Wenn Gott vollkommen ist, dann gehört auch seine Existenz zu dieser Vollkommenheit.
Subows Überlegungen zu den Transformationen des göttlichen Geistes in einen menschlichen Körper und wieder zurück hätten sich zwar gut in die energetischen Heilserwartungen der frühen Sowjetzeit integrieren lassen. Allerdings wollte es eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der ehemalige Zögling des Tifliser Priesterseminars Jossif Dschugaschwili alles Theologische aus dem sowjetischen Wissenschaftsbetrieb austrieb. Unter Stalin bestimmte ausschließlich das Sein das Bewusstsein. Damit löschte der Diktator auch die Lichtspiele der frühsowjetischen Intellektuellen aus und stieß sie in die Finsternis eines dogmatischen Materialismus. ULRICH SCHMID
"Im Lichtozean". Energien der sowjetischen Moderne.
Hrsgg. v. Susanne Strätling und Georg Witte. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025. 734 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.