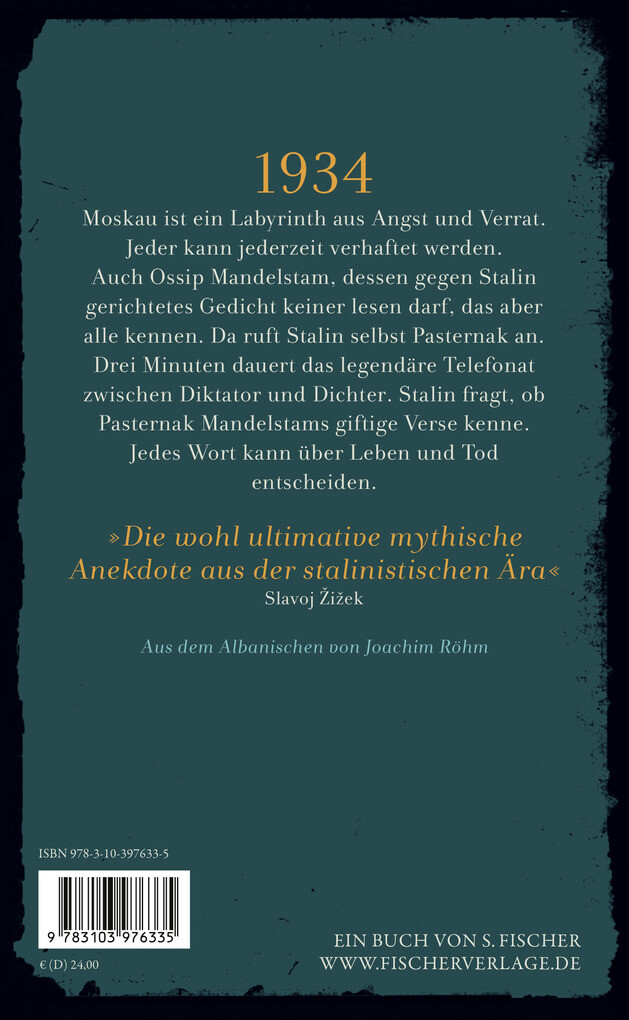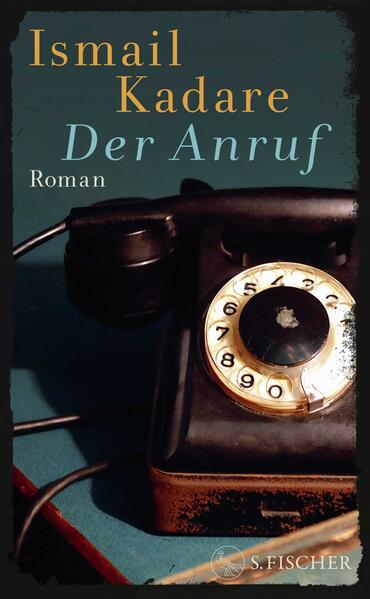
Eines der großen Rätsel des 20. Jahrhunderts und das Lebensrätsel Ismail Kadares
1934: Moskau ist ein Labyrinth aus Angst und Verrat. Jeder kann jederzeit verhaftet werden. Auch Ossip Mandelstam, dessen gegen Stalin gerichtetes Gedicht keiner lesen darf, das aber alle kennen. Da ruft Stalin selbst Pasternak an. Drei Minuten dauert das legendäre Telefonat zwischen Diktator und Dichter. Stalin fragt, ob Pasternak Mandelstams giftige Verse kenne. Ja oder nein, jede Antwort führt in eine Falle und entscheidet über Mandelstams Leben oder Tod. Bis heute ist es ein Rätsel, was Pasternak in diesen drei Minuten sagte: Warum konnte er Mandelstam nicht retten?
In Moskau geriet Ismail Kadare während des Studiums in den Bann dieser Frage. Als albanischer Schriftsteller kennt er die dunklen Schatten der Macht und die Konfrontation von Politik und Kunst. Das Telefonat, das er wie in einem Kriminalroman bis in die kleinsten Details seziert, spiegelt ihm sein Lebensrätsel wider.
»Die wohl ultimative mythische Anekdote aus der stalinistischen Ära« Slavoj Zizek
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Allen, die um die Wirkmächtigkeit lyrischer Werke wissen und bangen, sei dieses schmale Buch daher ans Herz gelegt. Katharina Tiwald, Die Presse
Ein großartiges, wunderbares, staunenswertes Buch, das einsam herausragt aus dem Berg an Neuerscheinungen. Münchner Merkur
[. . .] ein herrlich ironischer Kommentar über das Verhältnis von Dichtung und Diktatur. Welf Grombacher, Nordkurier
[ ] zeigt eindrucksvoll, dass ein Telefonat von drei Minuten ausreicht, um die Hölle der Diktatur vor Augen zu führen. Martin Oehlen, Frankfurter Rundschau
[. . .] ein geschickt verwebter Roman [. . .]. Jens Uthoff, taz
[. . .] ein ungemein informatives, schockierendes und gleichzeitig elegantes Buch [. . .] Marko Martin, Welt am Sonntag
[. . .] bewährt hervorragend übersetzt von Joachim Röhm. Ulrich Rüdenauer, Buchkultur
[. . .] ebenso fundierte wie vergnügliche Betrachtung der Stalinära [. . .]. Sein Buch erzählt von einer vergangenen Zeit und ist doch hoch aktuell. Welf Grombacher, Südkurier
[. . .] eine eindringliche Meditation über das Verhältnis von Dichtung und Diktatur [. . .]. Carlos Spoerhase, Süddeutsche Zeitung
 Besprechung vom 17.07.2025
Besprechung vom 17.07.2025
Wenn Herrscher telefonieren
Winke mit dem Zaunpfahl zwischen Diktatoren: Ismail Kadares würdiges Abschiedswerk "Der Anruf"
In Ungnade gefallen, verfemt und ausgegrenzt, bat Michail Bulgakow in einem auf den 28. März 1930 datierten Brief an die sowjetische Regierung darum, die Sowjetunion verlassen zu dürfen. Die Existenz des Briefes ist belegt. Über das, was danach passiert sein soll, schrieb Bulgakows deutsche Biographin Elsbeth Wolffheim: "Der Allgewaltige griff selbst zum Hörer und fragte den völlig überrumpelten Bulgakow ohne Umschweife: 'Vielleicht sollten wir Sie wirklich ins Ausland reisen lassen? Was ist, haben Sie genug von uns?'" Konsterniert habe Bulgakow eine Antwort gegeben, die er später oft bereut habe: Er glaube nicht, dass ein russischer Schriftsteller im Ausland leben könne. Stalin soll Bulgakow daraufhin zugesagt haben, er werde sicherstellen, dass man ihm eine Stellung am Moskauer Künstler-Theater anbiete.
So kam es. Bulgakow wurde Regieassistent. Das Gespräch soll am 18. April 1930 stattgefunden haben, vier Tage nach dem Suizid Wladimir Majakowskis. Wolffheim führt als Quelle die 2021 gestorbene russische Literaturwissenschaftlerin Marietta Tschudakowa sowie die Tagebücher von Bulgakows letzter Ehefrau Jelena Bulgakowa an. Ob das Gespräch tatsächlich so stattgefunden hat oder ob die Geschichte nur von dem florierenden Markt für Stalinanekdoten kündet - wer weiß? Es gibt jedenfalls eine ganze Reihe von Anekdoten des Typs "Stalin-ruft-Schriftsteller-an", fast ein Genre.
Der im vergangenen Jahr gestorbene albanische Schriftsteller Ismail Kadare greift in seinem letzten Werk eine Anekdote auf, die noch bekannter ist als die von Stalins Telefonat mit Bulgakow. Sein Letztling "Der Anruf" erschien auf Albanisch 2018 unter dem Titel "Wenn Herrscher streiten". Der nur gut 170 Seiten schmale Band umkreist in immer neuen Bahnen drei von knapp 37 Millionen Minuten im Leben des Boris Pasternak. So kurz soll ein legendärer Anruf Stalins bei dem späteren Nobelpreisträger gedauert haben. Kadares Ich-Erzähler, den man getrost für den Autor halten darf, hörte erstmals im Alter von 22 Jahren in der Sowjetunion davon. Damals war Kadare Student am Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau. Die Eindrücke aus dieser Zeit verarbeitete er später in seinem Roman "Die Dämmerung der Steppengötter". In "Der Anruf" kehrt er dorthin zurück. In dreizehn Kapiteln, die er "Versionen" nennt, schreibt Kadare über Hintergründe, den möglichen Verlauf und vor allem die Nachwirkung des legendären Gesprächs zwischen dem Diktator und Pasternak, das am 23. Juni 1934 stattgefunden haben soll.
"Also, wir hatten den Juni 1934, Ossip Mandelstam war kurz zuvor verhaftet worden. Ganz Moskau redete von dem Ereignis, als am dreiundzwanzigsten Tag des Monats ein Telefon klingelte. Der Anrufer war Stalin, sein Gesprächspartner hieß Pasternak", beginnt eine solche "Version", deren Kern stets der Gleiche ist: Stalin erkundigt sich bei Pasternak, was er über den kürzlich verhafteten Ossip Mandelstam zu sagen habe. Der, überrumpelt, stammelt etwas davon, dass er und Mandelstam verschiedenen literarischen Richtungen angehörten, dass er also nicht wirklich etwas über ihn sagen könne. Stalin sei erbost gewesen über die mangelnde Solidarität Pasternaks mit seinem Schriftstellerkollegen, habe über dessen Feigheit gespottet und aufgelegt.
Die autobiographischen Anklänge des Buches sind nicht zu überlesen. Es sind eigentlich eher Grüße mit dem Zaunpfahl als Anklänge. Denn natürlich schreibt Kadare, wenn er über Stalin und Bulgakow schreibt, vor allem über sich und Enver Hoxha, Albaniens Diktator von 1945 bis 1985. Pasternak erhielt den Nobelpreis 1958, durfte ihn aber nicht annehmen. Kadare galt schon zu Zeiten, als Hoxhas Diktatur noch unerschütterlich schien, über Jahre hinweg als ernsthafter Anwärter auf den Preis und hätte ihn sicherlich angenommen, erhielt ihn aber nicht. Der Preis ist ein Bindeglied zwischen den beiden Schriftstellern. "Anwärter auf den Nobelpreis zu sein bedeutete, das Stigma einer gefährlichen Seite zu tragen", schreibt Kadares Ich-Erzähler.
Kadare litt unter der albanischen Diktatur, aber er profitierte auch von ihr und zog daraus den Stoff für ein großes Werk. So variiert er in diesem Abschiedsband noch einmal sein Lebensthema von der Beziehung zwischen Dichter und Tyrann, das wahrlich unerschöpflich ist. Früher dichtete Lion Feuchtwanger Oden auf Stalin, heute lobpreist Roger Köppel Putin - noch jeder Massenmörder fand seinen Rhapsoden, und sei es einen mediokren. Im Unterschied zu durchreisenden Claqueuren aus dem Westen hatte Kadare freilich nicht nur aus sicherer Entfernung mit dem Wesen der Gewaltherrschaft zu tun. Vielleicht war es diese unfreiwillige Kenntnis des Bösen, der er exakte Sätze abrang wie den über den Dichter in einer Diktatur, der an einem politisch heiklen Roman arbeitet: "Es war, als hielte ich mir einen hübschen, aber ziemlich gefährlichen Vogel im Käfig." Die Existenz von Lektoren in Diktaturen wird als ähnlich prekär beschrieben: "Wurde ein Buch veröffentlicht und dann erst verboten, bohrte man nach: 'Wie konntest du als Lektor übersehen, was für ein Gift der Autor da angerührt hat?'" Monieren Lektoren hingegen etwas, was nur ihnen auffällt, kann das ähnlich gefährlich werden: "'Warum hast du vom Autor verlangt, jeden Hinweis auf die blinde Eifersucht und die homosexuellen Neigungen des Sultans zu streichen? Rede! Du wolltest wohl, dass der türkische Tyrann in günstigem Licht dasteht! Also, was hast du zu sagen?'"
Kadare hat sich mit diesem erzählenden Essay, dem der Verlag der deutschen Übersetzung den etwas ratlos wirkenden Untertitel "Untersuchungen" gegeben hat, würdig verabschiedet. Zu verdanken hat er das auch Joachim Röhm, seinem ebenbürtig-großartigen Übersetzer ins Deutsche. Röhm siedelte in den Siebzigerjahren in spätjugendlich-kommunistischer Wirrnis aus Westdeutschland für einige Jahre ins kommunistische Albanien über und lernte dort die Sprache. Dass er Albanisch beherrscht, darf man also voraussetzen. Dass er mit der deutschen Sprache umzugehen versteht, zeigen seine Übersetzungen. Röhms Verdienste um Kadare umfassen aber auch die Bücher, die er nicht übersetzt hat. Bei Weitem nicht alles von Kadare liegt auf Deutsch vor, und es war dem Vernehmen nach oft Röhm, der den bekanntesten Schriftsteller der Albaner vor sich selbst schützte, indem er schwächere Werke nicht übertrug. "Albanischer Frühling", Kadares bestenfalls ungelenke Rechtfertigungsschrift über seine Rolle in der Hoxha-Diktatur, ist ein Beispiel für solche missglückten Bücher. Es ist zwar auf Deutsch erhältlich, doch als Übersetzung aus dem Französischen. Röhm hat das Buch, das Kadare viel geschadet und ihn vielleicht sogar den Nobelpreis gekostet hat, dem deutschen Publikum weise vorenthalten. Dafür übertrug er große Werke wie "Der General der toten Armee", "Die Schleierkarawane" oder "Der Nachfolger" in ein souveränes Deutsch. Sofern nicht alles täuscht, werden diese Bücher noch lange gelesen werden, vielleicht bis in Zeiten, denen der Name Enver Hoxha nichts mehr sagt. Dann wäre der Anspruch eingelöst, der in dem selbstbewussten Originaltitel von Kadares letztem Buch zum Ausdruck kommt. MICHAEL MARTENS
Ismail Kadare:
"Der Anruf".
Untersuchungen.
Aus dem Albanischen von Joachim Röhm.
Verlag S. Fischer,
Frankfurt am Main 2025.
176 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.