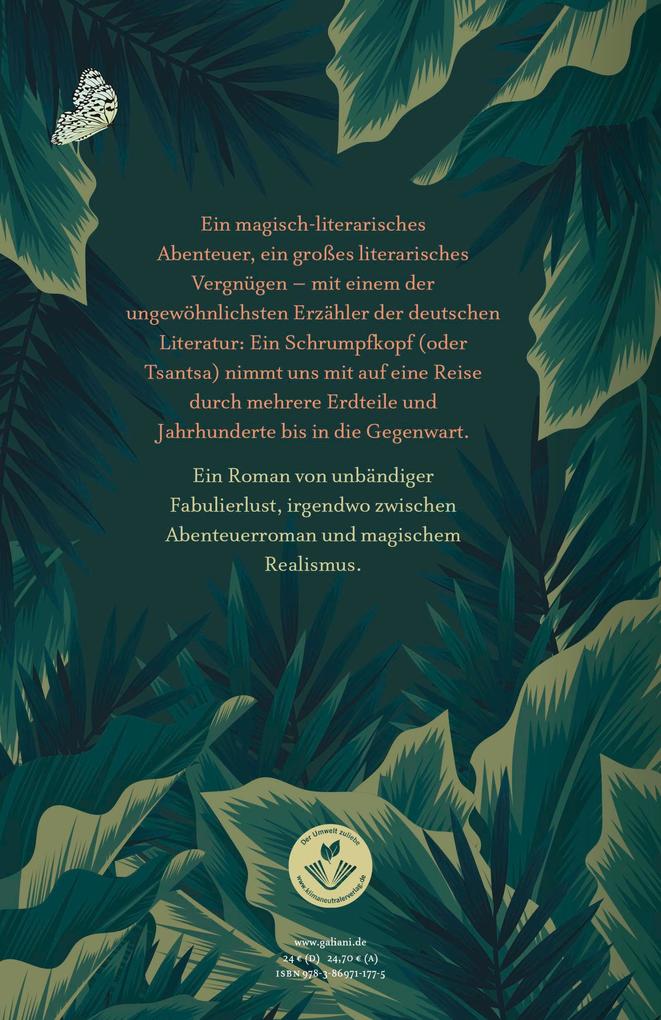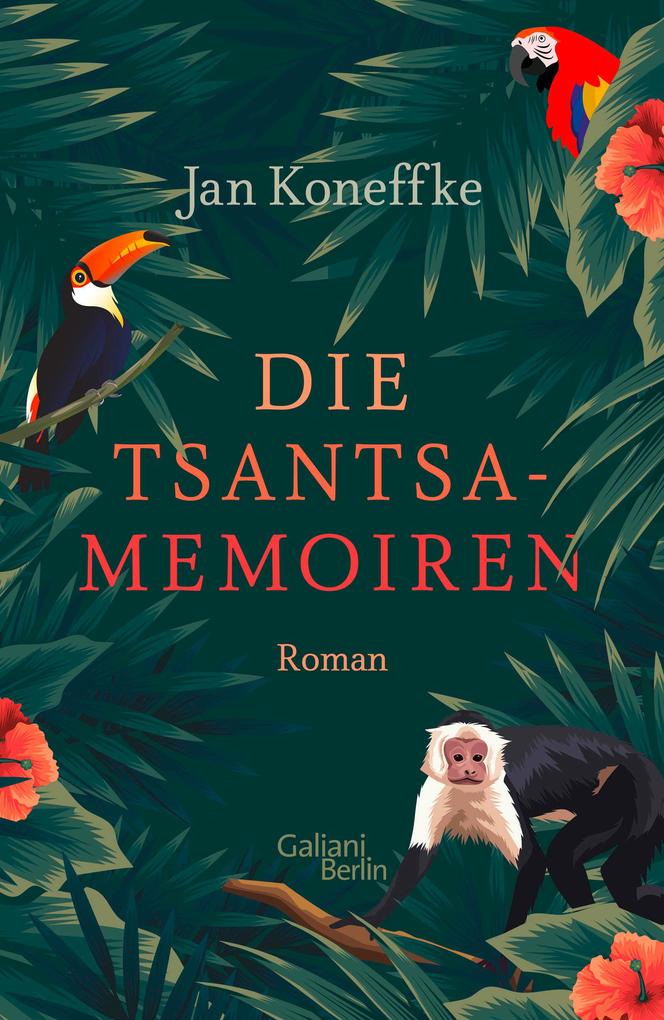
Zustellung: Mo, 19.05. - Mi, 21.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Eine Tour de Force durch zwei Jahrhunderte und zwei Kontinente - ein magisch-literarisches Abenteuer mit einem der ungewöhnlichsten Erzähler der deutschen Literatur
Was auf den ersten Blick zu schräg wirkt, um gelingen zu können, entwickelt schon nach wenigen Seiten einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann: Um das Jahr 1780 gelangt ein Schrumpfkopf in den Besitz von Don Francisco, Beamter der spanischen Krone in Caracas. Als Wandschmuck in dessen Schreibstube hängend beobachtet er das Geschehen um sich herum ganz genau - und bemerkt wie nebenbei, dass er gerade dabei ist, ein Bewusstsein zu entwickeln. Und dass er sprechen kann. Doch als er schließlich zum ersten Mal den Mund aufmacht, sorgt das bei Don Francisco prompt für einen Herzinfarkt - und der Schrumpfkopf bekommt einen neuen Besitzer. Seine Reise führt ihn in den folgenden Jahrzehnten u. a. nach Rom, Paris, Frankfurt, London, Bamberg, Bukarest, Wien und Berlin. Er wird Zeuge historischer Begebenheiten und alltäglicher Kleinigkeiten. Und nach und nach findet er immer mehr über seine eigene Vergangenheit heraus.
Dem Fabulierer Koneffke gelingt es, das Leben seines unsterblichen, aber auch hilflosen Helden auf so grandiose Weise zu erzählen, dass man das Buch am liebsten gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Dabei hilft ihm auch sein kluger und überaus gewitzter Erzähler, dessen »Menschwerdung« den roten Faden der Geschichte bildet und der einem im Laufe der Lektüre ans Herz wächst.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. September 2020
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
560
Autor/Autorin
Jan Koneffke
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
758 g
Größe (L/B/H)
221/156/51 mm
ISBN
9783869711775
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Der Begriff Multiperspektivität ist in aller Munde. Man bemüht sich. Noch nie aber hat man durch die Augen eines Schrumpfkopfs auf zwei Jahrhunderte geblickt. Susanne Lenz, Berliner Zeitung
Koneffke erzählt mit einer schier unerschöpflichen Erfindungsgabe und einer opulenten Ausmalung bizarrer Details. Man gerät immer wieder in den Sog der Sprachbegeisterung und der streckenweise ins Hochkomische tendierenden Schrumpfkopfbesessenheit des Autors. Michael Braun, Badische Zeitung
Ein bildgewaltiger Universalroman, dessen Sogwirkung man sich kaum entziehen kann. Sophie Weilandt, ORF ZIB
Ein Schrumpfkopf als Erzähler und Protagonist! Ich bin total begeistert! Von der Phantasie, den Details, der Opulenz, der Komik und der Sprache! Von allem. Ganz ganz großartig! Wer keine Angst hat vor 550 Seiten, sollte keinen Moment warten und schnell zuschlagen. Jörg Petzold, Flux FM
Jan Koneffke schickt mit feiner Komik ein koloniales Objekt auf die Reise um die Welt. Das ist groß! Erhard Schütz, Der Freitag
Eine wunderbar fabulierte Erkundung europäischer (Kolonial-)Geschichte aus der Perspektive eines fantastischen Protagonisten. Johanna Öttl, Die Presse Spectrum
Ein Buch für mehr Empathie in der Welt. Deutschlandfunk Kultur Lesart
Koneffke erzählt mit einer schier unerschöpflichen Erfindungsgabe und einer opulenten Ausmalung bizarrer Details, man gerät streckenweise immer wieder in den Sog der Sprachbegeisterung und der streckenweise ins Hochkomische tendierenden Schrumpfkopfbesessenheit des Autors. Michael Braun, DLF Kultur Lesart
Jan Koneffke zieht ein großes geschichtliches Panorama aus einzelnen, schlaglichtartigen Bildern auf. (. . .) Man sollte diesem Erzähler vertrauen und sich diese Reise nicht entgehen lassen. Peter Körte, FAS
Koneffke erzählt mit einer schier unerschöpflichen Erfindungsgabe und einer opulenten Ausmalung bizarrer Details. Man gerät immer wieder in den Sog der Sprachbegeisterung und der streckenweise ins Hochkomische tendierenden Schrumpfkopfbesessenheit des Autors. Michael Braun, Badische Zeitung
Ein bildgewaltiger Universalroman, dessen Sogwirkung man sich kaum entziehen kann. Sophie Weilandt, ORF ZIB
Ein Schrumpfkopf als Erzähler und Protagonist! Ich bin total begeistert! Von der Phantasie, den Details, der Opulenz, der Komik und der Sprache! Von allem. Ganz ganz großartig! Wer keine Angst hat vor 550 Seiten, sollte keinen Moment warten und schnell zuschlagen. Jörg Petzold, Flux FM
Jan Koneffke schickt mit feiner Komik ein koloniales Objekt auf die Reise um die Welt. Das ist groß! Erhard Schütz, Der Freitag
Eine wunderbar fabulierte Erkundung europäischer (Kolonial-)Geschichte aus der Perspektive eines fantastischen Protagonisten. Johanna Öttl, Die Presse Spectrum
Ein Buch für mehr Empathie in der Welt. Deutschlandfunk Kultur Lesart
Koneffke erzählt mit einer schier unerschöpflichen Erfindungsgabe und einer opulenten Ausmalung bizarrer Details, man gerät streckenweise immer wieder in den Sog der Sprachbegeisterung und der streckenweise ins Hochkomische tendierenden Schrumpfkopfbesessenheit des Autors. Michael Braun, DLF Kultur Lesart
Jan Koneffke zieht ein großes geschichtliches Panorama aus einzelnen, schlaglichtartigen Bildern auf. (. . .) Man sollte diesem Erzähler vertrauen und sich diese Reise nicht entgehen lassen. Peter Körte, FAS
 Besprechung vom 06.09.2020
Besprechung vom 06.09.2020
Bewusste Tote
"Die Tsantsa-Memoiren": Jan Koneffke lässt einen Schrumpkopf seine vielen Leben erzählen
An eigenartigen Erzählern, windigen, unzuverlässigen, verrückten, hat es ja seit "Tristram Shandy" noch nie gefehlt. Lars Gustafsson zum Beispiel ließ einen Bienenschwarm im Schädel eines toten Zollinspektors erzählen, was eine hübsche, postmoderne Variante war, "Die dritte Rochade des Bernard Foy" aber doch nur mäßig beeinflusste. Bei Jan Koneffke geht es nun noch abgedrehter zu: In den "Tsantsa-Memoiren" ist ein Schrumpfkopf nicht einfach der Erzähler; im Gegensatz zu Gustafssons Bienenschwarm erzählt er seine eigene Geschichte. Sie umfasst, grob gerechnet, weit mehr als vierhundert Jahre und, genau genommen, die 240, in denen dieser Schrumpfkopf über Sprache und Bewusstsein verfügt.
"Tsantsa" ist kein Eigenname, sondern der indigene Begriff für den Schrumpfkopf, der im Laufe der Geschichte zwar verschiedene Namen von seinen wechselnden Besitzern erhält, von denen jedoch nie einer haften bleibt. Dass ein Tsantsa sprechen kann, das hätten nicht mal jene südamerikanischen indigenen Völker angenommen, die nach komplizierten, genauestens zu befolgenden technischen und rituellen Regeln aus den Köpfen besiegter Feinde Schrumpfköpfe herstellten.
Koneffke muss diese Prozedur nicht erläutern, man kann sie bei Wikipedia nachlesen; er muss auch nicht erklären, wie einer ohne Stimmbänder sprechen soll oder wie es zu einer Bewusstwerdung kommen kann, wenn die richtige Hardware, das Hirn, fehlt. Nicht mal hartnäckige Cartesianer, die die Vermittlung von Leib und Seele in der Zirbeldrüse suchten, würden wohl ein Cogito ganz ohne lebendiges materielles Substrat behaupten.
Die Literatur kann das allerdings schon, sie nimmt gewissermaßen auf den ersten Seiten einen Kredit auf beim Leser, um dann im Verlaufe eines Romans die Hypothek mit Zins und Tilgung abzutragen - oder etwas schuldig zu bleiben. Jan Koneffke, der in diesem November sechzig Jahre alt wird, ist ein Autor, der bisher selten in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Seine Art zu erzählen nennen Kritiker gerne etwas blumig "fabulieren", weil die Geschichten sich von selbst fortzuspinnen scheinen, weil er nicht müde wird, anschaulich, detailreich, präzise fremde Orte, eigenartige Farben und Gerüche, merkwürdige Bräuche, seltsame Charaktere, Gewohnheiten und Idiosynkrasien zu schildern. Es ist ein eher traditionelles Erzählen, aber wenige beherrschen es noch, so dass es schon wieder zu einer eigenen Farbe wird.
Ein Autor mit diesen Möglichkeiten kann eben auch den Schrumpfkopf eines weißen Mannes, der unter die Indigenen gefallen sein muss, erzählen lassen und einen einladen, ihn auf mehr als fünfhundert Seiten zu begleiten. Nicht mal den Gang zum Analytiker muss er scheuen, dieser Tsantsa, um bei einem Dr. Elias Lew Abraham im Wien des Jahres 1901 sein "Vor-Ich" zu entdecken, das Freuds psychischem Apparat eine weitere Instanz hinzufügt. Wenn dieses "Vor-Ich", über das hier nur gesagt werden soll, dass es Simon heißt, zum Vorschein kommt, sind schon mehr als 350 Seiten vorüber, und ein ziemlich abenteuerlicher Weg - oder sollte man doch "Leben" sagen? - hat den Tsantsa von Caracas nach Europa, über Rom, Bamberg, Frankfurt und London bis nach Wien geführt.
Oft hat er den Besitzer gewechselt, nur wenige haben seine besonderen Talente zu würdigen gewusst: das fotografische Gedächtnis, die Sprachbegabung, die Tauglichkeit zur Zirkusattraktion, selbst die Eignung zum Spion, der, scheinbar tot und schweigend an seinem Band baumelnd, alles hört, was seinem Besitzer nützlich sein kann. Nicht zu vergessen seine rhetorischen Fertigkeiten, die er für einen der Revolutionäre von 1848 einsetzt, wenn er in der Paulskirche spricht; oder die mathematischen Fähigkeiten, die viel, viel später, nach der Wende 1989, einen Ossi-Bohèmien zum Börsengenie machen. Aber auch die dunklen Phasen gehören zur Tsantsa-Existenz. Die Zeit als Eigentum eines hohen Nazis, der ihn zum Inbild des unsterblichen Ariers stilisieren will. Oder die Zeit in Kästen, auf Speichern oder in den Kellern der Stasi, wo er fast dreißig Jahre verbringen muss, bis er 1989 durch einen Zufall befreit wird.
Jan Koneffke zieht auf diese Weise ein großes geschichtliches Panorama aus einzelnen, schlaglichtartigen Bildern auf; zwischen 1780, dem Zeitpunkt der Bewusstwerdung des Schrumpfkopfs, und 2020, der Gegenwart, die dem Tsantsa nicht mehr viel zu bieten hat. In Momentaufnahmen wird jeweils eine Epoche sichtbar, in ihren Eigenheiten, Vorurteilen, ihren Signaturen, die sich auch darin zeigen, wie sie mit diesem Artefakt indigener Kultur umgehen. Zugleich wird aber spürbar, dass es kein reiner Spaß ist, mit dieser speziellen Art von Unsterblichkeit geschlagen zu sein. Für den Tsantsa geht es immer weiter, während vertraute Personen und Welten verschwinden, er muss verharren in der paradoxen Rolle eines Überlebenden, der schon vor Jahrhunderten aufgehört hat, als sterblicher Körper zu existieren.
Koneffkes Erzählweise ist in ihrer verschwenderischen Detailfülle nie langweilig, er ist historisch genau, soweit sich das ohne nähere Prüfung feststellen lässt, er hat den langen Atem für ein solches Projekt. Die Vogelperspektive des Tsantsa, der, an seiner Schnur hängend, oft auf Menschen und Dinge herabblickt, ohne selber als lebendes Wesen wahrgenommen zu werden, lässt ihn vieles anders sehen und hören. Und sogar vielfältige Phantomschmerzen spüren. Dass er weder essen noch Sex haben kann, bedeutet nicht, dass da nicht der Hunger nach beidem sich regte - und irgendwie auch gestillt werden muss. Zum Ausgleich für fehlende Gliedmaßen und die fünf Sinne nimmt er Gerüche als Farben wahr.
Es gibt allerdings ein kleines Problem in dieser Opulenz der Darstellung: Dass der Tsantsa mehr oder minder immer mit der gleichen Stimme spricht, im gleichen Ton, abgesehen von den eingeschobenen Protokollen des Analytikers und den Tagebucheinträgen einer besonders geschätzten Besitzerin. Da sind zwar hin und wieder Modulationen, mundartliche Passagen, auch älteres Deutsch, aber der Grundton, der Basso continuo, das ist die Stimme des Erzählers Jan Koneffke, wie man sie noch aus vielen Passagen im letzten Roman "Ein Sonntagskind" (2015) im Ohr hat. Und es passt eben nicht so ganz, wenn der Tsantsa, der vom Blauara im Schreibzimmer des Don Francisco um 1780 sprechen lernt, in fast demselben Tonfall spricht wie der Börsenstar der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts.
Koneffke hat dieses Dilemma eher pragmatisch gelöst. Er hat mit Sicherheit gesehen, dass der Tsantsa nicht im Ton des ausgehenden 18. Jahrhunderts von all den späteren Epochen erzählen kann. Das wäre forciert und maniriert geworden. Aber er hätte auch nicht in der Prosa von heute, der Zeit, in der er seine Memoiren schreibt, Rom um 1820 oder Wien am Vorabend des Ersten Weltkriegs schildern können. Auch das hätte schief geklungen. Jan Koneffkes Lösung führt manchmal zu kleinen Stolperstellen. Aber sie schmälern nicht den Mut, einen derart großen historischen Bogen ausgerechnet von einem Schrumpfkopf schlagen zu lassen. Man sollte diesem Erzähler vertrauen und sich diese Reise nicht entgehen lassen.
PETER KÖRTE
Jan Koneffke: "Die Tsantsa-Memoiren". Roman. Galiani Berlin, 560 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 27.11.2022
Nach der letzen Lektüre, der Dystopie von Huxley brauchte ich eine witzige Lektüre. Da kam mir Kaneffkas Roman in den Sinn, die Geschichte um einen Schrumpfkopf welche schon ein ganzes Jahr auf meinem SuB schlummert.Tsantsa so nennen Eingeborene Schrumpfköpfe, aus der Kopfhaut gefertigte Präparate von getöteten Kriegern. Sie glaubten dass die Macht der getöteten auf den Besitzer des Tsantsas übergehe. Klingt jetzt wahrlich nicht so witzig aber der daraus gestaltete Roman ist es.Die Geschichte startet in Venezuela um 1780 und man erfährt bald: der Tsantsa um den es geht kann sprechen und nicht nur das: er fühlt und entwickelt zunehmends menschliche Bedürfnisse und es wird herrlich bunt aus der Ich-Perspektive des Tsantsas erzählt.Erst ohne Namen, später als Pewee gerät er in die Hände von verschiedenen Besitzern nach Italien, Deutschland England, Österreich. Zwischendurch findet er sich auch wieder in einem Antiquitätenladen verstaubend oder irgendwo in einer Museums-Vitrine schmollend und stetig sich fragend: wann soll ich mich wieder bemerkbar machen? Denn öfters sind die Besitzer nicht gerade das gelbe vom Ei, sprich übelgelaunt oder gar bösartig im Benehmen.Der Plot geht via ersten und zweiten Weltkrieg bis ins Heute und ist ein herrliches Lesevergnügen mit viel Humor und köstlichen Dialogen.
am 17.05.2021
Ein Tsantsa reist durch die Geschichte
Die Serie reißt nicht ab, denn auch dieses Buch gefällt mir nicht vollkommen. Die Tsantsa-Memoiren ist ein etwas langatmiger, aber auch interessanter Trip durch die Geschichte mit einer außergewöhnlichen Hauptfigur.
Dennoch wirkt diese Hauptfigur, trotz ihrer Exklusivität und Monströsität, recht langweilig. Eigentlich ist diese Geschichte eine gute Idee, deren Außergewöhnlichkeit aber in meinen Augen verspielt wurde. Denn irgendwie frage ich mich: Warum wird mir diese Geschichte erzählt? Ein sprechender und denkender Tsantsa, ja, und ...??? Wenn dies ein Locken sein soll, so hat das ja bei mir funktioniert, aber mit welchem Versprechen? Ein Versprechen einer packenden Handlung? Nicht wirklich. Der Tsantsa ermöglicht eine weitreichende Darstellung geschichtlicher Fakten, ja, aber das hätte anders auch geschafft werden können und dann vielleicht auch stimmiger. Dann, wenn ein Tsantsa schon zu Worte kommt, sollte auch seine Herkunft stimmig und richtig erläutert werden. Venezuela und Ekuador liegen doch recht weit auseinander, denn der Begriff Tsantsa verortet die Herkunft dieses Kopfes ja. Das ist etwas, was mich sehr gestört hat. Vielleicht, weil ich mir hier gerade mehr Inhalt zu dieser Thematik gewünscht habe. Stoff für einen weiteren Teil? Bitte nicht!
Einen Fokus zu setzen auf ein etwas enger gewähltes Areal hätte diesem Buch sicher besser getan, es etwas zentriert. Dennoch sind die geschichtlichen Fakten interessant und ein buntes Kaleidoskop und auch gut zu lesen. Aber für 4 Punkte reicht die Gesamtgestaltung in meinen Augen hier leider nicht. Was wirklich schade ist, denn die Idee finde ich wirklich grandios!