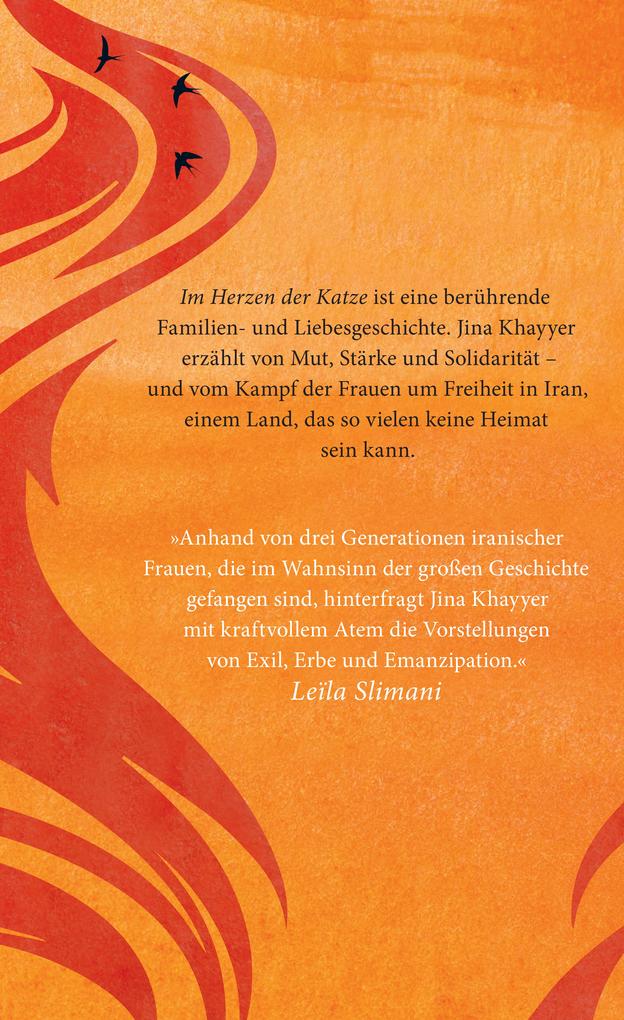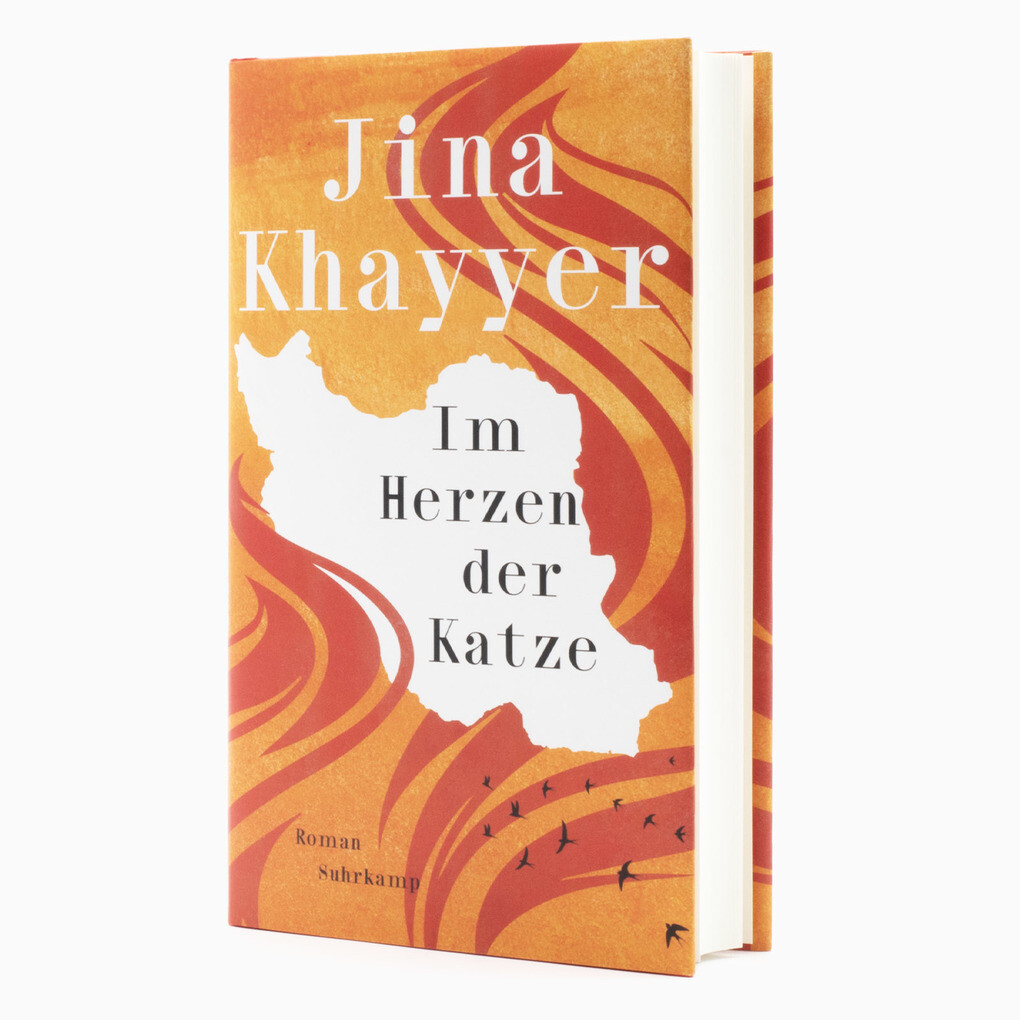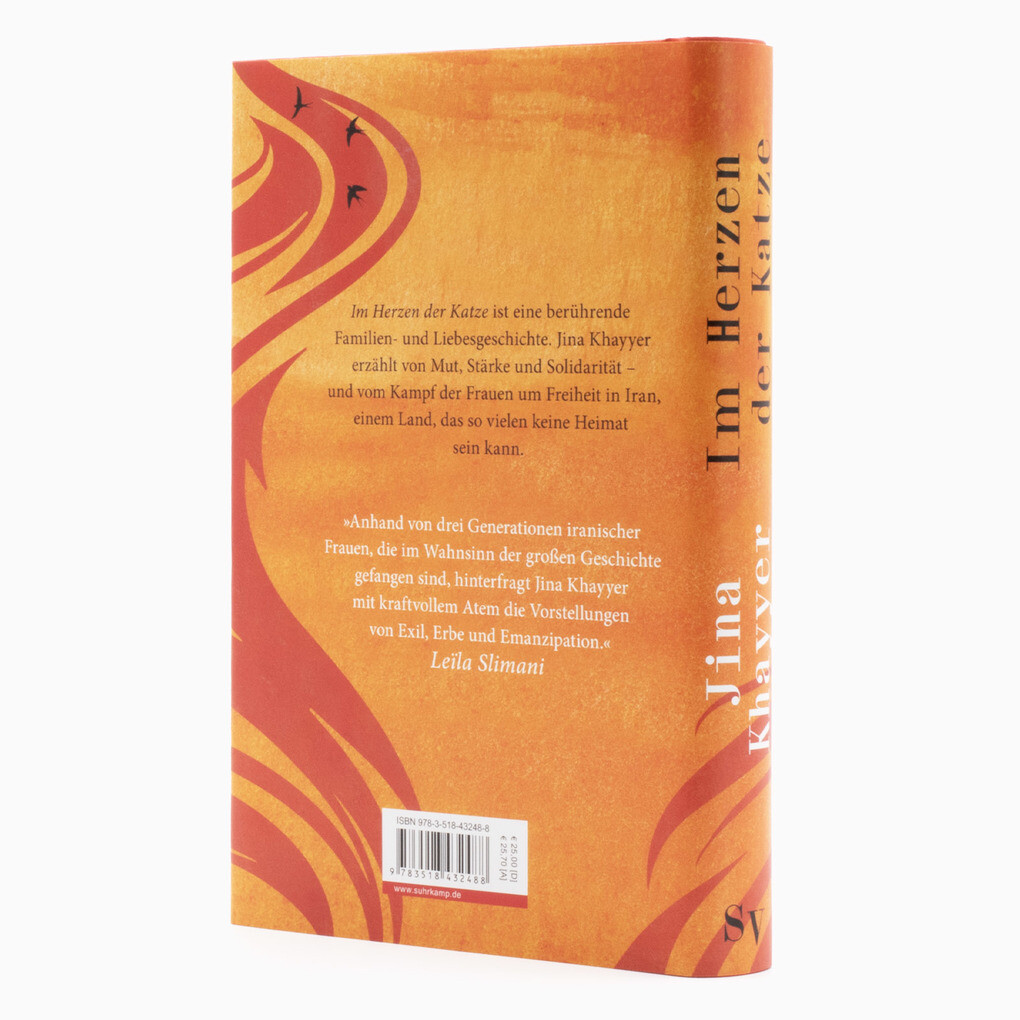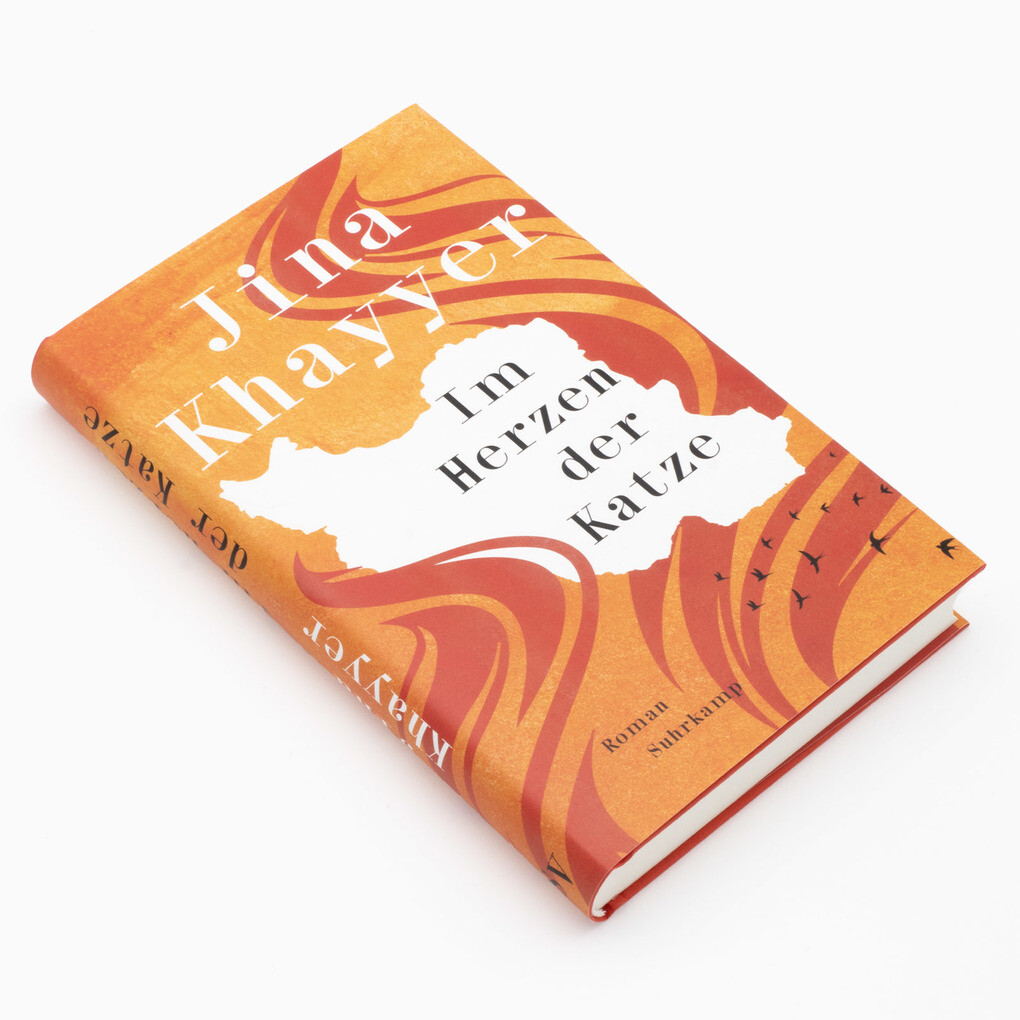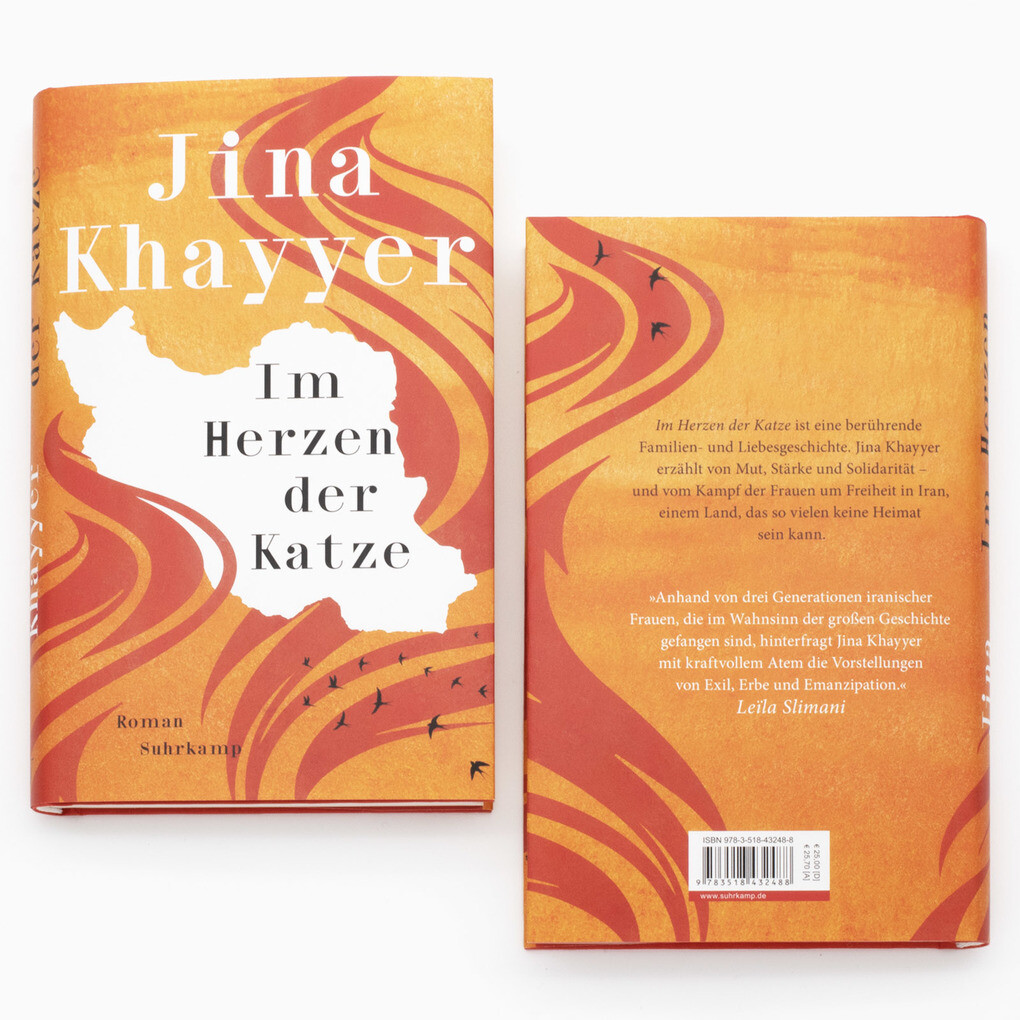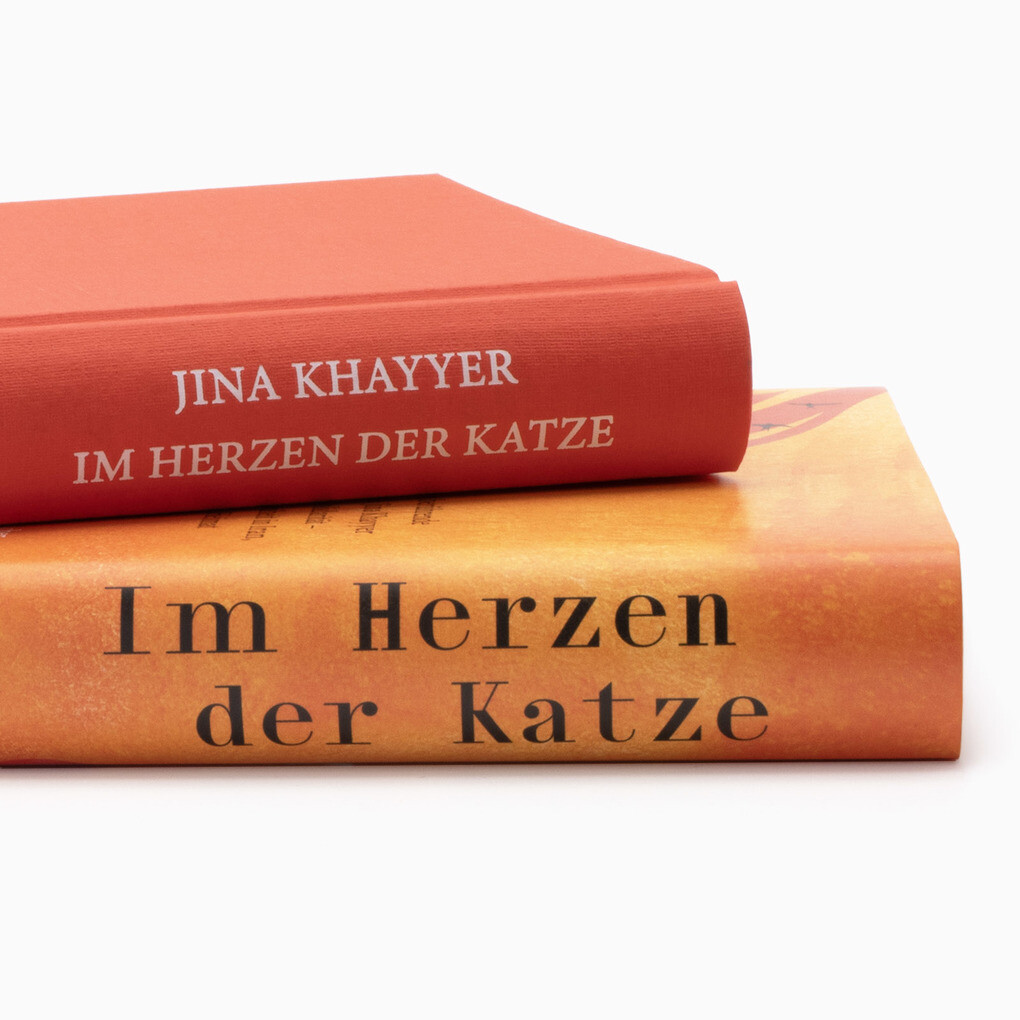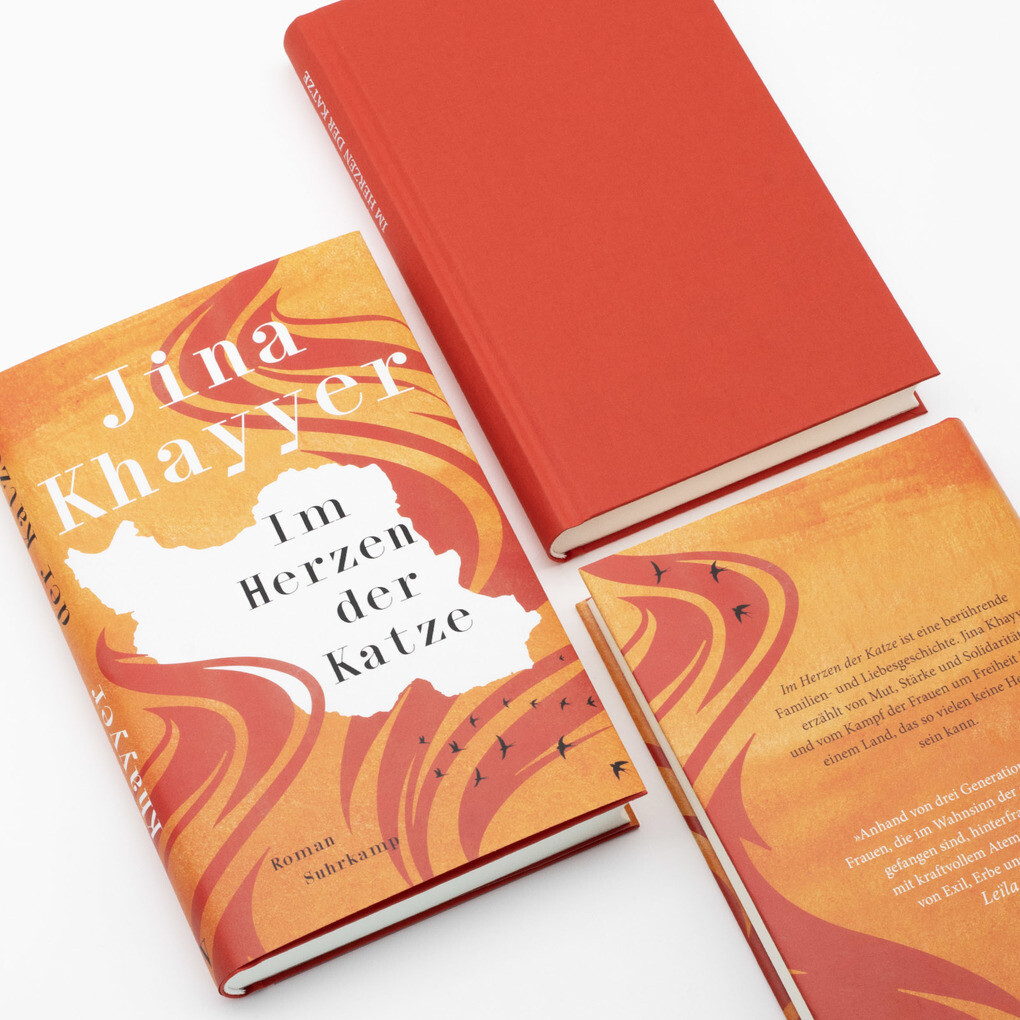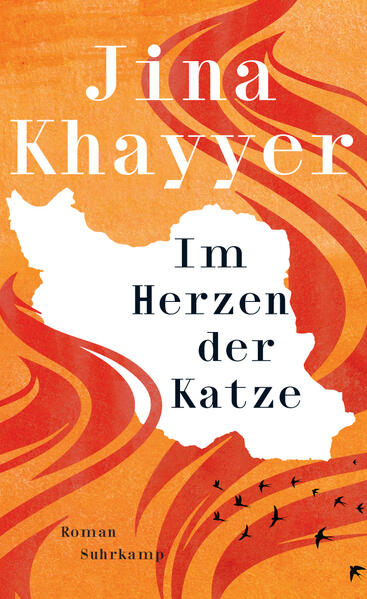
Es ist Nacht in Südfrankreich. Jina sitzt an ihrem Schreibtisch, das Telefon in der Hand. Im Sekundentakt aktualisiert sich ihr Instagram-Feed. Sie liest: »Jina Mahsa Amini wurde in Teheran von der Sittenpolizei ins Koma geprügelt. « Im nächsten Moment begreift sie: Die junge Frau, die so heißt wie sie, ist tot. Im Feed folgen die Bilder: der Protestzug Tausender Menschen auf den Straßen, Mädchen und Frauen, die ihre Haare unverdeckt tragen, darunter auch Jinas Schwester Roya und ihre Nichte Nika.
Was als Versuch beginnt, die Gegenwart zu begreifen, wird zur Reise in die Vergangenheit. Denn die Ereignisse wecken in Jina Erinnerungen an ihre eigenen Aufenthalte im Iran: an die Gastfreundschaft der Menschen, den reich gedeckten Tisch der Tanten, die Begegnungen im Sammeltaxi, den Roadtrip zu Zarathustras Feuertempel in Yazd - und an eine geheime Liebe. Aber auch an die Proteste während der Grünen Bewegung 2009, an denen Jina teilnahm und die zur einschneidenden Lebenserfahrung wurden.
Im Herzen der Katze ist eine Familien- und Liebesgeschichte, die Vorstellungen von Nationalität und Zugehörigkeit, von Frausein und Freiheit hinterfragt. Mit poetischer Intensität erzählt Jina Khayyer von Mut, Solidarität und Verantwortung und vom Nachklingen einer Heimat, die sich nicht abschütteln lässt.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»[Im Herzen der Katze] ist ein eindrücklicher und poetischer Blick in eine Gesellschaft, die durch ein Regime ihre Freiheit verloren hat. « Louise Otterbein, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Ein sehr aktuelles Buch, poetisch und politisch, ein großes Lesevergnügen, das uns dem fremden Land näher bringt. « Hanne Schatzer, Der Tagesspiegel
»Jina Khayyers autofiktionaler Roman Im Herzen der Katze kommt nun gerade zur rechten Zeit, um einiges geradezurücken. « Susan Vahabzadeh, Süddeutsche Zeitung
» eine Hommage an die Revolution im Iran und ein spätes, umso bemerkenswerteres Romandebüt. « Daniel Graf, Republik
»Ein sehr aktuelles Buch, poetisch und politisch, ein großes Lesevergnügen . . . « Der Tagesspiegel
»Mit diesem Debüt . . . legt Khayyer eine berührende Autofiktion vor. « Cynthia Cornelius, WELT AM SONNTAG
»Mit poetischer Intensität erzählt Jina Khayyer von Mut, Solidarität und Verantwortung und vom Nachklingen einer Heimat, die sich nicht abschütteln lässt. « hr2-Kultur
»[Der] Roman gibt bedrückende Innenansichten aus Iran und erzählt von der Sehnsucht junger Frauen nach Selbstbestimmung. . . . [Khayyers] Buch trägt mehr zum Verstehen iranischer Verhältnisse bei als viele politische Kommentare. « Karin Großmann, Sächsische Zeitung
»Ein brutaler und poetischer Roman und ein melodisch vorgetragenes Hörbuch. « bremen zwei
»Ein aufregendes Romandebüt: Der Iran, eine ferneWelt und so aktuell. « NDR
»[Eine] bewegende Reise in [Khayyers] Familiengeschichte und die Beziehung zu ihrer Heimat Iran. « Harper's Bazaar
 Besprechung vom 30.08.2025
Besprechung vom 30.08.2025
Vom Fisch bis zum Mond
Jina Khayyer erzählt in ihrem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman "Im Herzen der Katze" von Iran und dessen Frauen.
Dieses Mal ist alles anders, sagt Jinas Schwester. Dieses Mal stehen alle zusammen, "Alte, Junge, Mädchen, Jungen, Frauen, Männer". Dieses Mal bringen sie sie zu Fall. Es ist September 2022 in Iran. Die junge kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini ist tot, und die Menschen gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Die Ich-Erzählerin, die den gleichen Vornamen wie die Tote trägt, sitzt in Südfrankreich an ihrem Schreibtisch und scrollt durch die sozialen Medien, gebannt von der Flut an Videos und Fotos von den Protesten in Teheran. Gleichzeitig ist ihre Schwester Roya genau dort auf der Straße und kämpft für die Freiheit der Frauen.
Der autofiktionale Roman von Jina Khayyer, einer in Deutschland geborenen Journalistin und Autorin iranischer Abstammung, liest sich als Hommage an die iranischen Frauen. "Im Herzen der Katze" ist Khayyers Romandebüt, mit dem sie es gleich auf die diesjährige Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Zu Recht, denn das Buch ist ein eindrücklicher und poetischer Blick in eine Gesellschaft, die durch ein Regime ihre Freiheit verloren hat.
Die Erzählung beginnt zum Zeitpunkt der Proteste, die die Ich-Erzählerin Jina von Europa aus verfolgt. Sie fühlt sich wie eingefroren. Ihre Gedanken wandern 22 Jahre zurück, als sie das erste Mal in Iran war, um ihre Schwester zu besuchen, die in den Neunzigerjahren aus Deutschland zurück nach Iran gegangen war. Damals hatte es Aussicht auf einen Wandel gegeben. Für Jina wird diese Zeit in Iran eine Reise zu ihren Wurzeln, die sie verwirrt und berührt. Sie versucht, sich selbst zu verorten: in dem, was sie sieht und erlebt. Sie steht zwischen Identitäten und Kulturen. Mit Blick auf die Iranerinnen bemerkt sie: "Für einen Augenblick kommt es mir irre vor, dass ich überhaupt ihre Sprache verstehe, dass ich dieselbe Sprache spreche, dass ich hier genauso eine Fremde bin, wie ich hierhergehöre."
Khayyer schafft es, die Suche ihrer Protagonistin durch kulturelle Referenzen zu markieren. So erkennt Jina in den Menschen, die sie trifft, westliche Figuren: von Hildegard Knef über Patti Smith bis zum Meister Eder aus "Pumuckl". Sie denkt über den persischen Dichter Hafis und seinen Einfluss auf Goethe nach. Und dann sind da auch verbindende Überschneidungen: ihre Tante Esmat, die Virginia Woolf liebt, Iman, die sich auf Nietzsche bezieht.
Jina begegnet ihrer Familie, ihren Tanten, in deren Gesichtern sie ihren Vater erkennt, und ihrer Nichte Nika. Sie trifft viele Menschen auf dieser Reise, Männer und Frauen, deren Leben durch das Mullah-Regime eingeschränkt ist. Das Kostbarste in Iran sei das, was fehlt. Die einzige Freiheit, die sie noch haben, sagt ein Mädchen der Erzählerin, sei, gemeinsam mit Männern im Sammeltaxi zu fahren, während sie überall sonst getrennt sind.
Jinas Schwager stellt im Keller heimlich Wein her, die Freundinnen von Roya treffen sich in Buchhandlungen, die Frauen werfen ihre Kopftücher ab, sobald sie im Schutz der Privatsphäre sind. Sie wollen die Freiheiten erleben, die ihre Mütter unter dem Schah schon einmal hatten, als sie nach westlichen Standards lebten, in der Öffentlichkeit kurze Röcke trugen, hohe Schuhe und die Haare offen, bevor die Regierung gestürzt wurde. So erzählt auch Jinas Tante Esmat von den frühen Siebzigerjahren als "Blütezeit" der Frauen: "Wir waren Dozentinnen, Medizinerinnen, Juristinnen, Politikerinnen, sogar unsere Bildungsministerin war eine Frau." Es gab ein Iran, in dem die Frauen frei waren, in dem "Pluralismus wie nie zuvor und nie danach" herrschte.
Und jetzt? Ein Leben im Versteckten, die ständige Gefahr aufzufliegen. Dann reist Jina auch noch mit ihrer Schwester nach Persepolis und flirtet mit dem Fremdenführer, der sich als Frau entpuppt. Gibt es in Farsi überhaupt ein Wort für "lesbisch"? Etwas, das so verboten ist, hat auch keinen Namen, erklärt Jinas Schwester.
Der Leser lernt in diesem Roman viel über Iran und dessen Frauen, über den Feminismus im Land. Über die Frauen und ihre Geschichten führt die Autorin den Leser an die iranische Geschichte, Kultur und Gesellschaft heran. Ihre Sprache trägt maßgeblich dazu bei. Khayyer überträgt immer wieder, besonders in der ersten Hälfte der Erzählung, die Poesie der persischen Sprache ins Deutsche und zeigt dadurch, wie bildhaft Farsi funktioniert. So gibt es hundert verschiedene Arten, Danke zu sagen, denkt die Erzählerin und spult in ihrem Kopf jene ab, die sie kennt. "Mögen deine Hände nicht schmerzen. Deine Augen sind hell. Du allein siehst die Schönheit leuchten. Deine Zunge ist in Liebe getaucht. Dein warmes Herz wärmt das meine. Du bist selbst eine Blume. Mein Leben ist dein Leben."
Immer wieder lässt Khayyer die ins Deutsche übertragenen Ausdrücke aber auch ohne Erklärung stehen. Sie traut dem Leser zu, die Bilder zu verstehen. So sagt Jinas Mutter am Telefon: "Ich liebe dich vom Fisch bis zum Mond." Durch diesen sprachlichen Kniff erzeugt Khayyer eine Brücke zwischen den Sprachkulturen, die die interkulturelle Position der Protagonistin betont. Mal wirkt das ein bisschen holprig, doch meistens funktioniert es, gerade durch kurzzeitige Verwirrung beim Leser. LOUISE OTTERBEIN
Jina Khayyer: "Im Herzen der Katze". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 253 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.