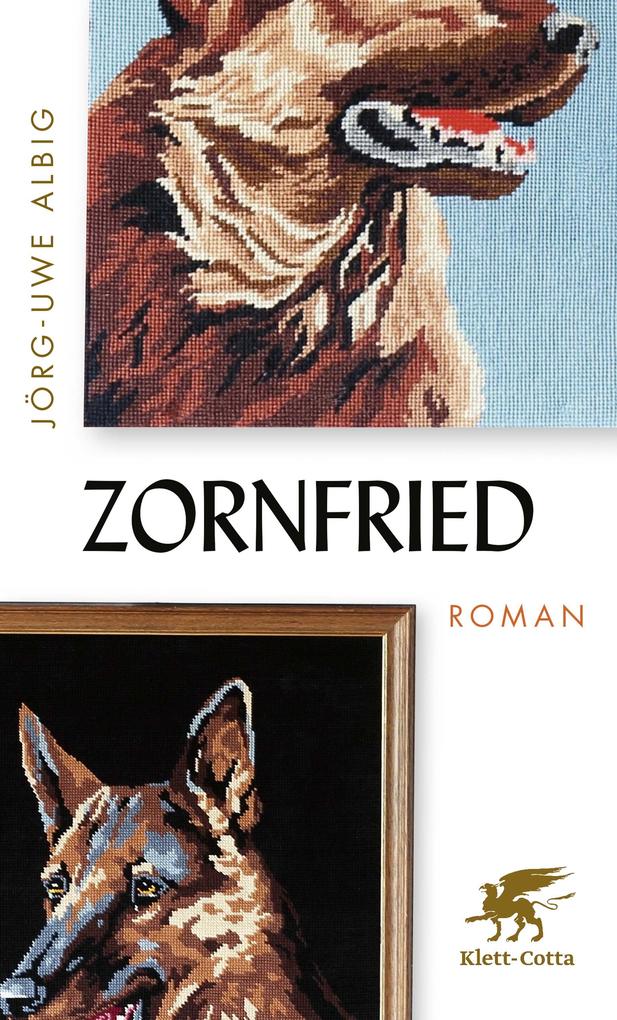
Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Tief im Spessart liegt die Burg Zornfried. Dort versammeln sich die Vordenker einer Neuen Rechten: ein Dichter, dessen Texte von Blut und Weihe triefen, ein völkisch philosophierender Waldgänger, ein Filmemacher, der sich als böses Genie inszeniert, und eine Gruppe kämpferischer junger Männer. Von der Aussicht auf eine spektakuläre Reportage werden jedoch auch immer wieder Journalisten angelockt - die sich bisweilen gefährlich weit auf das Spiel der Burgbewohner einlassen.
Jan Brock ist freier Reporter und schreibt für das Feuilleton der Frankfurter Nachrichten. Er sieht sich als Rebellen, kennt aber im Grunde nur ein Prinzip: Was es gibt, darüber muss man schreiben. Im Internet stößt er auf die schwülstigen Texte des rechten Dichters Storm Linné, die ihn gleichzeitig abstoßen und faszinieren. Als er erfährt, dass Linné mit anderen Vordenkern der Neuen Rechten auf einem tief im Wald verborgenen Rittergut names Zornfried lebt, macht er sich auf zu einer Reportagereise. Doch zwischen Schrumpfköpfen, Militariasammlungen, Kampfübungen, weihevollen Tafelrunden und Predigten über die Hierarchien des artenreinen deutschen Waldes verwischen zunehmend die Grenzen zwischen teilnehmender Beobachtung und beobachtender Teilnahme.
Jörg-Uwe Albig legt eine Satire über die neurechten Bewegungen unserer Gegenwart vor - und über die Medien, die deren Treiben mit sensationsfreudigem Eifer begleiten.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. Februar 2019
Sprache
deutsch
Auflage
2. Druckaufl. 2019
Seitenanzahl
159
Autor/Autorin
Jörg-Uwe Albig
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Produktart
gebunden
Gewicht
230 g
Größe (L/B/H)
195/118/20 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag
ISBN
9783608964257
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein kurzer, aber komplexer Roman, der die Leserschaft irritiert zurücklässt. Absolut lesenswert! «Rainer Glas, lesenswert. net, 03. 07. 2019 Rainer Glas, lesenswert. net
»[Ein] ungemein raffinierter Roman [. . .] "Zornfired" - ein großartig blödsinniger Name - ist ein sanft daherkommendes Buch von gro0ßer Härte Das macht die adäquate Sprache, die Albig zur Verfügung steht, und die alles erfassen kann und alles vorführt, ohne es einzuebnen oder zu bagatellisieren. Über Strom Linnés Gedichte zu lachen, heißt nicht, ihre Leser nicht zu fürchten. «Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 22. /23. 06. 2019 Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
»Es ist ein Buch, das sich auf kluge Weise mit einem aktuellen Thema befasst, mit dem Aufstieg der neuen Rechten, [. . .] mit der Frage, wie weit man sich auf eine Sache, über die man berichtet, einlassen muss und wo die Grenzen zwischen Beobachtung und Teilnahme liegt. Ein Roman, der nachdenklich macht«Peter Zimmermann, Ö1 - Ex libris, 16. 06. 2019 Peter Zimmermann, Ex Libris
»Albigs Roman ist einer der wichtigsten dieses Frühjahrs. Und dazu richtig gute Literatur. «Jochen Schimmang, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06. 06. 2019 Jochen Schimmang, FAZ
»Albig macht sich lustig über einen Journalismus, der einen riskanten "walk on the wilde side" verspricht, aber dann doch nur die Erwartungen seines Publikums bedient. [. . .] Jörg-Uwe Albig verharmlost die rechten Brandstifter nicht. Mit seiner "Zornfried"-Lyrik spielt er virtuos mit dem Feuer. «Martin Halter, Berliner Zeitung, 01. /02. 06. 2019 Martin Halter, Berliner Zeitung
»Jörg-Uwe Albig ist mit dem schmalen Band eine glänzende Satire voller Querverweise und Anspielungen mit hohem Wiedererkennungswert gelungen, die einerseits irrwitzig komisch ist - Albig zeichnet auch für Linées Lyrik und ihren eigentümlichen Sound (laut lesen!) verantwortlich -, andererseits die Mischung aus Faszination und Angstlust der Medien beim Blick auf die neue Rechte und die Selbstzufriedenheit des Justemilieu unbehaglich hellsichtig aufs Korn nimmt. Take a walk on the wald side! «Ulrich Kriest, Konkret, Mai 2019 Ulrich Kriest, Konkret
»Die Ernsthaftigkeit, mit der Albig in den Gedichten Linnés sein parodistisches Handwerk betreibt, ist beispielhaft für den satirischen Ernst des gesamten Romans. Zornfried ist deshalb ein fast uneingeschränkter Lektüregenuss, weil der komische Stoff in einer eleganten Prosa erzählt wird. «Johannes Franzen, Zeit Online, 02. 04. 2019 Johannes Franzen, Die Zeit Online
»Jörg-Uwe Albigs Roman trifft mitten hinein in die Debatte über Reichsbürger und AfD, die dadurch erst groß gemacht werden, dass die Medien sie so oft thematisieren. «Welf Grombacher, Freie Presse, 15. 03. 2019 Welf Grombacher, Freie Presse
»[. . .] nicht nur amüsant, sondern auch erhellend [. . .]«Mladen Gladic, der Freitag, 14. 03. 2019 Mladen Gladic, der Freitag
»Nicht mehr unterscheiden zu können zwischen Richtig und Falsch, und das dann auch noch in Verbindung mit der reinen Neugier : Darum geht es in Albigs Roman. «Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 03. 03. 2019 Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»[Ein] kurzweilige[r] und zudem höchst aktuelle[r] Roman«Wolfgang Reitzammer, Nürnberger Nachrichten, 28. 02. 2019 Wolfgang Reitzammer, Nürnberger Nachrichten
»Eine vornehme Langnovelle auch über Moral im Journalismus oder das, was wir dafür halten, ein legerer Binnenblick ins finstere Herz der Neurechten, ein Kurzroman mit Drive über die positiven Seiten des Übermuts«Frank Willmann, Neues Deutschland, 28. 02. 2019 Frank Willmann, nd
»Es macht großen Spaß Jörg-Uwe Albigs Anspielungen auf reale Ereignisse, Texte und Personen zu entschlüsseln. Sein brillanter Roman sagt uns: Gebt Aufmerksamkeit, wem Aufmerksamkeit gebührt. «Ulrich Gutmair, taz, 28. 02. 2019 Ulrich Gutmair, taz
»Risikoscheu war Jörg-Uwe Albig als Schriftsteller noch nie. «Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag, 24. 02. 2019 Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag
»[Ein] ungemein raffinierter Roman [. . .] "Zornfired" - ein großartig blödsinniger Name - ist ein sanft daherkommendes Buch von gro0ßer Härte Das macht die adäquate Sprache, die Albig zur Verfügung steht, und die alles erfassen kann und alles vorführt, ohne es einzuebnen oder zu bagatellisieren. Über Strom Linnés Gedichte zu lachen, heißt nicht, ihre Leser nicht zu fürchten. «Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 22. /23. 06. 2019 Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
»Es ist ein Buch, das sich auf kluge Weise mit einem aktuellen Thema befasst, mit dem Aufstieg der neuen Rechten, [. . .] mit der Frage, wie weit man sich auf eine Sache, über die man berichtet, einlassen muss und wo die Grenzen zwischen Beobachtung und Teilnahme liegt. Ein Roman, der nachdenklich macht«Peter Zimmermann, Ö1 - Ex libris, 16. 06. 2019 Peter Zimmermann, Ex Libris
»Albigs Roman ist einer der wichtigsten dieses Frühjahrs. Und dazu richtig gute Literatur. «Jochen Schimmang, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06. 06. 2019 Jochen Schimmang, FAZ
»Albig macht sich lustig über einen Journalismus, der einen riskanten "walk on the wilde side" verspricht, aber dann doch nur die Erwartungen seines Publikums bedient. [. . .] Jörg-Uwe Albig verharmlost die rechten Brandstifter nicht. Mit seiner "Zornfried"-Lyrik spielt er virtuos mit dem Feuer. «Martin Halter, Berliner Zeitung, 01. /02. 06. 2019 Martin Halter, Berliner Zeitung
»Jörg-Uwe Albig ist mit dem schmalen Band eine glänzende Satire voller Querverweise und Anspielungen mit hohem Wiedererkennungswert gelungen, die einerseits irrwitzig komisch ist - Albig zeichnet auch für Linées Lyrik und ihren eigentümlichen Sound (laut lesen!) verantwortlich -, andererseits die Mischung aus Faszination und Angstlust der Medien beim Blick auf die neue Rechte und die Selbstzufriedenheit des Justemilieu unbehaglich hellsichtig aufs Korn nimmt. Take a walk on the wald side! «Ulrich Kriest, Konkret, Mai 2019 Ulrich Kriest, Konkret
»Die Ernsthaftigkeit, mit der Albig in den Gedichten Linnés sein parodistisches Handwerk betreibt, ist beispielhaft für den satirischen Ernst des gesamten Romans. Zornfried ist deshalb ein fast uneingeschränkter Lektüregenuss, weil der komische Stoff in einer eleganten Prosa erzählt wird. «Johannes Franzen, Zeit Online, 02. 04. 2019 Johannes Franzen, Die Zeit Online
»Jörg-Uwe Albigs Roman trifft mitten hinein in die Debatte über Reichsbürger und AfD, die dadurch erst groß gemacht werden, dass die Medien sie so oft thematisieren. «Welf Grombacher, Freie Presse, 15. 03. 2019 Welf Grombacher, Freie Presse
»[. . .] nicht nur amüsant, sondern auch erhellend [. . .]«Mladen Gladic, der Freitag, 14. 03. 2019 Mladen Gladic, der Freitag
»Nicht mehr unterscheiden zu können zwischen Richtig und Falsch, und das dann auch noch in Verbindung mit der reinen Neugier : Darum geht es in Albigs Roman. «Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 03. 03. 2019 Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»[Ein] kurzweilige[r] und zudem höchst aktuelle[r] Roman«Wolfgang Reitzammer, Nürnberger Nachrichten, 28. 02. 2019 Wolfgang Reitzammer, Nürnberger Nachrichten
»Eine vornehme Langnovelle auch über Moral im Journalismus oder das, was wir dafür halten, ein legerer Binnenblick ins finstere Herz der Neurechten, ein Kurzroman mit Drive über die positiven Seiten des Übermuts«Frank Willmann, Neues Deutschland, 28. 02. 2019 Frank Willmann, nd
»Es macht großen Spaß Jörg-Uwe Albigs Anspielungen auf reale Ereignisse, Texte und Personen zu entschlüsseln. Sein brillanter Roman sagt uns: Gebt Aufmerksamkeit, wem Aufmerksamkeit gebührt. «Ulrich Gutmair, taz, 28. 02. 2019 Ulrich Gutmair, taz
»Risikoscheu war Jörg-Uwe Albig als Schriftsteller noch nie. «Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag, 24. 02. 2019 Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag
 Besprechung vom 03.03.2019
Besprechung vom 03.03.2019
Drehen Sie, wenn möglich, um
Eine Gruppe rechter Denker auf einer Burg. Ein Journalist auf Pilgerreise, fasziniert vom "Neuen", unfähig, Richtig und Falsch zu erkennen. Über Jörg-Uwe Albigs Schlüsselroman "Zornfried"
Der Wald gefiel Jan Brock gar nicht. Brock, freier Journalist mit Pauschale im Feuilleton der "Frankfurter Nachrichten" und Erzähler in Jörg-Uwe Albigs Roman "Zornfried", hatte sich den Spessart ganz anders vorgestellt. Er hatte an Räuber gedacht, "an Wirtshaus und Spukschloss, an schwarze, endlose Dunkelheit, aus der kein Entkommen war". Der Wald, durch den Brock mit seinem Peugeot fährt, hatte aber nichts Unheimliches. Er ging Brock mit seinen eintönig in Reihe gewachsenen Bäumen nur auf die Nerven. Bis Modergerruch durch die Lüftung zog und Brock im letzten Moment einen Ast umkurvte, den ein Sturm auf die Straße gefegt hatte. Worauf das Navi nur gelangweilt sprach: "Drehen Sie, wenn möglich, um."
Natürlich kann Brock hier nicht dem guten Rat des Navigationsgeräts folgen, denn dieser schöne Vorschlag der künstlichen Intelligenz steht am Ende des nur eineinhalb Seiten langen Auftakts zu Brocks Reise in eines der immer noch sagenumwobenen Zentren der sogenannten neurechten Intelligenz.
Albig zieht in dieser kurzen Einführung den metaphysischen Stecker aus einem anderen Wald: dem von Ernst Jünger nämlich, der sich nicht nur selbst als Dichter des deutsch-anarchischen Waldgangs sah. Und dessen gleichnamigen Buch ebenfalls bei Klett-Cotta erschienen ist. Was dann bleibt vom Wald, wenn die Metaphysik verschwindet, ist nichts als die ewig gleiche Kulisse der eintönig gewachsenen Stämme des Spessarts.
Jan Brock muss aber weiter durch die Einöde, denn er ist auf der Suche nach Storm Linné. Das ist der dunkle Ritter der neuen Intelligenz, ein rechter Avantgardist, der in der nun auch nicht mehr ganz neuen Kleinschreibung dichtet. "Spessart" heißt eines seiner Werke, das Albig seinem Buch voranstellt: "Dort wo der fuchs in scharfer waid den hasen schlägt / Dort wächst die einheit die aus zwietracht lebt (. . .) Der hohe friede der durch blut gemehrt / Dort sprießt der tausendfache tod der segen bringt / Im wald der die moral des lebens lehrt."
Man glaubt Albig sofort, dass ihm das Dichten dieser völkischen, nur halb dunklen deutschen Gedichte Spaß gemacht hat, wie er es bei der Buchvorstellung in Berlin und in einem Interview erzählt hat. Und man kann beim Lesen auch lachen - es bleibt nur in jedem Gedicht ein Rest, der über Satire und Persiflage hinausgeht. Im Gedicht über den "Spessart" ist es die letzte Zeile über den Wald, der die Moral des Lebens lehrt. Ist das nicht genau der Grund für den immensen Erfolg jenes deutschen Sachbuchbestsellers der jüngeren Gegenwart, in dem ein Förster den Wald als ein interaktiv kommunizierendes Ganzes darstellt, in dem die Bäume miteinander reden, ohne sich in Konkurrenz zu übervorteilen?
Ein anderes Gedicht heißt "Rattenkönig": "Der eklen horden giftend schwarzes Drängen / Zerplatzt an Zornfrieds rauem schieferhut." Wenn man sie kennt, können einem dazu die Bilder aus jenem Nazi-Propagandafilm einfallen, in dem Massen von Ratten durch die Gänge getrieben werden und als Ungeziefer die arische Rasse bedrängen. Es ist eine der großen Fähigkeiten Albigs, solche Anspielungen immer nur anzutippen und nicht auszuwalzen. Einmal zieht der Burgherr von Zornfried, Hartmut Freiherr von Schierling, etwas verstohlen ein Buch mit rotem Cover aus dem Regal, "Michael. A Novel", um es gleich wieder in der Masse der Bücher verschwinden zu lassen - es handelt sich um die englische Übersetzung jenes Romans, den Joseph Goebbels in den frühen zwanziger Jahren schrieb, aber das lässt Albig unerwähnt. Besser so. Schierlings Regale sind "voller Kleist und Evola, Klages und Borchardt, Whitman und E. O. Wilson". Offenbar kommt es dem Burgherrn aber weniger auf den Inhalt der Bücher an als vielmehr auf deren Alter, wie Brock fasziniert feststellt.
Natürlich kann man solche Passagen in Albigs Roman als Satire lesen - und zwar auf die vielen Homestorys aus Schnellroda, zu Besuch beim neurechten Götz Kubitschek, seiner Familie und seinen Ziegen, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, in ungefähr allen deutschsprachigen Zeitungen und Magazinen und sogar in der "New York Times". Es kann nur passieren, dass man die überhaupt nicht satirische Grundfrage von Albigs Roman übersieht. "Längst bildete ich mir nicht mehr ein zu wissen, was richtig oder falsch war", sagt Jan Brock, gleich am Anfang von "Zornfried". Aber was neu war, das konnte Brock immer noch erkennen, und das jeden Tag besser. Hingetrieben zum Neuen, zum neuen Rechten, hat ihn dabei seine "reine Neugier", diese "heilige, unbezähmbare Neugier", auf die Brock so stolz war.
Nicht mehr unterscheiden zu können zwischen Richtig und Falsch, und das dann auch noch in Verbindung mit der "reinen Neugier": Darum geht es in Albigs Roman. Gibt es das überhaupt, die reine Neugier? Die in Brocks Selbstbeschreibung so heilig-unbezähmbar vom Himmel fällt?
Brock listet dann auch gleich auf, was ihm seine Neugier gebracht hat: einen Pauschalistenvertrag bei den "Nachrichten", den Peugeot, die Vierzimmerwohnung am Zoo. Brock verbindet jene Frage nach Richtig und Falsch, die er nicht mehr zu beantworten vermag, mit einem allgemeineren Gesetz: dem des Wachstums. Was nicht wächst, stirbt schon, in dieser Kurzform wendet es Brock auf den Journalismus an. Die Kunst besteht darin, Themen zu erkennen, wenn sie auftauchen, sozusagen über ihr Keimstadium hinaus gewachsen sind - aber noch nicht journalistisch beschrieben sind.
Und so stößt Brock auf sein Thema der neuen rechten Intellektuellen: Bei einer Diskussion in einem Theater trifft er auf eine Politologin, einen Gewerkschafter, einen Intendanten und auf Aktivisten. Sie sprechen über die "Zivilgesellschaft", über das "starke Bündnis, das man diesen Kräften entgegenstellen müsste", aber auch von den "Sorgen, die ernst zu nehmen seien", von den "Grenzen des Sagbaren", die man schützen, und den "Denkverboten", die man meiden müsse.
Jeder und jede kennt solche Reden. Albigs Kunst liegt auch darin, dass er sie nicht denunziert. Er lässt nur einen Trupp rechter Störer ins Theater eindringen und sie eine Gedichtzeile von Storm Linné an die Wand sprühen: "versklavt nicht von der Heuchler feiger Zunge". Und hier, in diesem Augenblick, beginnt Brocks Suche nach Storm Linné und der Burg Zornfried.
Was Albig hier dann aber kurz einstreut, erledigt glatt jenen Mythos von den neuen Rechten als begabten Benutzern und Bedienern der aktuellen Zeichen von Sub- und Popkulturen. In der Horde, die das Theater stürmt, trug einer "eine Basecap, einer eine Bauernmütze, einer Vollbart und Glatze, ein anderer kurzes, gelgescheiteltes Kopfhaar. Zwei litten unter Frisuren, die dem Vorbild des nordkoreanischen Präsidenten folgten, und der Rest an Frisuren, die gar keine waren." Der Mythos von der popkulturellen Kompetenz der neuen und ach so jungen Rechten zerfällt in diesen kurzen Beschreibungen schlicht und einfach durch detailgenaues Hinsehen. Das schadet dem Fluss der Geschichte überhaupt nicht.
Albigs Detail- und Wortsicherheit wiederum zeigt sich auch bei den Namen, die er in seinem Roman vergibt: Das fängt mit Storm Linné an, bei dessen Name die Betonung nicht vorn, also auf dem Dichter Theodor Storm liegt, sondern hinten, auf dem Begründer der modernen binomischen Nomenklatur für die Lebewesen dieser Erde. Wie der Naturforscher Carl von Linné einst damit begann, Pflanzen wie Tiere über ihre Namen zu kennzeichnen und zu unterscheiden, ist auch Albig ein Meister der Namen. Die Burg Zornfried wiederum liegt in Wuthen, im Kreis Korzbach, oder auch, wie die Bewohner von Zornfried sagen würden, im Gau Mainfranken.
Und dort, auf dieser Burg, in die Brock es geschafft hat, über den Burgherrn Schierling einzudringen, trifft der Journalist dann nicht nur auf die vielen Töchter des Hausherrn, sondern auch: auf eine junge Wehrsportgruppe. Und einige der schillernden "Intellektuellen". Einer von ihnen, ein bleicher, gedrungener Mann im schwarzen Anzug namens Krathmann, verwickelt Brock dort in ein Gespräch, das man als den medienkritischen Kern von Albigs Roman lesen kann. Krathmann konfrontiert Brock mit Sätzen aus einem Verriss, den Brock über ein Werk von Storm Linné geschrieben hatte. "Wissen Sie überhaupt noch, was Sie da geschrieben haben", sagt Krathmann und singt Brock seine alten Sätze vor, die Brock immer noch nicht falsch finden kann, auch wenn es ihm unangenehm ist, von Krathmann gelobt zu werden. Und genau in diesem Mechanismus liegt das Dilemma, um das Albig seine furiose Geschichte entfaltet.
CORD RIECHELMANN
Jörg-Uwe Albig: "Zornfried". Klett-Cotta, 159 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 25.08.2019
Zornfried nimmt das mediale Gezetter um Rechtsausleger und ihre Selbststilisierung aufs Korn, führt sich damit selbst ad absurdum.
LovelyBooks-Bewertung am 30.07.2019
Eine interessante Buchidee, die für mich nicht gut umgesetzt wurde.









