Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
15% Rabatt11 auf ausgewählte eReader & tolino Zubehör mit dem Code TOLINO15
Jetzt entdecken
mehr erfahren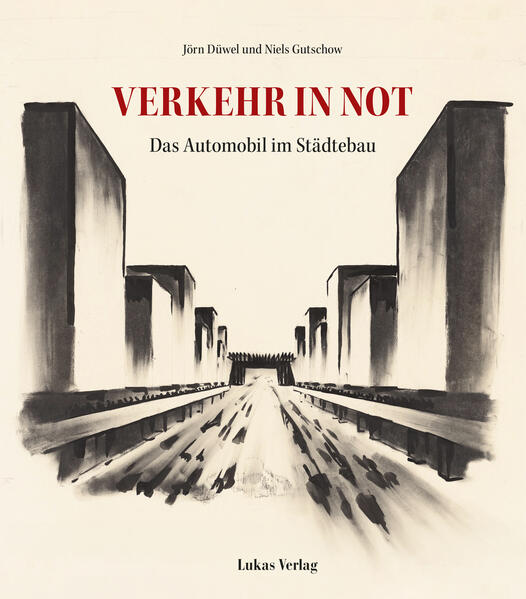
Zustellung: Mi, 27.08. - Fr, 29.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Autoren erzählen anhand exemplarischer Beispiele aus verschiedenen Städten die facettenreiche und widersprüchliche Geschichte des Automobils im Städtebau von den Anfängen bis heute.
Der Konflikt um das Automobil in der Stadt wird seit jeher ausgetragen. Anfangs überwogen Hoffnungen und Erwartungen an das neue Verkehrsmittel, das ungebundene Mobilität versprach. Man war überzeugt, den Autos müsse Raum geschaffen werden, um sich »austoben« zu können. Doch schon bevor Kraftfahrzeuge massenhaft auf den Straßen ankamen, wurde ein Verkehrselend befürchtet. Um es abzuwenden, forderten Städtebauer, »die uralten, verwinkelten, ungesunden Stadtanlagen mit ihren halsbrecherischen Straßen abzureißen und an ihre Stelle eine moderne Stadt zu setzen. « Radikale Entwürfe wurden vorgelegt; mit den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs schien deren Umsetzung endlich in greifbarer Nähe. So verspottete der Berliner Senat Mitte der Fünfzigerjahre Fußgänger als »unverbesserliche Neandertaler«, denn »wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen, und wer keines hat, ist ein Spaziergänger und gehört schleunigst in den nächsten Park. « Über Jahrzehnte hinweg schien die Lösung der »Verkehrsnot« im Ausbau der Straßen zu bestehen. Erst mit der Einsicht in die Endlichkeit der Ressourcen setzte in den Siebzigerjahren ein Umdenken ein, allerdings ohne nennenswerte Folgen. Zwar ist seit den Neunzigerjahren von einer Verkehrswende die Rede, doch auf der Straße schlägt sich das bis heute kaum nieder. Die libidinöse Beziehung zum Auto, das keineswegs nur als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern auch Freiheit verheißt, wird ausgeblendet, oder es wird gar als »mobiles Zuhause« erlebt. Die Autoren erzählen anhand exemplarischer Beispiele aus verschiedenen Städten die facettenreiche und widersprüchliche Geschichte des Automobils im Städtebau von den Anfängen bis heute.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Mai 2024
Sprache
deutsch
Untertitel
Das Automobil im Städtebau.
1. , Aufl.
teils farbige Abbildungen.
Englisch Broschur.
Auflage
1., Aufl.
Seitenanzahl
407
Autor/Autorin
Jörn Düwel, Niels Gutschow
Illustrationen
teils farbige Abbildungen
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
teils farbige Abbildungen
Gewicht
1258 g
Größe (L/B/H)
243/219/33 mm
Sonstiges
Englisch Broschur
ISBN
9783867324465
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 15.11.2024
Besprechung vom 15.11.2024
Das innig geliebte Monster
Zwei Bücher widmen sich dem schwierigen Verhältnis von Stadt und Automobil. Eines blickt zurück auf eine lange Leidens- und Konfliktgeschichte, das andere wirbt für eine Befreiung des urbanen Raums von der Vorherrschaft des Pkw.
Das Automobil in der Stadt ist seit jeher mit Konflikten verbunden", resümieren Jörn Düwel und Niels Gutschow in ihrem Buch über die Auswirkungen des Autoverkehrs auf den Städtebau seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Steffen de Rudder, Mitautor eines Bandes über neu gestaltete Straßenräume der Gegenwart, formuliert es noch deutlicher: "Auf der Verbindung von Stadt und Auto liegt kein Segen." Die beiden Bücher behandeln aus unterschiedlicher Perspektive ein Thema, das viele Gemüter erhitzt. Das eine bietet eine historische Analyse, das andere präsentiert aktuelle Projekte, die in die Zukunft weisen sollen.
Die Architekturhistoriker Düwel und Gutschow zeichnen fundiert und materialreich nach, wie das Auto die Stadträume veränderte und welche Konzepte die Stadtplanung zur Bewältigung der Verkehrsbelastung entwickelte. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts überwog die Begeisterung für die Fortschrittsverheißung des Autos, die sich oftmals mit dem Hass auf die historisch gewachsene Stadt paarte. Der Verkehrsingenieur Hans Ludwig Sierks sah in ihr ein "Symbol teuflischer Gemütsroheit, Sklaverei und des finsteren Aberglaubens" und forderte die Beseitigung von allem, was dem Verkehr im Weg stand. Le Corbusier, der in dem von einem Autohersteller finanzierten "Plan Voisin" die Einebnung des historischen Zentrums von Paris vorschlug, feierte die stadtzerstörerische Kraft des Autos: "Autos, Autos, schnell, schnell (...) Die Stadt zerbröckelt." Andere waren nicht so begeistert, sahen aber keine Alternative zur Zurichtung der Stadt für das Auto, dessen Siegeszug als so unausweichlich wie eine Naturgewalt galt.
Es gab auch vereinzelte, frühe Stimmen, die vor der Unterwerfung der Stadtplanung unter die Bedürfnisse des Autoverkehrs warnten. Der Kunsthistoriker und Architekt Cornelius Gurlitt bezeichnete "das viel zu viel Straßenraum einnehmende Fahrgerät" schon in den Zwanzigerjahren als "unpraktisch und gefährlich". Er kritisierte die Autofahrer für ihren "irrigen Glauben, dass sie ein größeres Recht auf die Fahrbahn als die einfachen Fußgänger hätten". Wie weit er damit seiner Zeit voraus war, zeigt die Fußgängerbeschimpfung durch den Berliner Senat im Jahr 1957: "Und die Fußgänger? Mit unverbesserlichen Neandertalern kann sich die neue Straße nicht abgeben. Wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen, und wer keines hat, ist ein Spaziergänger und gehört schleunigst in den nächsten Park."
Zuvor hatte der Zweite Weltkrieg Voraussetzungen für einen brachialen Stadtumbau geschaffen, von dem Modernisten geträumt hatten. Der Architekt Klaus Tippel mahnte 1948 für den Wiederaufbau von Bremen: "Heute lässt sich die Planung fast ganz ohne erneute schmerzliche Eingriffe durchführen, da der Bombenkrieg - so verheerend und grausam er gewesen ist - die notwendigen Schneisen geschlagen hat, und es wäre unverantwortlich und sträflich kurzsichtig, sie, dies 'Glück im Unglück' verkennend, wieder zu verbauen." War es vor dem Krieg meist bei planerischen Visionen geblieben, so bereiteten die Bombardierungen den Weg für die gewünschten Straßendurchbrüche, großräumigen Kreuzungen, Kreisverkehre, Hochstraßen und Stadtautobahnen. Hannover galt als Modellbeispiel für das Leitbild der "autogerechten Stadt", aber auch viele andere Städte in Ost und West wurden für den Verkehrsfluss zerfleddert.
Es ist nicht so, dass Fußgänger und Radfahrer in den Planungen der Nachkriegszeit vollkommen vergessen worden wären. Das einst gefeierte Konzept der Trennung der Verkehrswege wies ihnen eigene, autofreie Trassen und Räume zu. Seit den Fünfzigerjahren entstanden von Amerika ausgehend Einkaufszentren mit überdachten, halb öffentlichen Räumen. In den britischen New Towns wurden die Verkehrsarten auf mehrere Ebenen verteilt. Mit den Fußgängerzonen erhielten auch historische Stadtzentren autofreie Straßenzüge. Allein, Urbanität wollte sich mit der Verkehrstrennung nicht einstellen, und ebenso wie manch eine brutal durchgeschlagene Autoschneise wurden inzwischen auch einige gut gemeinte Fußgängerreservate zurückgebaut.
Der Traum von Tempo und individueller Bewegungsfreiheit endete bald im Stau, und die Idee der "autogerechten Stadt" wurde zum Inbegriff der Fehlentwicklungen im Städtebau. Schon 1963 hatte der britische Verkehrsingenieur Colin Buchanan im Auto ein "Monstrum von großer potentieller Zerstörungskraft" erkannt, das gleichwohl innig geliebt werde. So verstopfen und verpesten die Autos seitdem zunehmend die Städte. Seit Jahrzehnten ist von Verkehrswende die Rede, unter Planern ist ihre Notwendigkeit weitgehend unbestritten, und doch kommt sie kaum voran. Selbst noch so zaghafte Reduzierungen der Verkehrsfläche für Autos lösen regelmäßig einen Sturm der Entrüstung aus.
Für den Architekten Steffen de Rudder ist das "Festhalten an einem dysfunktionalen System" gerade in Deutschland, dem einstigen Land der Effizienz und guten Organisation, besonders augenfällig. Zusammen mit seinen Mitautoren Pola Koch und Stefan Signer hat er achtundzwanzig Beispiele umgebauter Straßenräume in Europa versammelt, die vor Augen führen, wie viel Freiraum und Lebensqualität durch die Zurückdrängung des Autos zu gewinnen ist. Deutschland ist in dieser Auswahl schwach vertreten. Dagegen überrascht Frankreich, wo noch vor nicht langer Zeit Autos vor den Portalen gotischer Kathedralen parkten, mit mehreren innovativen Projekten. So wurde etwa in der dicht bebauten Pariser Rue Léon Cladel ein Skatepark angelegt. Er schafft ein Angebot für Jugendliche und belebt die von Bürobauten gesäumte Straße. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich die gezackte, grün gefärbte Betonbahn als ästhetisch ähnlich haltbar erweist wie die beeindruckenden Häuserfassaden aus der Zeit Baron Haussmanns.
Eine gewisse plakative Penetranz zeigen auch einige andere vorgestellte Projekte. Die Mariahilfer Straße in Wien und die Slovenska Cesta in Ljubljana indes erinnern nach ihrer Befreiung von den Automassen bedenklich an Fußgängerzonen der Achtzigerjahre. Es mangelt wohl noch etwas an gestalterischen Ansätzen, die die Verkehrswende auch ästhetisch attraktiv machen. Aber allein schon die Begrünung, die mit dem Umbau der Straßen meist einhergeht, ist ein Gewinn für Stadtklima und Lebensqualität. Zu den besonders beeindruckenden Beispielen gehört etwa der Passeig de Sant Joan in Barcelona.
Wie die Autoren betonen, ist nicht der Ausschluss des Autoverkehrs das Ziel, wohl aber dessen deutliche Reduktion, die ein vielfältigeres Straßenleben ermöglicht. Diese höchst rationale Idee hat aber nach wie vor viele Feinde, die sich auch mit Sonderpädagogik kaum umstimmen lassen. Unlängst zeigte dies der Vorstoß von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, der mit Gratisparken für noch mehr Autoverkehr in den Innenstädten sorgen will. Gerade beim Thema Verkehrswende haben Fachleute einen schweren Stand gegen die Politik. Umso wichtiger sind lockende Beispiele guter Praxis, die zeigen, dass Straßenräume mehr sein können als nur Trassen und Abstellflächen für Autos. ARNOLD BARTETZKY
Jörn Düwel und Niels Gutschow: "Verkehr in Not". Das Automobil im Städtebau.
Lukas Verlag, Berlin 2024. 407 S., Abb., br., 40,- Euro.
"Die neue Öffentlichkeit". Europäische
Straßenräume des 21. Jahrhunderts.
Hrsg. von Pola Koch, Steffen de Rudder und Stefan Signer. M Books,
Weimar 2024. 344 S., Abb., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Verkehr in Not" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









