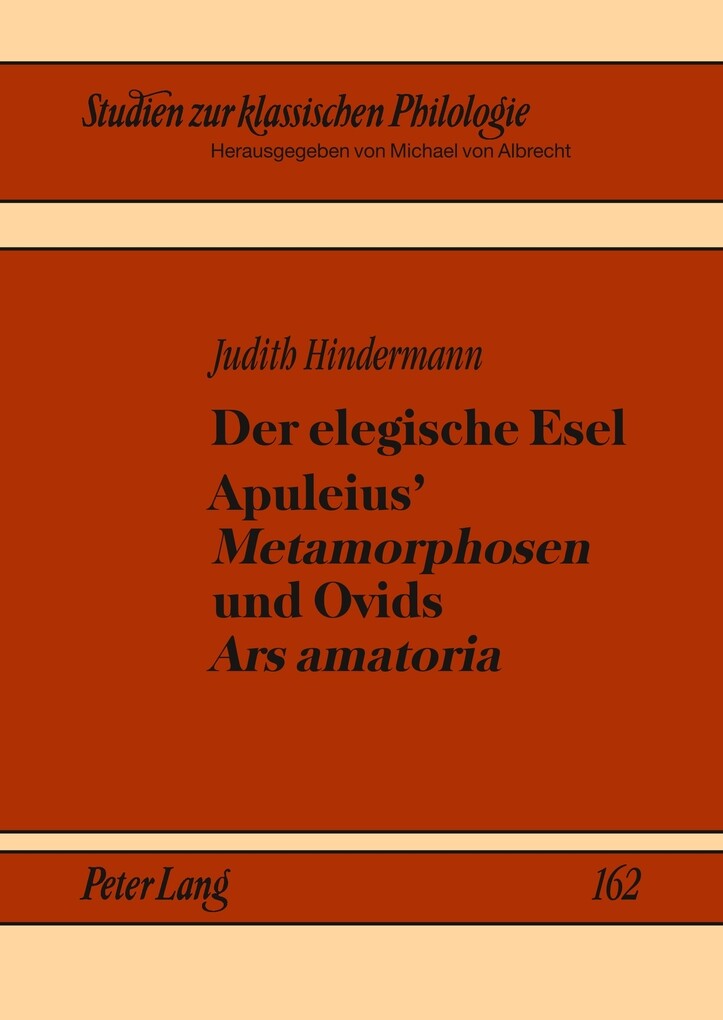
Zustellung: Fr, 18.07. - Di, 22.07.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Intertextualität spielt für die Deutung von Apuleius' Metamorphosen eine zentrale Rolle. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass Apuleius bei der Schilderung von Liebesbeziehungen den elegischen Diskurs aufgreift, indem er seinen Protagonisten Lucius und die Sklavin Photis als elegisches Liebespaar darstellt. Bedeutsam ist, dass sich in Lucius' Verhältnis zur Göttin Isis ebenfalls typisch elegische Verhaltensweisen feststellen lassen. Lucius inszeniert die Göttin als puella und domina und unterwirft sich ihrem Willen. Eine Interpretation der Metamorphosen vor dem Hintergrund von Ovids Ars amatoria soll daher nicht nur zeigen, dass die in der römischen Elegie entwickelten Liebeskonzepte über die Gattungsgrenzen hinweg in einem Roman des 2. Jahrhunderts n. Chr. rezipiert wurden, sondern auch Argumente gegen eine eindimensional ernsthaft-religiöse Deutung des Isis-Buches liefern.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Inhalt: Intertextualität in den Metamorphosen des Apuleius - Verhältnis Ovid und Apuleius - Liebe und Sexualität in den Metamorphosen - Rezeption der Ars amatoria als Lehrbuch der Liebe - Strukturelle Parallelen zwischen Ars amatoria und Metamorphosen - Inhaltliche Parallelen: Strategien der Eroberung wie das Auffinden der Geliebten (inventio) und die Eroberung (captatio), Verhaltensstrategien (militia und servitium amoris) - Aussehen der puella - Die Vergöttlichung der Geliebten - Isis als puella.
Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. April 2009
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
236
Reihe
Studien zur klassischen Philologie
Autor/Autorin
Judith Hindermann
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
423 g
Größe (L/B/H)
216/153/16 mm
ISBN
9783631592304
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der elegische Esel. Apuleius' 'Metamorphosen' und Ovids 'Ars amatoria'" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









