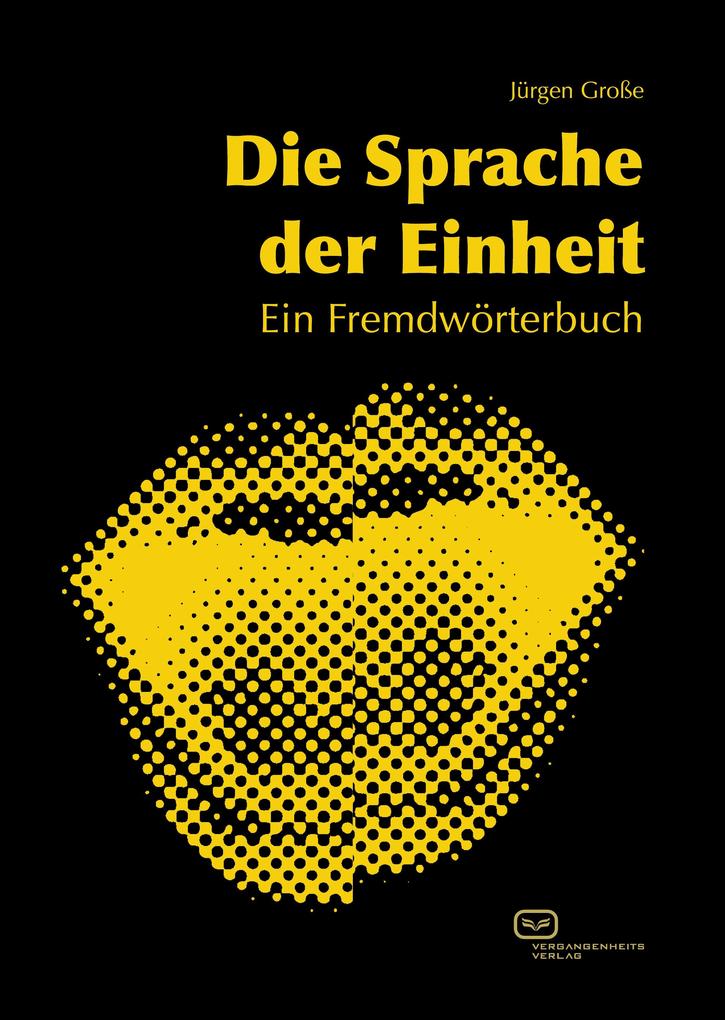
Zustellung: Mo, 21.07. - Mi, 23.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Über 2000 westdeutsche Wörter und Wendungen . . .
30 Jahre sind sie nun wieder dabei, und noch immer finden sie nicht überall Verständnis: die Westdeutschen. Jahrzehntelang hatten sie eine nationale Phantomexistenz geführt. Das wurde mit der deutschen Vereinigung sichtbar. Der Begegnung mit fremden Lebensformen jenseits von Tourismus und Gastronomie entwöhnt, trafen sie auf eine zumeist hochdeutsch sprechende Bevölkerung. Mißverständnisse waren unvermeidlich. Sprachwissenschaftliche Analysen lassen zwar keinen Zweifel daran, daß das Westdeutsche zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört. Dennoch zeigt dieses Idiom zahlreiche Eigenarten. Modernes Westdeutsch umfaßt weniger Wörter und somit geistige Artikulationsmöglichkeiten als das Hochdeutsche. Dafür überrascht es mit interessanten Schrumpfformen und Wucherungen. Am meisten faszinieren seine schutz- und haltgebenden Milieudialekte, die dieses Wörterbuch genau seziert.
Dieser Sprachführer für vereinigte Deutsche bietet:
- über 2000 westdeutsche Wörter und Wendungen,
- grammatische Abweichungen vom Hochdeutschen in leicht faßlicher Darstellung,
- Sprachbeispiele aus allen politischen, sozialen und intellektuellen Milieus,
- authentisches Westdeutsch dank Originalzitaten von mehr als 300 Prominenten und solchen, die es beinahe geworden wären,
- ein Personenregister zum Nachschlagen, sich darin Vermissen und Aufatmen.
Pressestimmen:
Alle, die sich immer schon wunderten, weshalb sich die Öffentlichkeit bei jedem Mauerfall- und Wendejubiläum bloß über die ostdeutsche Seele beugt und nicht auch über die westdeutsche, können sich über dieses Geschenk freuen
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Gut 500 Seiten Sprache von Politik- und Medienbetrieb, die Förmliches und Flapsiges nicht zu trennen weiß, die sich selbstbewußt spreizt und bläht und sich dessen nicht schämt.
Bayern 2
Jürgen Große hält sein im Vorwort gegebenes Versprechen: An Absonderlichem und Befremdlichem wird kein Mangel sein.
Neues Deutschland
Ein Pandämonium des linguistischen Grauens ebenso wie ein Panorama der semantischen Hochstapelei.
Schattenblick
Ein Wörterbuch für alle, die an der Sprache unserer Zeit oder auch nur des Zeitgeistes verzweifeln, aber mehr ahnen als wissen warum.
Das Blättchen. Zweiwochenschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft
Es gibt hier viel zu lernen und zu lachen. `Die Sprache der Einheit` sollte in allen Journalistenschulen Pflichtlektüre werden.
Junge Welt
Endlich wird hier die spezifische Kultur und Sprache der sogenannten Alten Länder systematisch jenem blinden Fleck entrissen, der sie seit der Wiedervereinigung unsichtbar zu machen droht.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Dieser Sprachführer für vereinigte Deutsche bietet:
- über 2000 westdeutsche Wörter und Wendungen,
- grammatische Abweichungen vom Hochdeutschen in leicht faßlicher Darstellung,
- Sprachbeispiele aus allen politischen, sozialen und intellektuellen Milieus,
- authentisches Westdeutsch dank Originalzitaten von mehr als 300 Prominenten und solchen, die es beinahe geworden wären,
- ein Personenregister zum Nachschlagen, sich darin Vermissen und Aufatmen.
Pressestimmen:
Alle, die sich immer schon wunderten, weshalb sich die Öffentlichkeit bei jedem Mauerfall- und Wendejubiläum bloß über die ostdeutsche Seele beugt und nicht auch über die westdeutsche, können sich über dieses Geschenk freuen
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Gut 500 Seiten Sprache von Politik- und Medienbetrieb, die Förmliches und Flapsiges nicht zu trennen weiß, die sich selbstbewußt spreizt und bläht und sich dessen nicht schämt.
Bayern 2
Jürgen Große hält sein im Vorwort gegebenes Versprechen: An Absonderlichem und Befremdlichem wird kein Mangel sein.
Neues Deutschland
Ein Pandämonium des linguistischen Grauens ebenso wie ein Panorama der semantischen Hochstapelei.
Schattenblick
Ein Wörterbuch für alle, die an der Sprache unserer Zeit oder auch nur des Zeitgeistes verzweifeln, aber mehr ahnen als wissen warum.
Das Blättchen. Zweiwochenschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft
Es gibt hier viel zu lernen und zu lachen. `Die Sprache der Einheit` sollte in allen Journalistenschulen Pflichtlektüre werden.
Junge Welt
Endlich wird hier die spezifische Kultur und Sprache der sogenannten Alten Länder systematisch jenem blinden Fleck entrissen, der sie seit der Wiedervereinigung unsichtbar zu machen droht.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. November 2019
Sprache
deutsch
Auflage
1
Seitenanzahl
572
Autor/Autorin
Jürgen Große
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1255 g
Größe (L/B/H)
249/177/41 mm
ISBN
9783864082559
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 24.11.2019
Besprechung vom 24.11.2019
10. Buch der fremden Westwörter
Alle, die sich immer schon wunderten, weshalb sich die Öffentlichkeit bei jedem Mauerfall- und Wendejubiläum bloß über die ostdeutsche Seele beugt und nicht auch über die westdeutsche, können sich über dieses Geschenk freuen: Endlich wird hier die spezifische Kultur und Sprache der sogenannten "Alten Länder" systematisch jenem blinden Fleck entrissen, der sie seit der Wiedervereinigung unsichtbar zu machen droht. "Ein Fremdwörterbuch" nennt der Berliner Publizist Jürgen Große seine auf knapp 600 Seiten dargebotene Sammlung von Ausdrücken, die er aus unterschiedlichen Gründen als charakteristisch für die in dieser Region ausgebildete Mentalität erachtet. Die übliche Mainstream-Blickrichtung von Westen nach Osten kehrt er dabei einfach um: "Offenkundig hatte 1949 mit dem staatlichen Sonderweg Westdeutschlands", schreibt er im Vorwort, "auch ein kultureller und vor allem sprachlicher begonnen, der am 3. Oktober 1990 keineswegs ausgeschritten war." Das Wörterbuch wolle einen Beitrag zur Verständigung leisten, indem es die in der alten Bundesrepublik Sozialisierten zu einer "kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen sprachlichen Vergangenheit" ermutigt. Nur so könnten "die notorischen Ok- und Eben-halt- und Ich-denk-mal-Sager die Akzeptanz unter Europas Völkern finden, nach der sich ihr schwankendes Selbstbewusstsein seit je sehnt".
Neben erwartbaren Wendungen wie "Ballermann", "Ein Stück weit" oder "Hausaufgaben machen" ("Politschnöselsprech: Die Griechen, Spanier, Portugiesen usw. müssten erst ihre H. machen, ehe sie wieder bei den Mehrheitsdeutschen in die Schule gehen dürften") finden sich da zahlreiche verblüffende Entdeckungen, die den unscheinbarsten Formulierungen eine ganze Mikrosoziologie der herrschenden Kultur ablauschen. Zum Beispiel beim Eintrag "(gut) sortiert: Edelkonsumentensprech", das symptomatisch "dem Vertrauen auf eine vorgeordnete, sprich: sortierte Realität" entspreche: "Hier ist ausschließlich das real, was zu Auswahl und Zugriff bereitliegt". Oder, noch knapper, bei dem "bedeutungsprallen Füllwort" "eh", das "auf einmalige Weise Resignation und Sprachdemenz" miteinander verbinde: "Ist eh schon alles zu spät".
Belegt werden die Funde durch aufgeschnappte, mit Ort und Zeit (Essener Hauptbahnhof am 15. Oktober 2000) akribisch dokumentierte Gesprächsfetzen oder durch Zitate aus Zeitungen und Werken der zeitgenössischen Literatur. So belässt es der Eintrag "hey" allein bei dem Beispiel Margot Käßmanns, die für "DB mobil 2006" gefragt wurde: "Gibt es einen Fußballgott, Frau Käßmann?" und dann antwortete: "Ich denke, Gott freut sich mit den Gewinnern, stärkt den Verlierern den Rücken und sagt allen - vor allem den Hooligans - hey, es ist ein Spiel!"
Nicht immer mündet der Sarkasmus in eine zielgenaue Pointe, und manchmal sind die Grenzen des Bundesrepublikanischen, wie es hier erscheint, zum sonst wie Deutschen fließend. Doch insgesamt ist der Erkenntnisgewinn, den dieses Wörterbuch bietet, indem es das sonst so Vertraute plötzlich ganz fremd erscheinen lässt, immens. Der "arglose Glaube an sprachlich machbare Normalität", den der Verfasser eingangs als Erkennungszeichen des Westdeutschen ausmacht, ist etwas kleiner geworden.
Mark Siemons
Jürgen Große: "Die Sprache der Einheit. Ein Fremdwörterbuch". Vergangenheitsverlag, 572 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Sprache der Einheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









