Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren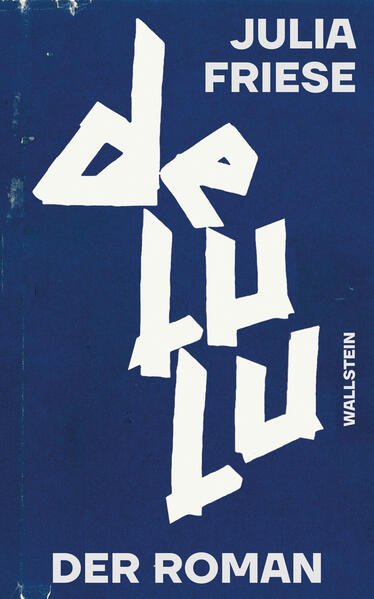
Zustellung: Fr, 22.08. - Mo, 25.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Wünschten Sie nicht auch, Sie würden sich weniger für sich interessieren? «Res hat stets geglaubt, etwas Besonderes zu sein - so wie ihr Idol Frances Scott. Doch ausgerechnet an dem Tag, als sie diese größte Popkünstlerin unserer Zeit treffen soll, endet ihr Leben abrupt. Auf der Folie von Film, Musik und Werbung der Jahrtausendwende zieht ihr Leben an ihr vorbei. Und wir tauchen ein in das Unterbewusstsein der westlichen Populärkultur. Wie selbstverständlich wird hier eine Existenz in ständiger Stimulation erwartet, die auf ein grandioses Ende hinauslaufen soll - das nie erreicht werden darf. Im Delir trifft Res endlich Frances. In Lofts und Restaurants, bei Tennis Games und großen Auftritten. Es ist das letzte Aufglühen eines Traums aus einer Zeit, in der Pop scheinbar apolitisch nichts als Hedonismus verkaufte. Weder Res, die den Traum beschreibt, noch Frances, die den Traum verkauft, bestimmen seine Spielregeln. Sie streben danach, Produkt zu werden und Marke. Aber warum denn nur? Sprachspielerisch ergründet »delulu« das gegenwärtige Begehren nach dem Gesehenwerden. Alles hängt mit allem zusammen in diesem filigran konstruierten Roman, der literally so bunt und plastisch ist wie ein Spielzeug.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
19. Februar 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Der Roman.
Seitenanzahl
247
Autor/Autorin
Julia Friese
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
364 g
Größe (L/B/H)
203/128/25 mm
ISBN
9783835358102
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Es gibt Bücher, die liest man und es gibt Bücher, die flimmern. Der neue Roman von Julia Friese flimmert. Er ist MTV, Zuckerrausch und Kater in einem. «
(Jasmin Kröger, Deutschlandfunk Corso, 19. 02. 2025)
»Friese spielt virtuos auf der Klaviatur der Popkultur ( ). (D)ieses selbstbewusste Textexperiment (bietet) eine willkommene Abwechslung vom allgegenwärtigen Realismus in der deutschen Gegenwartsliteratur. «
(Thomas Hummitzsch, tip Berlin, 2/2025)
»erfrischend anders: gewitzt, gewagt und schlicht delulu. «
(Thomas Hummitzsch, tip Berlin, 2/2025)
»Aus Beobachtungen schlägt Julia Friese Funken, alles scheint möglich im Schnelldurchlauf der Wünsche, im Hologramm der Idole. ( ) Selbstbewusst streut die Schriftstellerin seltsam schöne Sätze auf die Wege und Umwege dieser Reisenden ins Licht. «
(Janina Fleischer, Leipziger Volkszeitung, 21. 03. 2025)
»ein wortgewaltiges Spiel mit Assoziationen, Referenzen und Fantasien«
(Birgit Fuß, Rolling Stone, April 2025)
»(ein) sprachgewaltige(r) Ritt durch die Popkultur der 2000er Jahre«
(Julia Hubernagel, taz, 27. 03. 2025)
»Das Buch ist nicht nur sprachlich anspruchsvoll, sondern leistet eine eindrückliche Diagnose (. . .). Das Glücksversprechen ist eine Lüge, sagt Julia Friese und ihr Buch wirkt deswegen wie eine schöne Befreiung von alten Sehnsüchten. «
(Laura Ewert, Focus, 28. 03. 2025)
»Für ihr anspruchsvolles Erzählprojekt hat Friese eine anspruchsvolle Prosa gefunden auf deren extreme Musikalität sich einlassen muss, wer Freude an dieser Expedition haben will. Es lohnt sich. «
(Arno Frank, Der Spiegel, 05. 04. 2025)
»Ein Roman wie eine intellektuelle Pop-Achterbahnfahrt«
(Marah Rikli und Barbara Loop, annabelle. ch, 13. 05. 2025)
»Ein wilder fragmentarischer, assoziativer Trip der ein bisschen an William S. Burroughs oder Thomas Pynchon erinnert. «
(Beneditk Herber, DIE ZEIT, 28. 05. 2025)
»Über den Starkult um die Jahrtausendwende und seine psychologischen Tiefenwirkungen (. . .) hat Julia Friese einen ziemlich verrückten, eloquenten, poptheoretisch versierten ( ) Roman geschrieben. «
(Oliver Jungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 07. 2025)
(Jasmin Kröger, Deutschlandfunk Corso, 19. 02. 2025)
»Friese spielt virtuos auf der Klaviatur der Popkultur ( ). (D)ieses selbstbewusste Textexperiment (bietet) eine willkommene Abwechslung vom allgegenwärtigen Realismus in der deutschen Gegenwartsliteratur. «
(Thomas Hummitzsch, tip Berlin, 2/2025)
»erfrischend anders: gewitzt, gewagt und schlicht delulu. «
(Thomas Hummitzsch, tip Berlin, 2/2025)
»Aus Beobachtungen schlägt Julia Friese Funken, alles scheint möglich im Schnelldurchlauf der Wünsche, im Hologramm der Idole. ( ) Selbstbewusst streut die Schriftstellerin seltsam schöne Sätze auf die Wege und Umwege dieser Reisenden ins Licht. «
(Janina Fleischer, Leipziger Volkszeitung, 21. 03. 2025)
»ein wortgewaltiges Spiel mit Assoziationen, Referenzen und Fantasien«
(Birgit Fuß, Rolling Stone, April 2025)
»(ein) sprachgewaltige(r) Ritt durch die Popkultur der 2000er Jahre«
(Julia Hubernagel, taz, 27. 03. 2025)
»Das Buch ist nicht nur sprachlich anspruchsvoll, sondern leistet eine eindrückliche Diagnose (. . .). Das Glücksversprechen ist eine Lüge, sagt Julia Friese und ihr Buch wirkt deswegen wie eine schöne Befreiung von alten Sehnsüchten. «
(Laura Ewert, Focus, 28. 03. 2025)
»Für ihr anspruchsvolles Erzählprojekt hat Friese eine anspruchsvolle Prosa gefunden auf deren extreme Musikalität sich einlassen muss, wer Freude an dieser Expedition haben will. Es lohnt sich. «
(Arno Frank, Der Spiegel, 05. 04. 2025)
»Ein Roman wie eine intellektuelle Pop-Achterbahnfahrt«
(Marah Rikli und Barbara Loop, annabelle. ch, 13. 05. 2025)
»Ein wilder fragmentarischer, assoziativer Trip der ein bisschen an William S. Burroughs oder Thomas Pynchon erinnert. «
(Beneditk Herber, DIE ZEIT, 28. 05. 2025)
»Über den Starkult um die Jahrtausendwende und seine psychologischen Tiefenwirkungen (. . .) hat Julia Friese einen ziemlich verrückten, eloquenten, poptheoretisch versierten ( ) Roman geschrieben. «
(Oliver Jungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 07. 2025)
 Besprechung vom 31.07.2025
Besprechung vom 31.07.2025
Was sie wirklich, wirklich will
It's the marketing, stupid! Julia Friese reflektiert in "delulu" ihre eigene popkulturelle Prägung
Taylor Swift ist nicht Britney Spears. Dafür kann sie nichts. Als warenförmige Verheißung, deren Abglanz in tausend Schattierungen verkauft wird, steht sie der tragischen Prinzessin des Pop nicht nach. Es ist die Zeit, die sich gewandelt hat. In der Ära der Handbildschirme, Influencer und KI-Algorithmen rechnet niemand mehr mit dem Echten hinter dem Glitzernden. Simulation hat die Stimulation abgelöst. Das war in den Neunzigern noch anders: Die Millennials waren vielleicht die Letzten mit quasireligiöser Verehrung für ihre Ikonen. Das Marketing störte dabei nicht, im Gegenteil: Ein gigantischer Millionendeal, wie ihn Britney Spears 2001 mit Pepsi einging, machte sie erst endgültig zum Megastar. Die ins kollektive Gedächtnis eingebrannten Werbeclips inszenierten die längst Unerreichbare als echte, nahbare Person (mit Pepsi-Durst). Film, Musik und Werbung, das war eine erstaunlich unschuldig wirkende Einheit. Weil Facebook und der ganze Rest noch nicht existierten, saßen die Fans in ihren Kinderzimmern alleine vor MTV. Es gab Sendung und Empfang, keine Gemeindebildung wie bei den Swifties, die einander mehr brauchen als ihr Idol.
Über den Starkult um die Jahrtausendwende und seine psychologischen Tiefenwirkungen - das Begehren, sich selbst in ein Produkt oder eine Marke zu verwandeln - hat Julia Friese einen ziemlich verrückten, eloquenten, poptheoretisch versierten, zugleich aber hemmungslos überambitionierten, in viel zu viele Vignetten voller Innerlichkeit (darunter sehr schöne) zersplitternden Roman geschrieben, der keine klar benennbare Handlung besitzt, sondern im Grunde eine 250-seitige Collage im hippen Reflexionssound über das Unbewusste der Populärkultur darstellt - und der dann doch etwas zu pathetisch an der unterhaltungsindustriellen Vortäuschung eines Ich-Upgrades leidet.
Die Protagonistin und Ich-Erzählerin namens Res (ja, wie "die Sachen") ist Kulturjournalistin wie ihre Autorin. Und sie hat seit Kindertagen ein musikalisches Idol, Frances Scott, in die zwar alle Megastars von den Beatles bis Beyoncé eingeflossen zu sein scheinen, aber die sich - bis hin zum eigenen Kinofilm - insbesondere mit Britney Spears identifizieren lässt, bezeichnenderweise ohne das markanteste Charakteristikum der Marquise von Oops, die Entmündigung, auch wenn ein unbotmäßiges Verhalten Frances', das Werbekunden verschreckt, durchaus eine Rolle spielt.
Der Moment, auf den Res insgeheim hingelebt hat, ist da: Sie darf ein Interview mit Frances Scott führen. Auch wenn die Rahmenhandlung bereits als rein innerliche gedeutet werden könnte, als quasi notwendiges Scheitern vor der Erfüllung der Sehnsüchte, eröffnet sie wenigstens die Chance, die folgenden, traumlogisch strukturierten Szenen an einen konkreten Auslöser rückzubinden. Res also hat im Hotelzimmer, wartend auf das Interview, aus Versehen mit nassen Händen in eine Steckdose gefasst. Sterbend gerät sie in einen letzten Rausch aus Erinnerungen und Hoffnungen, der sich als Strudel aus Verdichtung und Entblößung aller hedonistischen, aber wahnhaften ("delulu" stammt von "delusional") Versprechungen der westlichen Popkultur in ihrer großen, apolitischen Zeit erweist.
Der Clou des Buchs ist, dass die Heldin alles, was man gewöhnlich im Außen verortet, nun in sich selbst wiederfindet. Es geht also um Selbstbespiegelung, die über die außer Kontrolle geratene Selbstbespiegelung räsoniert, eine kybernetische Beobachtung zweiter Ordnung: "Denn wo immer Res hinsieht, sieht sie nur sich selbst." Erinnerungsfetzen zeigen eine allfällige Achtziger- und Neunzigerjahre-Kindheit inmitten der Eruptionen des Marketings (Haribo, Wrigley's, Kellogg's), eine Kindheit mit Walkman, Abschlussball und wuchtiger kulturindustrieller Programmierung. Hingerissen zeigt sich diese Res bis heute von den künstlichen Paradiesen, die einen Star wie Frances Scott umgeben: diese "Welt hinter dem Fernseher, wo sie alle leben in tiefsitzenden Hosen". Die Barbie-Lebensform der perfekten Oberfläche zu erreichen, wurde ihre beherrschende Sehnsucht: "Unsterblich wie Plastik, aber mit Sex, aber nicht als Mensch, sondern immer als Puppe".
In ihrem Fiebertraum bekommt Res dann doch noch ihr langes, über viele Stationen gehendes Interview. Es erfüllt sich scheinbar sogar ihr Wunsch, sich mit dem bewunderten Star zu befreunden. Doch Frances entzieht sich auch, wirkt keineswegs vom Glück geküsst, sondern gelangweilt, deprimiert. Mal gibt sie Plattitüden von sich, erwartete Sätze des professionellen Selbstmarketings, dann durchbricht sie den Schein: "Ich kann das alles nicht mehr. Ihr kommt hier nur hin, um zu glotzen." Wenn aber einmal die Illusion zerstört sei, dass Stars für das Publikum existierten, wenn ausgesprochen werde, dass da eigentlich Selbsthass am Werk sei, "fällt doch alles zusammen".
"Ich will an ihrer Seite der Realität verloren gehen", gesteht die Heldin der mitimaginierten Mutter des Stars. Seit Kindertagen sei sie davon überzeugt, eines Tages - wenn sie nur allen Merch gekauft habe - Frances zu werden: "It's what drives me. Insane." Mehr und mehr verliert sich Res schließlich in ihren Phantasien, verschmilzt tatsächlich mit Frances Scott, aber auch das unter Schmerzen, denn es bleibt lediglich die gemeinsame Ausflucht, das Zerreißen der Scheinwelt. Das alles ist ähnlich introvertiert und auch larmoyant wie Julia Frieses gesellschaftskritischer Mutterschaftsroman "MTTR" (2022), aber noch viel assoziativer und verspielter erzählt. Der schwache narrative Bogen und der poppig-apodiktische Ton erinnern an Blogs und Kolumnen im Netz. Eine Weile lang folgt man den tausenderlei Referenzen aufbietenden Gedankenpirouetten einer Glitzerpop-Versehrten ganz gerne, weil Friese fraglos schreiben kann, aber dann wird es doch zu viel, zumal der kulturkritische Ertrag trotz vielfacher Reformulierung überschaubar bleibt: Fallt nicht herein aufs Marketing!
Schon bei einer der ersten von Res imaginierten Begegnungen lässt Friese Frances sagen: "Alle denken, mich zu treffen, würde sie zu einem Teil von mir machen, als wären sie eine Tablette, die in meinem Wasser aufgelöst werden kann." Die Auratische warnt vor der Anziehung durch das Auratische. Es läuft immer auf eine bittere Einsicht hinaus: "Res ist eine Zuschauerin. Kein Main Character, keine Protagonistin." Die leider enervierend naive Heldin gibt sich - um den Preis der Selbstauflösung - trotzdem noch einmal dieser alten Illusion hin, aber viel mehr, als dass es eine Illusion ist, lernt sie dadurch nicht. Da sind die Swifties vermutlich schon weiter. OLIVER JUNGEN
Julia Friese: "delulu".
Der Roman.
Wallstein Verlag,
Göttingen 2025.
247 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.06.2025
Als läse man den Traum einer fremden Person. Teils absurde, teils schöne sprachliche Bilder, aber ohne Plot & Story machts keinen Spaß.
LovelyBooks-Bewertung am 05.04.2025
Hier ist Nix linear. Ein bisschen wie Ulysses
Dieses Frühjahr ist voller literarischer Crazyness. Ich habe den Eindruck, dass mich jedes 2. Buch auf die Probe stellt, ganz nach dem Motto: Bist Du schlau genug für diese Art der Lektüre? Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Autor*innen mich veräppeln oder herausfordern wollen - vermutlich beides. Auch Julia Friese, die mir mit MTTR ein Highlight beschert hat, scheint ein sehr besonderen Tee getrunken zu haben, während sie dieses Buch schrieb. So viel Alice im Wunderland, Joker und Britney Spears steckt in den 247 Seiten. Da hieß es für mich irgendwann nur los- und fallen lassen in einen Rausch, der weder Plot noch lineare Erzählkunst bietet.Okay. Also... delulu. Wo fang ich an? Wahrscheinlich am besten mit einem tiefen Seufzer. delulu ist kein Buch, das man "einfach so" liest. Die Geschichte beginnt damit, dass die Hauptfigur Res stirbt. Eigentlich will sie ihr großes Idol Frances Scott treffen. Doch eine nicht näher benannte Todesursache katapultiert uns mit ihr in einen Strudel, der psychedelischer nicht sein könnte. Wir sind plötzlich mitten im "Delir" - ja, das ist anscheinend so eine Art popkultureller Zwischenraum zwischen Leben und Tod, durchsetzt mit Memes, Filmtropen und absurden Gedanken. Klingt abgefahren? Ist es auch. Aber nicht auf die "Oh mein Gott, das hat mein Weltbild verändert"-Art, sondern eher wie ein wilder Insta-Feed, den man nachts um 2 durchscrollt und danach vergisst, was Realität war.Ich hatte beim Lesen ständig das Gefühl, irgendwas nicht zu kapieren - und das Buch hat sich auch NULL Mühe gegeben, mir zu helfen. Figuren tauchen auf, verschwinden wieder, Gedanken springen von Nostalgie zu Feminismus zu Fanfiction zu... Müsli? Ja, Müsli kam auch irgendwie vor. Oder war das nur in meinem Kopf?Die Sprache ist teilweise genial, dann wieder komplett wirr. Manche Sätze wollte ich markieren, andere hab ich fünfmal gelesen und dachte nur: Hä?! Es fühlt sich an wie ein literarischer Fiebertraum - und ich war leider nicht immer bereit, da mitzufiebern. "Rot gelackte Durian benachbart rot gelackte Ananas. Aus den großen Früchten brechen noch größere Lampenschirme, hauchdünn wie Briefpapier, aus denen sich Damen mit über die Schultern fallenden Pelz Zigaretten drehen, bevor sie auf zerbrechlichen Absätzen über den nassen Asphalt dahingehen." (S.50) Capice? Dann aber auch: "Die Bühne ist dem Kinderzimmer nachempfunden , indem ich meinen ersten Song geschrieben habe, also, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Das Kinderzimmer als Puderdose in glänzend Türkis und Sorbetgelb. Eine aufklappbare Spieldose in deren unteren Becken der Ozean liegt." (132)Toll!Man könnte sagen, delulu ist wie Ulysses von James Joyce - aber mit Internetzugang und Popkultur-Trauma. Beide Bücher lassen einem das Gehirn auf halber Strecke verdampfen, beide ignorieren sowas wie klare Handlung komplett. Joyce läuft halt in Dublin rumläuft und sinniert in Form von inneren Monologen, Res hingegen schwebt durch ein surreal-digitales Jenseits, das eher nach Flower Power 2014 klingt als nach literarischem Kanon. Wenn Ulysses die Bibel des literarischen Bewusstseinsstroms ist, dann ist delulu das Meme davon - mit Glitzerfilter. Julia Friese nennt es ein Requiem auf eine vergangene Zeit. Was man dem Buch aber wirklich lassen muss: Es ist vollgestopft mit kulturellen Referenzen - also so richtig. Es ist, als hätte jemand eine endlose Popkultur-Playlist auf Shuffle gestellt und den Stream direkt ins Buch kopiert. Von Britney über Abbey Road bis zu Zehner-Jahre Ästhetik und schiefen Trends ist alles dabei. Wer da nicht mindestens drei Online-Leben gelebt hat, bleibt öfter mal ratlos zurück. ich hab irgendwann aufgegeben den Spuren zu folgen, dazu waren es einfach zu viele. Aber genau das scheint auch Teil des Konzepts zu sein: Res existiert in einem Zwischenraum, in dem Identität, Erinnerungen und kulturelle Prägungen zu einem einzigen, flirrenden Brei verschwimmen. Das ist clever - theoretisch. Praktisch ist's manchmal, als würde man einen Inside-Joke lesen, bei dem man den Ursprung nie mitbekommen hat.Wer auf stringente Storys steht oder klare Charakterentwicklungen braucht, wird hier auf halber Strecke verloren gehen. Wer aber Lust auf ein total verrücktes, überdrehtes Gedankenexperiment hat - go for it. Ich werde mich auf jeden Fall nicht direkt dem neuen Kracht zuwenden, sondern brauch jetzt erstmal was mit einem deutlichen Plot. Meine Rezensionen geben immer ehrlich meine eigene Einschätzung wieder, unabhängig davon, ob ich das Buch selbst gekauft habe oder es mir vom Verlag oder den Autoren zur Verfügung gestellt wurde









