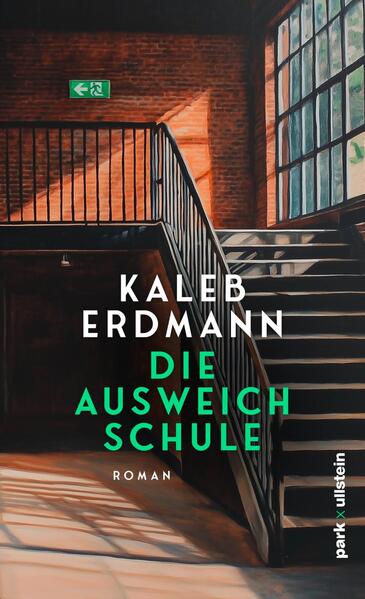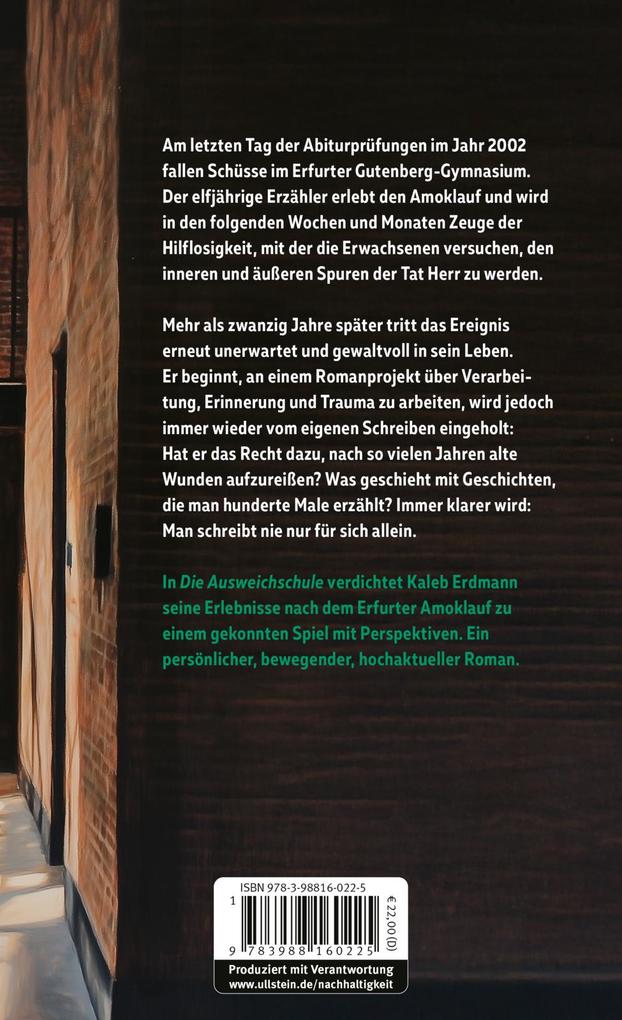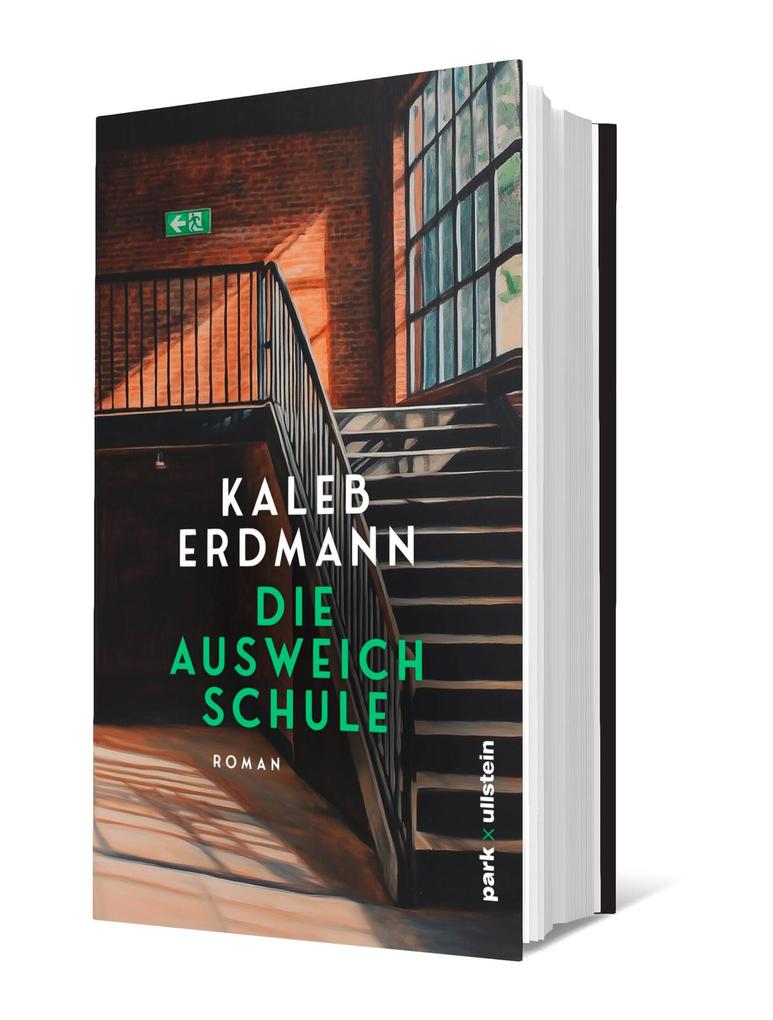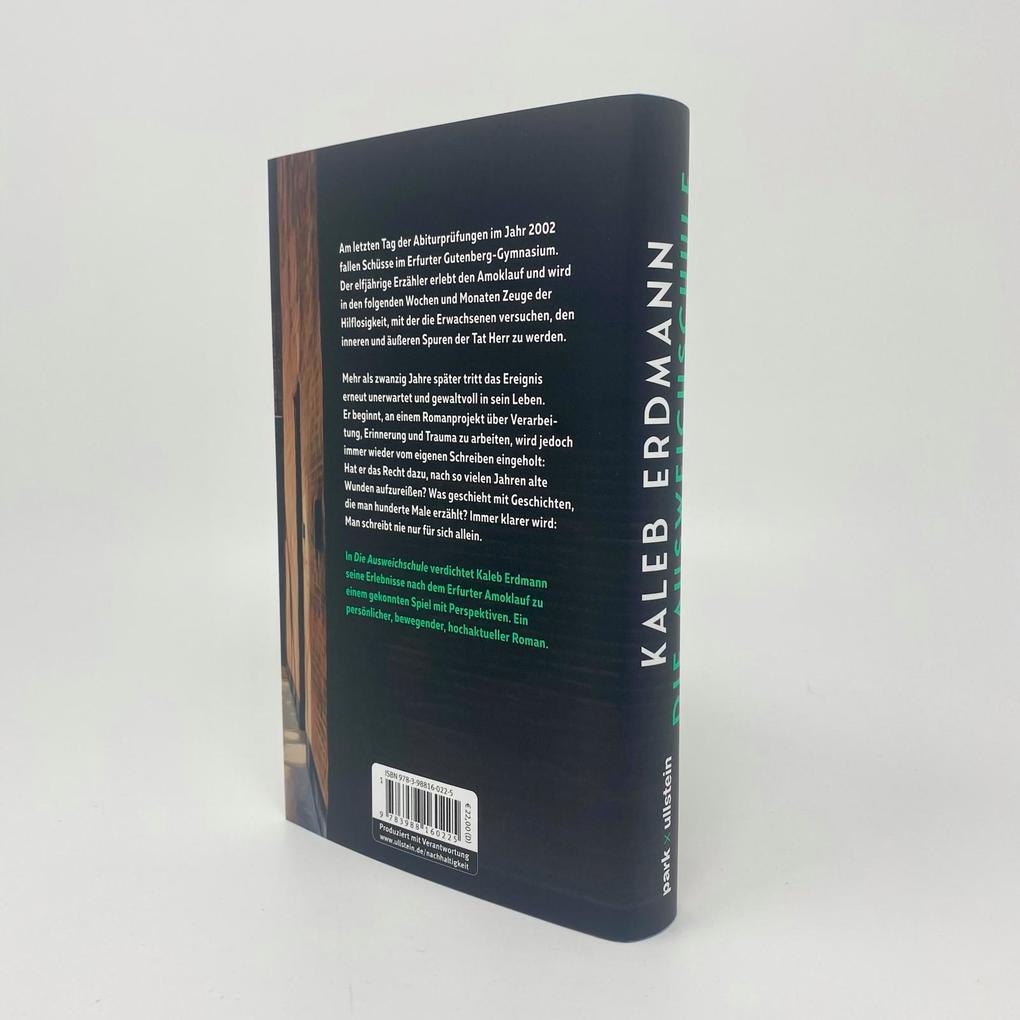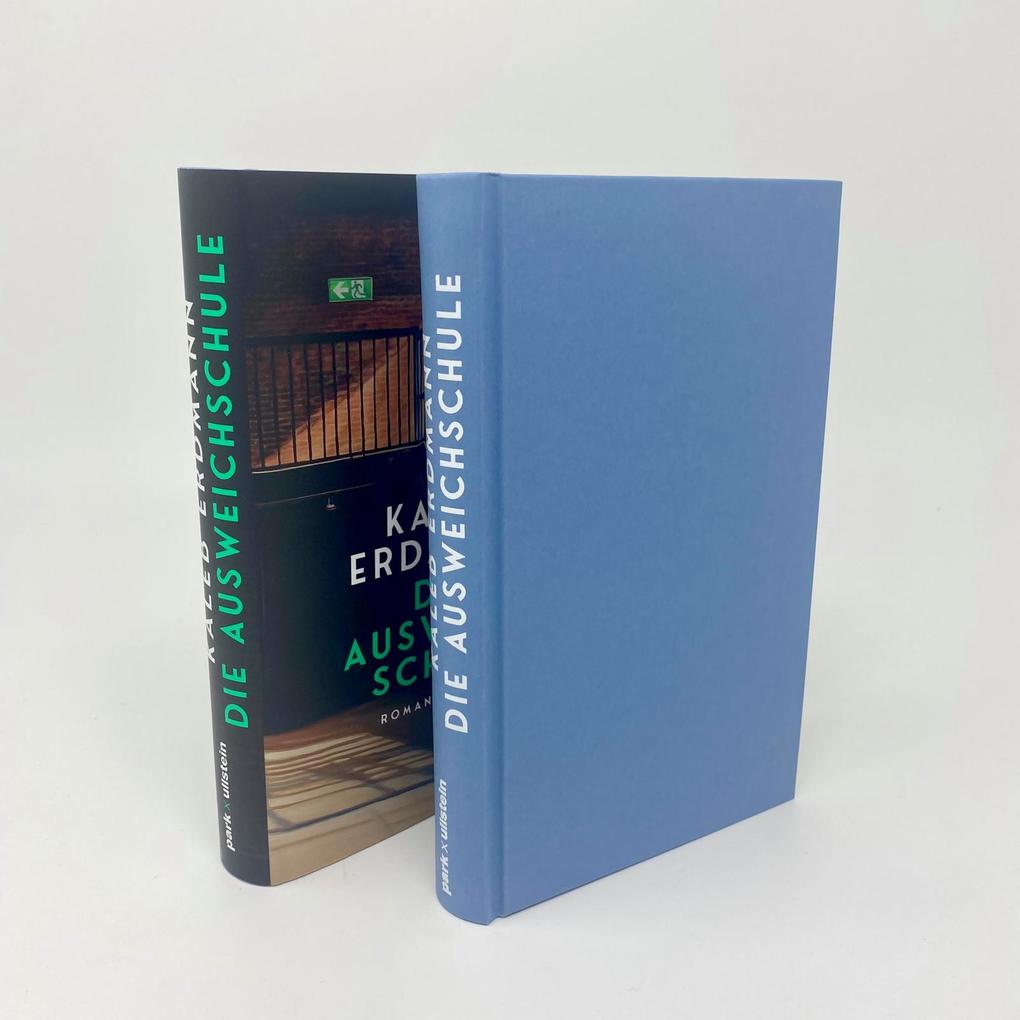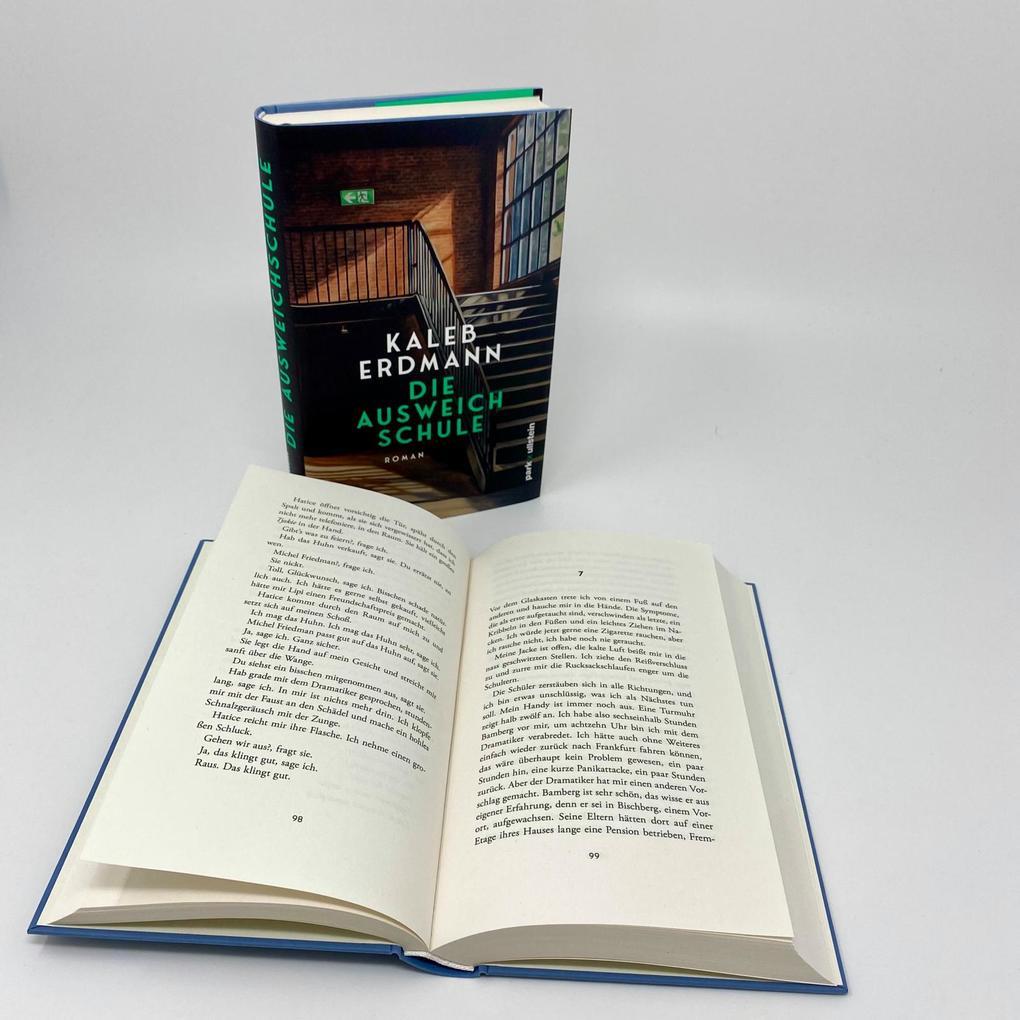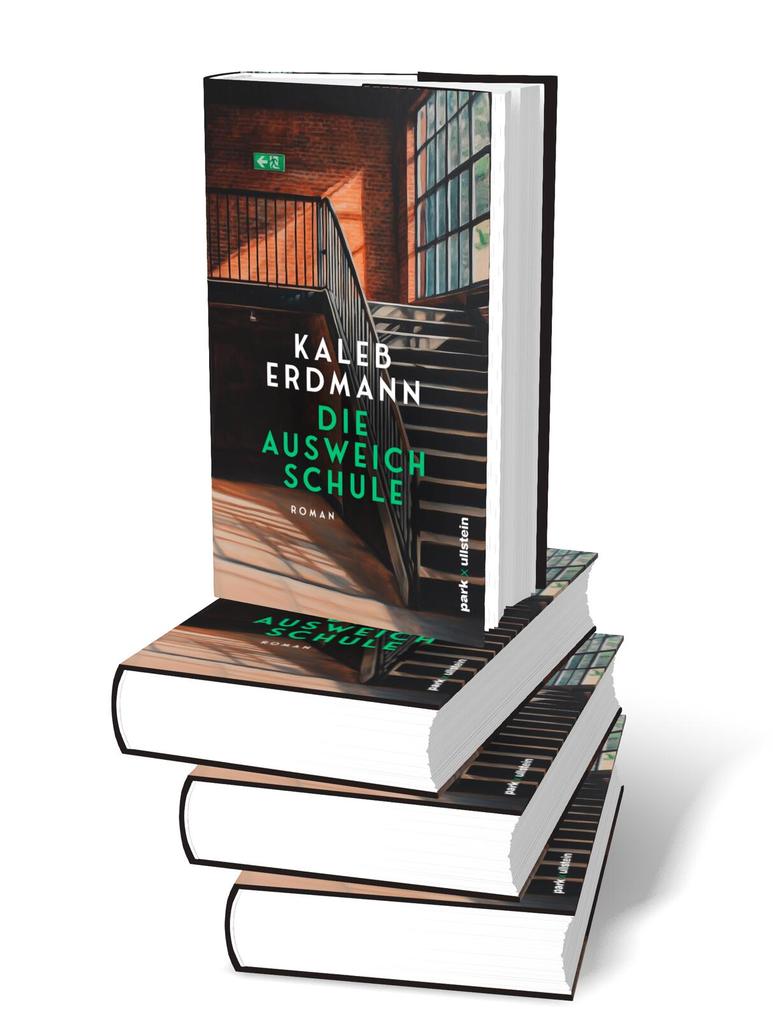Besprechung vom 21.07.2025
Besprechung vom 21.07.2025
Die Schule, das Trauma und der Text
In Kaleb Erdmanns "Die Ausweichschule" ringt ein Autor mit seinem Stoff. Der Erzähler hat als Elfjähriger den Amoklauf von Erfurt überlebt. Das fesselnde Hörbuch fragt, wie man über das Böse schreiben kann.
Immer wieder greift der Ich-Erzähler zu Emmanuel Carrères "Der Widersacher". Er ist ein Fan des französischen Autors, hat jedes Interview mit ihm gelesen und kennt alle Details. Wie sich dessen frühe Romane gnadenlos auf ein schreckliches Finale zubewegen und warum Carrère in seinem Buch über den Hochstapler Jean-Claude Romand erstmals eine wahre Geschichte behandelt. Der Franzose hatte Freunde und Familie jahrelang getäuscht, indem er vorgab, bei der WHO in Genf zu arbeiten, während er in Wahrheit ein Lügengebäude errichtet hatte. Als alles aufzufliegen drohte, erschlug Romand zuerst seine Frau, tötete tags darauf seine Kinder und am dritten Tag seine Eltern. Die Weltöffentlichkeit rieb sich damals die Augen ob der Monstrosität dieses Verbrechens. Carrère aber suchte den Kontakt zum Täter im Gefängnis, um über ihn zu schreiben. Doch es gelang ihm nicht, bis er schließlich aufgab. Er verfasste eine Notiz über sein Scheitern, die immer länger wurde, bis er begriff, dass dies sein Buch werden würde. Ein Text über Carrères Konflikt mit sich und seiner Scham, von dieser bestialischen Tat fasziniert zu sein.
Dass Kaleb Erdmann in seinem zweiten Roman "Die Ausweichschule", der am 31. Juli als Buch und Hörbuch erscheint, immer wieder auf Carrère zu sprechen kommt, wie auch auf andere Autoren, die sich mit Gewalt beschäftigt haben - Ines Geipel, Herta Müller, Leïla Slimani und einen namenlosen Dramatiker -, verdankt sich der faszinierenden Machart dieses Metaromans. Denn auch Erdmanns Erzähler ist ein Autor, der wie Carrère mit seinem Stoff ringt. Dieser Stoff ist jedoch nicht angeeignet, sondern wurde vor mehr als zwanzig Jahren von ihm selbst durchlebt. Als Fünftklässler hat er am Erfurter Gutenberg-Gymnasium das Attentat von Robert Steinhäuser überlebt.
Der von der Schule verwiesene Abiturient war im April 2002 in seine ehemalige Schule eingedrungen, hatte 71 Schüsse abgefeuert und 16 Menschen ermordet, ehe er im Treppenhaus von seinem ehemaligen Geschichtslehrer aufgehalten wurde, der ihn aufforderte, ihm beim Töten in die Augen zu schauen, woraufhin Steinhäuser entgegnete "Für heute reicht's".
Wie "Der Widersacher" ist auch dieser aufwühlende Roman mit dem prosaischen Titel "Die Ausweichschule" ein Buch mit zwei Ebenen. Einerseits wird über Steinhäuser und seine monströse Tat erzählt, jedoch immer nur indirekt und vermittelt, etwa durch Gespräche mit dem Dramatiker, der aus dem Stoff so leichthändig ein Theaterstück verfasst hat, dass es den Ich-Erzähler schaudert. Oder er studiert den Gasser-Bericht, der auf 371 Seiten die Vorgänge vor und während der Tat minutiös rekonstruiert, wobei doch viele Fragen unbeantwortet bleiben. Auch die Geschichte der damals einzigen Traumatherapeutin in ganz Thüringen, die später die vielen Fehler nach dem Amoklauf beklagen sollte, die aus Unwissen oder mangelndem Willen gemacht wurden, kreist um die Tat. Der Mittdreißiger ist seit seiner Kindheit selbst in Therapie. Er weiß, dass Traumabewältigung nicht bedeutet, zu trauern, "nicht mal, mit Trauer umzugehen", sondern dass es einzig darum geht, wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Auf der anderen Ebene handelt der Roman von den Plänen, Gedanken und Zweifeln des Ich-Erzählers: Vierzig offene Tabs "hängen wie schwarze Trauben" über der Adresszeile seines Computers, die Titel tragen wie "Steinhäuser", "Gutenberg-Gymnasium", "Opfer", "Taliban", "Glock 17", "Mossberg 590", "Waffengesetz Thüringen", "Gedenktafel", "Wie Trauma erkennen" oder "Dom": Er sieht die Dateien und klappt den Laptop wieder zu.
Der deutsch-französische Schauspieler Pascal Houdus findet für die dialogische Struktur des Romans, die vielen Gespräche und Selbstgespräche, die passenden Nuancen. Selbst dass der Roman nicht chronologisch erzählt, sondern Orte und Zeiten unentwegt wechseln, was für eine Lesung eine Herausforderung ist, meistert er so gekonnt, dass wir ihm mühelos folgen können von der Kindheit in die Gegenwart, von Frankfurt nach Erfurt, München, Prag, ins Elsass und nach Bamberg.
In Frankfurt versucht der hadernde Autor mit seiner Freundin den Alltag zu meistern, doch sein Romanprojekt macht ihn nervös. Sich der gewaltvollen Geschichte anzunehmen, kommt ihm zunehmend anmaßend vor, während Hatice gerade ihre erste eigene Ausstellung kuratiert und mit sich selbst genug zu tun hat. Und dann ist da noch Frau Czerny, die Therapeutin, die dem Ich-Erzähler beibringt, innere Listen zu erstellen, wenn alles zu viel wird. Seine Liste besteht aus Ländern mit kleinen Hauptstädten. Am Ende des Romans werden viele dieser Länder genannt worden sein.
Das Romanprojekt, von dem "Die Ausweichschule" erzählt, trägt den Titel "Unterm Herrenberg" und wird bald selbst zu einem Ausweichroman. Vor lauter Skrupeln, in die Falle zu tappen und dem Voyeurismus zu erliegen, flüchtet sich der Autor auf Nebenschauplätze und sucht in Ausweichmanövern den dunklen Kern der Tragödie zu umschiffen, um stattdessen von dem Jungen zu erzählen, der er einmal war und der mit 700 anderen Schülern nach dem Amoklauf in eine "Ausweichschule" ausgelagert wurde. So erzählt dieser faszinierende Roman von einem letztlich gescheiterten Projekt eines Schriftstellers, das seine Höllenfenster geöffnet hat - eben darin liefert Kaleb Erdmann eine kluge und bewegende Reflexion über die Macht und die Ohnmacht von Gewalt und Literatur. SANDRA KEGEL
Kaleb Erdmann:
"Die Ausweichschule". Roman.
Gelesen von Pascal Houdus. Hörbuch Hamburg, Hamburg 2025. Digital, 383 Min., 18,95 Euro. Erscheint zeitgleich mit dem Buch (park x ullstein Verlag) am 31. Juli.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.