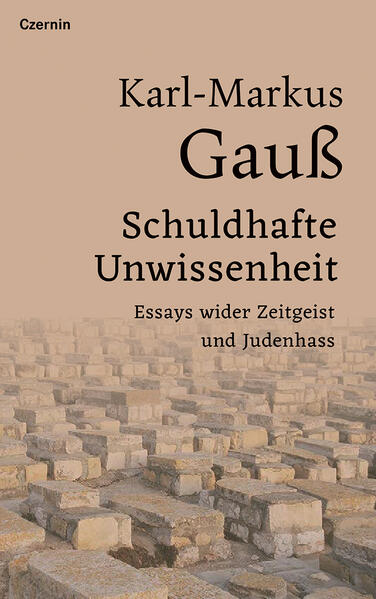
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Daniela Strigl, Laudatio zum Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung
"Erzählung, Reflexion, Erinnerung, Polemik, Wu rdigung, Analyse, Notat, Attacke, Trost eine eigene Form: das Gaußische, der facettenreiche Idealessay."
Robert Menasse
 Besprechung vom 15.08.2025
Besprechung vom 15.08.2025
Vom Willen, nichts wissen zu wollen
Antisemitismus von links: Karl-Markus Gauß widmet sich in seinen "Essays wider Zeitgeist und Judenhass" nicht zuletzt der Ausweitung judenfeindlicher Haltungen.
Es ist ein Buch zur Unzeit, doch ebendarum pünktlich erschienen. Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß, ein Großmeister des literarischen Essays, schreibt in seinem jüngsten Band gegen "Schuldhafte Unwissenheit" - so der Titel - an. Damit meint er eine Ignoranz, die den Zugang zu Bildung hat, aber es vorzieht, sich von Tatsachen nicht beirren zu lassen. Es sind "Essays wider Zeitgeist und Judenhass", die er vorlegt.
Gleich im ersten Text geht er jenem Entsetzen nach, das ihn zu diesem Werk trieb. "Das umjubelte Massaker" ist es, von dem Gauß spricht, wobei es weniger die unmittelbaren Gräueltaten der Dschihadisten sind, denen er in seinen "Anmerkungen zum 7. Oktober" nachspürt. Ihn beschäftigt die Begeisterung jener, die angesichts des Massenmordens sogleich auf die Straßen gingen, um ihren Hass auf Israel zu bekunden. Nicht in der Kritik an der konkreten Politik der Jerusalemer Regierung sieht er ein Problem, denn es geht ihm nicht darum, Premierminister Benjamin Netanjahu oder seine rechtsextremen Koalitionspartner zu verteidigen. Er beschönigt auch nicht das Leid der Menschen in Gaza.
Aber Gauß zeigt auf, was hinter der Hetze gegen das schiere Dasein des Judenstaates steckt, wenn etwa die Israelis aufgefordert werden, sie alle - auch jene, die aus Bagdad, Alexandria oder Aleppo einst flohen - mögen gefälligst nach Polen zurückkehren. Wovon Gauß schreibt, ist offensichtlich. Warum sonst werden weltweit Slogans gegen Israel just auf koschere Lokale, auf Synagogen oder jüdische Kulturzentren geschmiert? Wie sollte es anders erklärt werden, wenn anlässlich von antisemitischen Gewalttaten, die sich gegen fromme Orthodoxe in der Diaspora oder gegen jüdische Veranstaltungen richten, Parolen gegen den Judenstaat gerufen werden?
Was da außerhalb Israels losbrach, setzte nicht erst ein, nachdem die israelische Armee mit jenen Gegenschlägen begonnen hatte, denen, wie Gauß zu Recht feststellt, "seither entsetzlich viele Zivilisten in Gaza zum Opfer gefallen sind", sondern flammte unmittelbar nach dem dschihadistischen Überfall am 7. Oktober auf. Gauß stellt dazu fest: "Einige Wochen vor dem Massaker der Hamas wurde ich gefragt, womit der Antisemitismus am leichtesten angeheizt werden könne. Heute müsste ich antworten: indem man möglichst viele Juden massakriert."
Das Leid der Opfer, so Gauß, sei von vielen negiert worden. Er präzisiert: "Zu Tätern wurden die Juden nicht erklärt, als sie massakriert wurden, sondern weil sie massakriert wurden. Denn nichts stärkt den Hass auf Juden so sehr wie ihre Verfolgung." Das sei ein Phänomen, das nicht nur bei Juden zu beobachten sei. Auch die Welle der Gewalt gegen Roma im Ungarn der Jahrtausendwende habe nicht zu mehr Mitgefühl geführt, sondern die antiziganistische Raserei nur weiter angestachelt.
Was Gauß vor allem erschüttert, ist hingegen, dass er diese einschlägigen Ressentiments gegen souveräne jüdische Existenz nicht alleinig bei jenen vorfindet, die immer schon dem klassischen Antisemitismus anhingen, also nicht etwa bei rassistischen Rechtsextremen, sondern ebenso in jenem politischen Lager, dem er selbst angehört. Unter linken Intellektuellen stößt er auf eine Uneinsichtigkeit, die nicht wahrnehmen möchte, worauf der islamistische Terror abzielt. Es ist dieses Phänomen, das Gauß umtreibt und dem er in dem Band auf den Grund geht.
Er erinnert, wie begeistert der französische Philosoph Michel Foucault angesichts der iranischen Revolution des Ajatollah Ruhollah Khomeini war. Foucault schwärmte von jener Massenbewegung, die das Regime des Schahs, des Verbündeten der USA, hinwegfegte. Er rühmte die "politische Spiritualität" der islamistischen Ideologie, und diese Faszination ließ ihn hinwegsehen über die Schrecken der islamischen Republik. Er schwieg, als die Mullahs gegen jene Liberalen und Linken losschlugen, die noch vor Kurzem mit ihnen gemeinsam gegen die Monarchie von Reza Pahlewi rebelliert hatten.
Michel Foucault ist längst verstorben, doch in vielen innerhalb der Linken lebt die Neigung fort, im Islamismus eine progressive Kraft zu sehen. Da im eigenen Land kein revolutionäres Subjekt zu erkennen ist, verführt die Sehnsucht nach einer gesellschaftlichen Umwälzung nicht wenige innerhalb der radikalen Linken dazu, in den dschihadistischen Massenmördern die Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit und Gleichheit auszumachen.
Der antisemitische und totalitäre Charakter der Hamas wird dabei abgestritten. Die Massaker des siebenten Oktober werden beschönigt. Die Verbrechen sind durch die Videos der Täter zwar belegt, doch sie werden von so manchen, die gegen Israel hetzen, bestritten. Die Vergewaltigungen wurden durch Überlebende bezeugt und sind aufgrund forensischer Analysen auch mehrfach bewiesen, aber sie wurden dessen ungeachtet in Zweifel gezogen.
Erinnert diese Leugnung der Verbrechen etwa nicht auch an die "Auschwitzlüge"? Gemahnt diese Borniertheit nicht an die Weigerung, die Erkenntnisse der Wissenschaft zur Corona-Pandemie anzuerkennen?
Gauß schreibt: "Sie wissen von nichts, das macht sie so unbeirrbar. Sie haben keine Ahnung, daraus beziehen sie ihre Überzeugung. Ihre Unwissenheit darf man ihnen nicht nachsehen, denn sie ist selbstverschuldet." Das seien nicht sozial Unterprivilegierte, betont Gauss, sondern studentische Bewegungen an elitären Privatuniversitäten und renommierte Intellektuelle wie etwa Judith Butler, die das Massaker der Hamas zum Akt des Widerstands verklärte.
Das Buch ist auch als Hommage an Jean Améry zu lesen, der bereits früh vor dem "ehrbaren Antisemitismus" warnte. Der Antisemitismus sei "im Anti-Israelismus oder Anti-Zionismus wie das Gewitter in der Wolke" enthalten, hatte Améry 1969 befunden.
Karl-Markus Gauß belässt es indes nicht bei der Polemik gegen den Hass auf Juden. Er setzt der schuldhaften Unwissenheit Betrachtungen entgegen, die jene Hintergründe des Konflikts erhellen, die aus dem Blickfeld vieler geraten sind. So präsentiert er uns ein "Epitaph auf das Schtetl", erzählt darin vom Schriftsteller Grigori Kanowitsch und zeigt auf, wie notwendig das Gedenken bleibt, wenn die Konservativen der Alpenrepublik zu Koalitionen mit Rechtsextremen bereit sind. Er spürt den österreichischen Wurzeln des Theodor Herzl nach. Er schildert den Kampf gegen die Geschichtslügen in Polen, und in einem eigenen Abschnitt stellt Gauß uns zwei Wiener Juden vor, die in den Zwanzigerjahren Europa verließen, um im Orient sich zu finden - der eine ist Poldi Weiss, der als Muhammad Assad der erste pakistanische Botschafter an der UNO in New York werden sollte, der andere hieß Eugen Hoeflich, ehe er zu Moshe Ja'akov Ben-Gavriel wurde und als Linkszionist von einem jüdisch-arabischen Sozialismus im Nahen Osten träumte.
Die verschiedenen Texte sind jeder für sich ein Lichtblick, aber gemeinsam leuchten sie jene Vergangenheit aus, die in der Debatte rund um den Konflikt im Nahen Osten zu kurz kommt. Gauß begeht dabei nie den Fehler, zum bloßen Apologeten israelischer Regierungspolitik zu verkümmern. Er scheut nicht davor zurück, die Kriegsführung Jerusalems infrage zu stellen: "Wann wird aus Verteidigung Vergeltung und aus Vergeltung Verbrechen? Wenn der Feind dem Hunger preisgegeben wird, wenn er vertrieben wird, wenn ihm die materiellen und territorialen Grundlagen seiner Existenz entzogen werden?" Auch diese Erörterungen sind es, mit denen er den Unterschied zwischen politischer Kritik und einschlägigem Ressentiment aufzudecken vermag. DORON RABINOVICI
Karl-Markus Gauß: "Schuldhafte Unwissenheit". Essays wider Zeitgeist und Judenhass.
Czernin Verlag,
Wien 2025.
128 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Schuldhafte Unwissenheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









