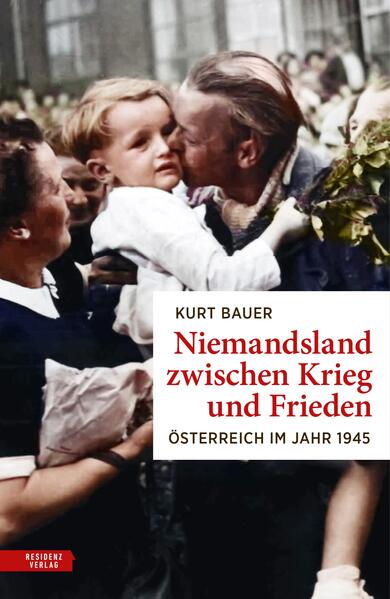
Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Frühjahr 1945: Österreich wurde zwischen den vorrückenden Armeen der alliierten Mächte für ungewisse Zeit in ein politisches Niemandsland verwandelt. Es herrschten Chaos, Hoffnung und Angst. Kurt Bauer beschreibt die unterschiedlichen Schicksale und Erfahrungen der Menschen in diesem turbulenten Jahr anhand von Alltagsgeschichten. Er erzählt von dem Wehrmachtssoldaten, der auf verschlungenen Pfaden in die Heimat zurückgelangt; von dem jüdischen Emigranten des Jahres 1938, der nach seinem erzwungenen Exil als Soldat der siegreichen Armee seine Heimatstadt wiedersieht, aber das alte Wien seiner Kindheit nicht mehr findet; von der jüdischen Frau, die den Krieg in Wien überlebt hat und nun so rasch als möglich in die USA will . . . Ein facettenreiches und packendes Buch.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
270
Autor/Autorin
Kurt Bauer
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
530 g
Größe (L/B/H)
221/146/37 mm
ISBN
9783701736317
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 27.05.2025
Besprechung vom 27.05.2025
"Es ist Krieg, da ist alles erlaubt"
Flucht vor den Russen, Vergewaltigungen und Fischen mit Handgranaten: Das Jahr 1945 in Österreich
Der österreichische Historiker Kurt Bauer ist, was Status und Werdegang betrifft, eher ein Außenseiter in der akademischen Zunft. Er lernte Schriftsetzer, ehe er an der Universität Wien sein Geschichtsstudium mit einer Dissertation über den nationalsozialistischen Putsch im Juli 1934 ablegte, und ist nicht an einem Lehrstuhl, sondern freiberuflich tätig. Vielleicht gelingt es ihm gerade deshalb immer wieder, ohne Rücksichtnahmen liebevoll gepflegte Mythen zu entkleiden. So etwa mit einer Studie über den nationalsozialistischen Putsch im Juli 1934 gegen das in Wien regierende Dollfuß-Regime, das auf der Linken gerne als "Austrofaschismus" bezeichnet wird. Oder mit einem Büchlein über den sozialdemokratischen bewaffneten Aufstand fünf Monate zuvor.
Bauers neues Buch über Österreich im Jahr 1945 hat einen etwas anderen Charakter. Es ist nicht eine historische Studie und auch keine historische Analyse durch den Autor, sondern so etwas wie eine nacherzählende Dokumentation. Man findet darin keine quellenkritische Darstellung von Ereignissen. Für die politische und militärische Geschichte der letzten Kriegsmonate in Österreich ist immer noch das aus den 1980er-Jahren stammende, 2015 nochmals aufgelegte Werk von Manfried Rauchensteiner maßgeblich. Trotzdem gewinnt der Leser hier womöglich einen besseren Einblick in das, was den Menschen in jenem Jahr "zwischen Krieg und Frieden" widerfahren ist, als in so manchem Kompendium voll archivalischer Belege.
Der Autor hat Erinnerungstexte von zwei Dutzend Zeitzeugen ausgegraben und ihre Schilderungen der Ereignisse des Jahres von Kriegsende und Neuanfang gerafft und mit eigenen Worten wiedergegeben. Die Vorlagen sind teils bereits publiziert, zum größeren Teil aber Manuskripte, die in der "Doku Lebensgeschichten" am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien oder im niederösterreichischen Landesarchiv vorliegen oder dem Autor privat vermittelt wurden.
Da finden sich ein paar Namen, die einer größeren Allgemeinheit bekannt sind, etwa der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann oder des Schoa-Überlebenden Marko Feingold. Auch Personen, die in der Nachkriegszeit politisch, im Staatsdienst oder publizistisch tätig waren wie Josef Schöner, unter anderem Botschafter in Bonn, Karl Pisa, in der ÖVP und als Journalist tätig, oder der niederösterreichische Landesamtsdirektor Hans Vanura. Aber die meisten von denen, deren Schilderungen Bauer in seinem Buch nacherzählt, sind Leute, die nicht oder nur in ihrer engeren Region in die Öffentlichkeit getreten sind.
Die Berichte sind durch Bauer aufgestückelt worden, um sie in die vier Jahreszeiten von 1945 zu gliedern. So eine Chronologie hat etwas für sich. Der Preis ist eine gewisse Unübersichtlichkeit. Man muss immer mal wieder hin und her blättern. Sind wir dieser oder jenem schon mal begegnet? Wer war das gleich? Es gibt hinten im Buch neben einer ereignisgeschichtlichen Chronik, den Quellen und Anmerkungen auch eine Aufstellung der Protagonisten, die im Buch (durch die Stimme Bauers) zu Wort kommen, samt ihren Kurzbiographien. Da lohnt es sich, ein Lesezeichen hineinzulegen.
Wir erfahren also zum Beispiel vom burgenländischen Bauernsohn und Volksschullehrer Alexander Unger, knapp vierzig Jahre alt, den im Januar 1945 das bisherige Kriegsglück verlassen hat, eine Granate erwischte ihn in den Ardennen. Die Fahrt in einen zehntägigen Heimaturlaub zur Genesung und zurück zur Truppe quer durch das im Chaos versinkende Reich ist eine einzige Odyssee. In den letzten Kriegstagen schwankt er, von Gerüchten und Sorgen getrieben, wendet sich mal nach Westen, um den Russen zu entgehen, mal nach Osten, um möglichst nah bei der Familie zu sein. Seine Verwundung gereicht ihm dann zum Glück, er wird in ein Spital gewiesen und deshalb von der Roten Armee nicht gefangen genommen. Nach Hause zurückgekehrt, erfährt er dann, wie einige weibliche Verwandte "furchtbar gequält" worden seien - die Entsetzlichkeiten kann man sich ausmalen. Dann holt ihn die eigene Vergangenheit ein: Schon vor dem "Anschluss" hatte er sich in einer NS-Vorfeldorganisation betätigt, wurde nach 1938 Parteimitglied, mit lokalen Funktionen. Jetzt wird er deswegen vom Schuldienst ausgeschlossen - das entsprechende Verfassungsgesetz der in Wien bereits errichteten Regierung Renner über das Verbot des Nationalsozialismus wurde schon am 8. Mai erlassen. "Die Empörung über diesen Vorgang ist Unger noch in seinen Jahrzehnten später verfassten Erinnerungen anzumerken." Von der sowjetischen Besatzungsmacht wird Unger immer wieder zu Zwangsdiensten herangezogen, weil er ein ehemaliger Nazi ist: Holz schlagen oder Gefallene umbetten.
Oder Gertrud Maurer, sechzehn Jahre alte Tochter eines Gymnasiallehrers aus Baden bei Wien. Ihre Familie, das heißt die Frauen der Familie, flüchten im April in Richtung Westen, als die Kunde von den herannahenden Russen verbreitet wird. Eine abenteuerliche Flucht mit einem vollgestopften Bus, mit noch stundenweise verkehrenden Zügen oder auch Fußmärschen bringt sie tatsächlich zu ihren Verwandten im oberösterreichischen Maria Schmolln. Tiefflieger sind eine Gefahr, man spricht aber auch von "polnischen Plünderern", wohl freigekommenen Zwangsarbeitern. Die 120 Amerikaner, die dann in Maria Schmolln einquartiert werden, sind kein Schrecken, außer dass sie im Dorfteich mit Handgranaten "fischen". Die Lehrerstöchter sprechen mit ihnen Englisch, daraufhin kommen sie am Abend mit Cognac.
Erschütternd sind hingegen die zahllosen bezeugten Schicksale von Frauen und Mädchen fast jeden Alters im Osten, wo die Rote Armee einmarschiert. Im April notiert der Pfarrer der Weinbaugemeinde Prottes in seinem Tagebuch: "Im Pfarrhof waren um die zwanzig Personen untergebracht. Ich ging die einzelnen Gruppen besuchen und sah den Jammer der verängstigten und bereits bis zur Unkenntlichkeit hergenommenen Frauen und Mädchen. Gerade die jüngeren wurden oft bis zu zwanzigmal in einer Nacht vergewaltigt. Es gelang mir, bis zum Kommandanten in Kleinprottes vorzudringen, um ihn um Abhilfe zu bitten. Vielleicht könnte man einen Posten vor die Gruppen stellen. Der hatte nur ein Lächeln und Achselzucken: 'Es ist Krieg und Front, und da ist alles erlaubt.' So musste ich wieder abziehen." Diese Art Schilderungen ziehen sich durchs ganze "Frühjahr"-Kapitel.
So hat Bauer Zeitzeugnisse aus den verschiedensten Perspektiven zusammengestellt: Von Soldaten und Zivilisten, Frauen und Männern, NS-Parteimitgliedern, Widerständlern und jüdischen Schoa-Überlebenden, Bauern und Gymnasiallehrern. Durch die Stilform der Nacherzählung gewinnt die Komposition an Einheitlichkeit und Kompaktheit. Aber es ist auch der Verlust an Unmittelbarkeit spürbar, das ist die unvermeidliche Schwäche dieses Konzepts. STEPHAN LÖWENSTEIN
Kurt Bauer: Niemandsland zwischen Krieg und Frieden. Österreich im Jahr 1945.
Residenz Verlag, Wien 2025. 272 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Niemandsland zwischen Krieg und Frieden" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









