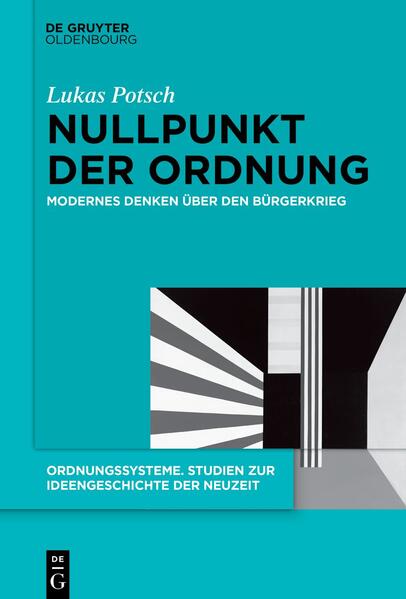Besprechung vom 06.11.2025
Besprechung vom 06.11.2025
Machtkampf im Inneren
Lukas Potsch sieht sich an, wie der Begriff des Bürgerkriegs seit der Frühen Neuzeit gefasst wurde
Dass Krieg nicht gleich Krieg ist, weiß man, wenn man sich damit etwas genauer beschäftigt hat. Aber sobald man mit Unterscheiden und Sortieren beginnt, gerät man in Probleme, und das gilt selbst für die Basisunterscheidung zwischen innergesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Kriegen. Diese Unterscheidung setzt den Staat als Monopolisten des Politischen voraus - aber von welchem Zeitpunkt an haben wir es mit einem Staat und bis wann mit einer vorstaatlichen Ordnung zu tun? Je genauer man sich die Details der beiden Kriegsdefinitionen ansieht, desto verwirrender wird das Bild, das man vor sich hat, und desto mehr sieht man sich zu Zusatzannahmen gezwungen, die zwar die Probleme der Nahbetrachtung relativieren, aber den transhistorischen Blick verwirren. Offenbar hängt alles vom Abstand ab, den man zu den in Rede stehenden Kriegen hat. Doch dieses Zugeständnis macht die Sache auch nicht besser.
Lukas Potsch, ein inzwischen an der Universität Marburg tätiger Ideenhistoriker und Soziologe, ist das Thema des Bürgerkriegs so angegangen, dass er die Zeitspanne, in der vom Bürgerkrieg gesprochen werden kann, radikal verkürzt und sie erst mit dem Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit beginnen lässt. Das ist für das Mittelalter, in dem die räumliche Abgrenzung eines politisch geordneten Raumes zumeist unklar war und sich kaum entscheiden ließ, ob man es mit einem Aufstand oder legitimem Widerstand gegen unberechtigte Vorgaben zu tun hatte, und in dem es obendrein das Rechtsinstitut der Fehde gab, unmittelbar einsichtig. Sehr viel schwieriger ist das hingegen im Fall der Antike, von den inneren Kämpfen in den griechischen Stadtstaaten, die als stasis bezeichnet wurden, bis zum uns auch terminologisch geläufigen "römischen Bürgerkrieg" des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. Nicht nur weil wir diese Konflikte ganz selbstverständlich mit dem Bürgerkriegsbegriff bezeichnen, sondern weil auch die Theoretiker des frühneuzeitlichen Staates auf die inneren Kriege der Antike immer wieder Bezug genommen, sich der Probleme ihrer Gegenwart durch eingehende Beschäftigung mit den Analysen antiker Autoren vergewissert haben. Ihre Antwort auf die Herausforderung der Gegenwart wäre ohne Anleihen bei den Theoretikern der Antike nicht möglich gewesen.
Dennoch ist Potschs Herangehensweise, die Beschäftigung mit dem Bürgerkrieg erst mit der Entstehung des frühneuzeitlichen Staates zu beginnen, sinnvoll und hat einen beachtlichen Ertrag: Seit den Konfessionskonflikten der Frühen Neuzeit wird der Machtkampf im Inneren einer politischen Ordnung nicht mehr als Messen der Kräfte im Innern einer Ordnung begriffen, was als Ausscheidungswettbewerb der Tüchtigsten und Leistungsfähigen angesehen werden kann, wie noch bei Machiavelli der Fall, somit als eine Selbstertüchtigung des Gemeinwesens, das sich fit macht für eine Expansion nach außen, sondern als, wie Potsch es nennt, "Nullpunkt der Ordnung", als Ausgangspunkt für die Neuerrichtung einer politischen Ordnung, deren Zweck und Aufgabe darin besteht, die Rückkehr der Unordnung verlässlich zu verhindern. Der Bürgerkrieg wird damit zum Inbegriff der Unordnung. Die Ordnung des Staates, die in der Anerkennung der unbeschränkten Befugnisse des Souveräns durch die Bürger liegt, und das Chaos des Bürgerkrieges, in dem niemand seines Lebens sicher sein kann und jederzeit mit dem gewaltsamen Tod rechnen muss, bilden bei Thomas Hobbes, dem Vordenker der Staatlichkeit, die Gegenpole im politischen Zustand eines Gemeinwesens.
Doch auch die Thematisierung des Bürgerkriegs von der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts bis heute ist alles andere als einheitlich. Im Anschluss an Heinz Dieter Kittsteiner unterscheidet Potsch zwischen einer der Stabilität des Staates dienenden Bürgerkriegsvorstellung, mit der die Bürger durch den Hinweis auf die Gefahr eines Bürgerkriegs davor gewarnt werden, leichtsinnig mit der staatlichen Ordnung umzugehen; einer anschließenden Epoche, in der die Schrecken des Bürgerkriegs durch die Versprechen revolutionären Fortschritts überlagert sind und der Bürgerkrieg zur Begleiterscheinung der Revolution geworden ist, wie bei Mably, Marx und Lenin; und schließlich einer heroischen Bürgerkriegskonzeption, die Potsch an Ernst Jünger und Carl Schmitt erläutert. Jünger, so Potsch, bejaht den Bürgerkrieg, weil er in ihm eine Weiterführung und Vollendung der Schlachten des Ersten Weltkriegs sieht: In ihm soll ein neuer Mensch entstehen und gehärtet werden. Schmitt wiederum will den Staat von seiner Struktur her bürgerkriegsfähig machen und ihn, da Bürgerkriege nun einmal nicht vermeidbar seien, in die Lage versetzen, einen Bürgerkrieg durchzustehen und zu seinen Gunsten zu entscheiden. An die Stelle der Verhinderung eines Bürgerkriegs und seiner Hinnahme als Begleiterscheinung revolutionären Fortschritts tritt, jedenfalls bei Jünger, in der Zeit der Weimarer Republik das Wollen des Bürgerkriegs als Härtung eines "neuen Menschen".
Und was kommt danach? Von Schmitt und einigen seiner Anhänger ist als Bezeichnung der West-Ost-Konstellationen der Begriff "Weltbürgerkrieg" lanciert worden, aber das war eher ein politischer Kampfbegriff oder ein Missverständnis der Lage als deren präzise Erfassung. Da es keinen Weltstaat gab (und auch nicht geben wird), hat der Begriff des Weltbürgerkriegs wenig Sinn, und eine militärische Konfrontation der Blöcke hätte mit allen Charakteristika, die mit der Definition des Bürgerkriegs verbunden sind, wenig zu tun gehabt.
"Weltbürgerkrieg" ist ein Wort des politischen Raunens, das politiktheoretisch nie eine größere Rolle gespielt hat. Zu Recht hat ihm Potsch keine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Interessanter wäre gewesen, wenn er sich die jugoslawischen Zerfallskriege der Neunzigerjahre und die innergesellschaftlichen Kriege Afrikas, vom Ostkongo bis zur Sahelzone, von Somalia bis zum Sudan, vorgenommen hätte, um zu untersuchen, wie Beteiligte und Unbeteiligte das in Europa entstandene Bürgerkriegsparadigma zu deren Beschreibung genutzt und es womöglich weiterentwickelt haben. Es gibt eine reiche empirische Literatur dazu, aber ob eine "Arbeit am Begriff" stattgefunden hat - darüber hätte man gern mehr erfahren. Nichtsdestotrotz: Lukas Potsch hat ein Buch von intellektueller Schärfe und Brillanz beim Sortieren von Begriffen und Epochen geschrieben, gegenüber dem so manches zum Bürgerkrieg, das mit großem philosophischen Aplomb daherkommt, bloß fade und abgestanden wirkt. HERFRIED MÜNKLER
Lukas Potsch: "Nullpunkt der Ordnung". Modernes Denken über den Bürgerkrieg.
De Gruyter Verlag, Berlin 2025. 268 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.